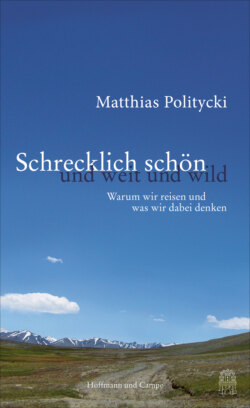Читать книгу Schrecklich schön und weit und wild - Matthias Politycki - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Netto-Erlebnis
ОглавлениеWährend unsrer Ägyptenreise 1978 schickten wir nach der Ankunft in Kairo ein Telegramm an unsre Eltern – keineswegs aus freien Stücken, sondern weil sie uns darum gebeten hatten. Es war das erste Mal, daß wir uns aus Europa herauswagten, drei Jungs und zwei Mädchen, unsre Eltern rechneten mit dem Schlimmsten. Um Geld zu sparen, schrieben wir nur ein einziges Wort: »Allesok«. Jeder von uns hatte einen Mercedes von Stuttgart nach Ägypten überführt, nachdem der Tacho abgeklemmt worden war, und selbstverständlich war nicht alles okay gewesen, was wir dabei erlebt hatten. Aber mehr Mitteilungsbedürfnis hatten wir nicht.
Mit Absendung des Telegramms waren wir offiziell zu Hause abgemeldet. Unsre Eltern konnten nur hoffen, daß wir irgendwann wieder auftauchen würden, nicht mal den Termin unsrer Rückkehr hatten wir festgelegt. So war es damals üblich, wer reiste, war weg, wirklich weg, und wenn die Zuhausegebliebenen Glück hatten, bekamen sie mit wochenlanger Verspätung eine Postkarte, auf der wieder nur stand, daß alles okay sei. Wie es wirklich gewesen war, wurde nach der Rückkehr erzählt – oder nicht mal dann.
Auch wir erfuhren damals über Wochen nichts von zu Hause, waren ganz im Hier und Jetzt unterwegs. Heute hätten wir Smartphones dabeigehabt und Eltern, Freunde, womöglich einen weiteren Kreis von Followern und Facebook-Freunden über jeden Teller Saubohnen unterrichtet, den wir am Straßenrand zu uns genommen, und über jede Suche nach einer Toilette, die darauf dringend notwendig gewesen. Wo ich auch bin, sehe ich Reisende, die gerade via Handy in ganz anderen Welten unterwegs sind. Ich frage mich, was sie von der realen Welt währenddessen mitbekommen. Aber auch die Einheimischen sind ständig mit ihren Handys zugange, selbst beim Betteln und in den entlegensten Weltteilen. Alle kommunizieren mit allen, nur nicht mit denen, die gerade physisch anwesend sind.
»Konzentrier dich darauf, wo du bist«, rät der Reiseschriftsteller Paul Theroux, »sei für daheim nicht erreichbar (…). Konzentriere dich auf das Land, wo (sic) du dich befindest.«17
Gar nicht so einfach. »Manchmal schalte ich mein Handy ein paar Tage lang nicht an«, sagt Wolle, »doch auf Dauer geht das ja nicht mehr.« Schlechte Nachrichten von zu Hause lassen uns schlechtgelaunt auf unser Reiseland blicken, gute Nachrichten werten es durch die eigene Beschwingtheit auf, beides verzerrt unsre Eindrücke. Die ständige Vernetzung mit Gesprächspartnern, aber auch mit all den Plattformen, die zu Sehenswürdigkeiten, Restaurants und Aktivititäten reihenweise Tips virtueller Reisegefährten bieten, läuft darauf hinaus, daß man nie allein ist und mit Haut und Haar in der Fremde. Sieht man, wie sich ein Großteil der Reisenden per Google Maps von Straßenecke zu Straßenecke hangelt, kaum je den Blick vom Smartphone weg und ins Offene richtend, muß man sie bedauern. Zumindest finden sie die vorgeschlagenen Lokalitäten und dort dann ihresgleichen. Was werden sie vom Land, das sie bereisen, später erzählen?
Wahrscheinlich erzählen sie nicht viel, sondern zeigen Selfies. Während sie bei jeder anderen Tätigkeit ihr Display im Auge behalten, um sofort mitzubekommen, was aus anderen Ecken der Welt an neuen Botschaften eingeht, wechseln sie im Akt des Selfie-Machens die Rolle: Nun sind sie’s selbst, die wenige Sekunden später die digitale Gemeinde mit einer Kurznachricht samt Foto beglücken. Wichtig ist der hochgereckte Daumen – was im Hintergrund als Teil der Pyramiden oder der Chinesischen Mauer zu sehen ist, spielt allenfalls eine Rolle als Beweismaterial. Die Sehenswürdigkeit dient der Dokumentation des eigenen Lebens, genau genommen: der eigenen Lebendigkeit. Selbst das Betrachten derselben findet per Handy statt, der Datenspeicher ersetzt das eigene Bildgedächtnis.
Früher hat man mehr oder weniger verstohlen Einheimische bei ihren Alltagsverrichtungen fotografiert. Nun geschieht es laufend und in brüskierender Direktheit, indem man sie, offensiv fröhlich, kurzerhand als Motiv vereinnahmt und sich dazugruppiert. Wenn sich ein Strassenhändler entziehen oder ein Rikschafahrer Geld dafür haben will, gilt er als Spielverderber. In etlichen Ländern fotografieren die Einheimischen so wild wie die Touristen, auch als Reisender wird man dort oft zum Motiv. Manche sprechen einen wenigstens noch an, wenn sie gemeinsam mit einem Weißen abgelichtet werden wollen, die meisten knipsen einfach drauflos, sobald man auftaucht, die dreistesten filmen per Handy. Wenn man protestiert, ist ausnahmsweise mal ein Fremder der Spielverderber.
Fotografieren ist nicht mehr nur das entschiedene Hobby einzelner, Fotografieren ist Lifestyle und unterliegt doch auch gleichzeitig einem gewissen Leistungsdruck. Viele der Sehenswürdigkeiten sind bereits zu Rummelplätzen verkommen, auf denen sich die Weltjugend zum Posen trifft. Der zur Schau gestellte Frohsinn kann dem Unbeteiligten richtig schlechte Laune machen. Indra erzählt, daß die Christus-Statue in Rio bei ihrem Besuch so umlagert war von Touristen, die, auf dem Boden liegend, Selfies mit Christus inszenierten, daß sie dort vor allem aufpassen mußte, niemanden zu treten. Der Maler Johannes Nawrath steht auf Reisen früh auf, um die Sehenswürdigkeit ein zweites Mal, ohne Touristen, zu sehen – und abzufotografieren, freilich auf altmodische Weise: »Wenn man fotografiert, schaut man die Sachen nicht mehr als Ganzes an. Sondern fotografiert Ausschnitte davon. Eigentlich müßte man immer erst ohne Fotoapparat losgehen (ob in einer Landschaft oder einer Stadt) und danach ein zweites Mal mit Fotoapparat. Sonst nimmt man zwar optische Konserven mit nach Hause, aber das Original hat man gar nicht erlebt.«
Der touristische Blick, erklärt er, behindert seinen künstlerischen Blick. Sein bislang größtes Problem war Venedig. Er brauchte zwei volle Tage, um hinter all den Postkartenansichten wieder die Stadt zu sehen – in den Wasserspiegelungen der Kanäle: »Du bist in einer der malerischsten Städte der Welt und siehst erst mal nur, was du sowieso schon irgendwie kennst. Als Maler brauche ich jedoch unverbrauchte Motive. Die Fotos, die ich mache, sind die Ernte meiner Reise, darauf basiert mein zukünftiges Schaffen.«
Auch Eric macht mit Leidenschaft Fotos: »Ein gutes Bild ist stärker als alle Worte dieser Welt. Es ist eine Metapher für viel mehr, als es die Beschreibung einer Situation je sein könnte.«
Eric ist auf seine Weise konservativ, er fotografiert noch mit einer digitalen Spiegelreflexkamera. Alle anderen, die ich gefragt habe, benutzen ihr Smartphone. Dschisaiki: »Sehenswürdigkeiten fotografiere ich damit aber kaum. Eher deren Gegenteil. Diese Fotos werden zum Tagebuch.«
Der K: »Reisetagebuch habe ich früher regelmäßig geführt, heute muß häufig ein Facebook-Post als Substitut herhalten.«
Wenn ich selbst gelegentlich Fotos mache, vielleicht aus dokumentarischen Gründen, verengt sich mein Blick auf der Suche nach dem Motiv sofort – und schon kann ich einen zauberhaften Moment nicht mehr genießen. Im Himalaja fotografierte ich eine Yak-Karawane, die uns unter blühenden Rhododendronbäumen entgegenkam. Das Ergebnis war deprimierend. Auf den Bildern fehlte die schwingende Bewegung der Schädel beim Gehen, das dunkle Läuten der Halsglocken, der Zuruf des Treibers, das Zwitschern der Vögel. Zu mehr als dem bloßen Schauen reicht es bei mir meist nicht. Am liebsten reise ich netto.
Und mache mir Notizen. Nicht aus Prinzip, eine Reise ohne jede Notiz ist mir ganz recht. Meist halte ich der Flut der Eindrücke aber nicht stand, ohne dagegen anzuschreiben. In jedem Fall führe ich eine Art Reiseprotokoll im Rahmen meiner sogenannten Braunen Bücher. Gemeint sind rido Reise-merker, die ich seit 1975 übers ganze Jahr führe; es gab sie anfangs nur mit braunem Einband, daher der Name. Sie dienen weniger als Tagebuch denn als sparsam kommentierte Auflistung der täglichen Fakten. Um das vorliegende Buch zu schreiben, habe ich sie alle wiedergelesen und war nicht selten überrascht, wie deutlich mir die Reise anhand weniger Worte tatsächlich vor Augen stand. Auch wenn Eric das Gegenteil behauptet: Manchmal ist eine Notiz stärker als alle Fotos dieser Welt.
Einmal bin ich wegen meiner Notizenmacherei verhaftet worden, 2006 im kubanischen Oriente. Mit meinem Freund Cuqui und dessen Frau Mariella war ich in den Bergen der Sierra Maestra unterwegs, sie tauschten bei den Bauern Kleider gegen Lebensmittel – ein Paar alter Schuhe gegen ein Huhn zum Beispiel. Eine Weile folgte uns ein Polizist in Zivil. Als Mariella gerade eine selbstgenähte Jeansshorts gegen ein weiteres Huhn eingehandelt hatte, griff er zu. Erst im Tal erfolgte das Verhör, dann kam der Polizeichef zum nächsten Verhör. Und um mir mitzuteilen, das Gesetz Nr. 23 verbiete Touristen, hier herumzulaufen. Tags drauf mußte ich mich beim Chef de Immigracion in Santiago de Cuba melden: Nach einer Dreiviertelstunde Kreuzverhör durch zwei Offiziere der Geheimpolizei stellte sich heraus, daß es kein Gesetz Nr. 23 gab. Verdächtig war ich geworden, weil ich keine Fotos gemacht hatte, sondern Notizen! Wieso ich mich überhaupt in den Bergen herumgetrieben hätte, da gebe es doch nichts zu sehen? Am Schluß verabschiedeten sie mich per Handschlag: Kuba sei ein kleines Land, umgeben von Feinden, da müsse man schon ein bißchen aufpassen auf Leute wie mich. Ob ich sie verstehen würde? Ich verstand sie.
*
Zehn Jahre später fuhr ich in den Nordostzipfel von Indien, weil ich hoffte, daß man wenigstens dort noch netto reisen konnte, also einfach drauflos, ohne Smartphone und Internet. Ich hatte mich getäuscht, es ging nur brutto, in die meisten Hotels kam man gar nicht erst hinein, wenn man nicht zuvor online ein Zimmer gebucht hatte. In Indien! Zum Glück hatte ich mein MacBook dabei, eigentlich um Notizen über die Reise festzuhalten, nun brauchte ich es, um überhaupt reisen zu können. Jeden zweiten Abend war ich abends im Netz, um mir – von TripAdvisor über goibibo.com, ClearTrip und Agoda bis Booking.com – Hotels anzusehen und ihre Lage auf Google Maps zu vergleichen. Der Buchungsvorgang selbst erforderte ähnlich starke Nerven wie früher die Suche nach einer Unterkunft in einer verwinkelten Altstadt und das Feilschen um den Zimmerpreis. Das Netz in Indien ist langsam, oft bricht es im entscheidenden Moment zusammen. In letzter Instanz scheitert man daran, daß man keine indische Handynummer angeben kann oder keine indische Kreditkartennummer.
Zwangsläufig sieht man dabei Fotos und liest Erfahrungsberichte früherer Hotelgäste, man kann sich dem Sog nicht entziehen, auch wenn man weiß, daß man sich damit die Freude des Ankommens verdirbt. Nur selten gab es dabei etwas zu lachen: Als ich eine Zugfahrkarte buchen wollte, bekam ich auf makemytrip, »India’s No 1 Travel Site«, die Meldung: »No bookings can be made between 8:00 AM and 08:30 AM as per Indian Railways regulations.« Ähnlich restriktiv die Seite von Indian Railways selbst: Ich solle mich später wieder melden, im Moment sei gerade – tatsächlich wurde das so lapidar behauptet – Mittagspause.
Weil ich ohnehin schon vor einem Computer saß, beantwortete ich auch gleich meine Mails, bereitete meine Reiseziele per Wikipedia und weiterer Spezialseiten vor oder nach. Schließlich las ich sogar politische Nachrichten aus Deutschland und dann noch die Ergebnisse auf kicker.de.
Auf dieser Reise fotografierte ich auch. Abends sichtete ich die Bilder des Tages, sortierte aus, schickte das schönste davon in die eine oder andre Gegend der Welt und empfing im Gegenzug Fotos aus ebenjenen Gegenden. Ständig nahm ich Anteil an den Erlebnissen der Daheimgebliebenen oder gerade in anderen Ländern Reisenden, teilte ihre Sorgen und erzählte von den meinen, gab Ratschläge oder erbat sie, ja verabredete mich bereits wieder mit ihnen. Es war wie ein Fluch: Kaum war ich online, fand ich mehr und mehr Gründe, online zu bleiben. In-der-Fremde-Abtauchen geht anders.