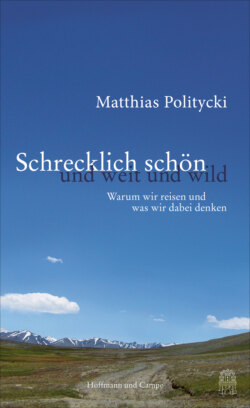Читать книгу Schrecklich schön und weit und wild - Matthias Politycki - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Stadtwandern (I)
Оглавление»Mein Gott ist der Gott der Wanderer«, schreibt Bruce Chatwin in seinem Reisebericht »In Patagonien«: »Wenn man lange genug wandert, braucht man wahrscheinlich keinen anderen Gott.«30 Mit der Entdeckung des Wanderns Ende des 18. Jahrhunderts durch das Bürgertum wurde Gehen zur Freizeitbeschäftigung. Die Romantiker betrieben es als Selbsterfahrung im Spiegel der Landschaft – und das ist es bis heute für viele geblieben.
Tatsächlich finden sich viele religiöse Anklänge in den Bekundungen von Wanderern, am extremsten vielleicht bei Henry David Thoreau, dem amerikanischen Apologeten der Wildnis. Tagtäglich durch Wald und Wiese seiner unmittelbaren Heimat zu streifen war für ihn eine Wallfahrt ins »Heilige Land« der Natur oder gar »eine Art Kreuzzug«, »der Versuch, hinauszugehen und dieses Heilige Land aus der Hand der Ungläubigen zu befreien«.31
Auch für Achill ist Gehen ein »Akt der Befreiung« und »ein Weg zum Glück«. Er ist nicht nur Wüstenwanderer, als der er bekannt wurde, sondern Lebenswanderer, ob in der spanischen Mancha, den nordamerikanischen Badlands, am Nil oder im Harz. Unter meinen Reisegefährten ist er das krasse Gegenteil von Dr. Black; am liebsten würde er auch dort noch wandern, wo man nur mit dem Auto fahren darf, über die Hamburger Köhlbrandbrücke zum Beispiel oder auf den Stelzen-Autobahnen in Seoul, die auf 20 bis 30 Meter Höhe durch die Wolkenkratzer führen.
Auch ich kenne das »erhebende Gefühl, auf dem Weg zu sein« und dabei »das Aktive mit dem Kontemplativen zu verbinden«.32 Wer lange genug geht, wird zum Weg – aber auch zum Berg, zum Tal, zur Wüste, zum Himmel über der Wüste. Alles ist hier und jetzt und eins, man selber auf beiläufige Weise mitten darin, die ganze Welt auf grandiose Weise im Lot. In solchen Momenten ist man im Besitz des Zen, vergleichbar dem »Runner’s High«, wie es Läufer erleben. Beides entsteht aus der repetitiven Monotonie der Bewegungsabläufe, die das Gegenteil von Langeweile ist, und führt zur vollendeten Leere. Es geht.
Keine Frage, das ist das Glück. Freilich muß die Landschaft auch gleichförmig genug sein, um ein gleichmäßiges Gehen zu ermöglichen. Will man höher hinauf in die Berge oder tiefer hinein in die Wälder, verliert sich der Automatismus des Gehens schnell, das Ich übernimmt wieder die Regie und sondiert mit hellwachen Sinnen das Terrain. Je existentieller die Herausforderungen, desto klarer und einfacher werden die Gedanken, die man während der kurzen Verschnaufpausen hat. Es denkt.
Keine Frage, auch das ist großartig. Dennoch bin ich, ohne daß ich es bewußt so gewollt hätte, vor allem anderen ein Stadtwanderer. Die Stadt, insbesondere die Megastadt, die den einzelnen mit ihren gewaltigen Selbstinszenierungen zu erschlagen droht und schon knapp daneben in tiefste Provinz umschlägt, das erscheint mir mehr denn alles andere als unsre Welt, unsre Gegenwart. Wider Willen setze ich mich ihr aus, immer wieder. Denn ich bin weißgott kein Fan jener Städte, sie bringen mich nicht weniger schmerzhaft an meine Leistungsgrenze als eine schwierige Tour in einer schwierigen Landschaft.
London, New York, Delhi, Peking … das sind auf ihre Weise Extremlandschaften. Die Wanderung überhaupt zu beginnen ist die erste Mutprobe, die sie uns abverlangen. Das kleine Einmaleins des Reisenden besteht darin, auf jeder Station zunächst sichere Routen zu erkunden und damit die Komplexität des Fremden zu reduzieren. In den Metropolen der Welt mit ihren zahlreichen Zentren und Subzentren kommt man mit dem kleinen Einmaleins jedoch nicht weit. Überdies sind viele dieser Knotenpunkte, insbesondere in Fernost, auf mehreren Ebenen begehbar: auf riesigen Fußgängerbrücken, die ganze Stadtviertel queren, parterre und in unterirdischen Passagen, die sich zu kilometerlangen Einkaufsstraßen mit Plätzen, Brunnen, Gärten und Cafés entwickeln. Weder Brücken noch Passagen folgen dem Straßenverlauf, wie er durch den Stadtplan kodifiziert ist, es gibt unzählige Abzweigungen und Ausgänge, die oft direkt in Einkaufszentren, Büro- und Restauranttürmen münden – man weiß anfangs nie, wo man wieder auf die Straße kommt.
In Hongkong kann man auf diese Weise per Rolltreppe durchs halbe Stadtzentrum und tüchtig bergauf in die »Mid-Levels« fahren, wo die Schlafstädte liegen. Zur Rushhour morgens laufen alle Rolltreppen in entgegengesetzter Richtung, hinunter ins Geschäftszentrum. Das Ganze ist auf eine simple Weise mustergültig, es als Besucher zu erleben wirkt gleichermaßen euphorisierend wie einschüchternd. Allein schon diese Kette an perfekt miteinander vernetzten Rolltreppen zu bestaunen, degradiert uns zum Besucher aus einem Entwicklungsland. Eine Wanderung durch eine fernöstliche Megacity ist an ihren entscheidenden Stellen eine Reise in die Zukunft, jedenfalls für einen Europäer, der solche Städte sonst nur aus Science-Fiction-Filmen kennt.
Aber auch anarchisch wuchernde Megacitys wie Jakarta können bis zur Verzweiflung verwirrend sein. Das Gassenlabyrinth der interessantesten Viertel wird von keinem Stadtplan angemessen erfaßt, der Reisende irrt darin, solang er strebt. Beide Arten von Megacitys verpassen uns zur Begrüßung einen Kulturschock, die einen mit ihrem hyperperfekten Ordnungssystem, die anderen mit Chaos. Wie sollte man sich dort je zurechtfinden, ja mehr noch: die Stadt begreifen? Ich versuche es andersherum: versuche als erstes, die Stadt zu begreifen, und dann erst, mich darin zurechtzufinden. Dazu muß ich einen Blick von oben auf sie werfen, der mir ihre Struktur zeigt, bloßes Herumfahren mit der U-Bahn nützt mir nichts.
1976 standen wir auf der Akropolis und konnten nicht fassen, was wir sahen. Athen zog sich unter unseren Augen als Gewirr von Dächern und Mauern so weit in sämtliche Himmelsrichtungen, daß wir spontan beschlossen, es mit der »Besichtigung« von oben gut sein zu lassen. Wir fanden uns ziemlich ausgebufft, als wir am selben Tag noch Richtung Sparta weiterfuhren. In Wirklichkeit hatten wir klein beigegeben.
Zwei Jahre später bissen wir uns an Kairo die Zähne aus. Wir hatten keinen vernünftigen Stadtplan auftreiben können, im Grunde kamen wir nur voran, indem wir uns verliefen und immer weiter verliefen. Einmal zerstritten wir uns dabei, fünf Ahnungslose, die es jeder besser zu wissen glaubten als die andern. Mich führte mein Weg danach zur Ibn-Tulun-Moschee, ich stieg aufs Minarett und … blieb wer weiß wie lange. Was ich von dort oben sah, erkannte ich zum Teil, ein paar Moscheen, die Zitadelle, vor allem aber sah ich zum ersten Mal die unfaßbare Ausdehnung der Stadt.
Wenn man lange genug über eine Stadt blickt, fängt man an, da und dort, wo sie besonders markante Punkte aufweist, in sie hineinzublicken. Irgendwann zieht man Verbindungslinien zu den Punkten und zwischen ihnen. Schließlich genießt man nicht mehr nur den Anblick, sondern dessen zugrundeliegenden Bauplan. Hat man eine Karte zur Hand, potenziert sich die Erkenntnis.
In der Bar Cloud 9 des Grand Hyatt von Shanghai kann man auf den Bund wie auf eine Spielzeugstraße hinabblicken und dazu für horrendes Geld Cocktails trinken, bis um halb elf schlagartig die Beleuchtung aller Hochhäuser ausgeschaltet wird. Auf dem Canton Tower läßt man sich mit einer Bubble-Tour-Bahn am Rand des Aussichtsdecks herumfahren. Im Cosmo Tower von Osaka gibt es speziell in Richtung Sonnenuntergang kleine Sofa-Nischen, um den Anblick ungestört zu zweit zu genießen. Auf dem Fernsehturm von Taschkent gibt es gar nichts, im Restaurant einen Stock unter der Aussichtsetage trifft sich abends die örtliche Mafia. Es ist ziemlich aufschlußreich, wie sich Städte anhand ihrer Aussichtstürme präsentieren, auch anhand der Beleuchtung, die sie ihren Bürotürmen mit Einbruch der Dämmerung verpassen. Während sich Seoul oder Tokio in ruhig schimmernde Lichtermeere verwandeln, auf denen nur die Spitzen der Wolkenkratzer mit Hunderten an Signallampen rot blinken, überziehen sich in chinesischen Städten ganze Hochhausfronten und Brücken mit Neonmustern, die Form und Farbe ständig ändern.33
Dann aber Dubai. Schon das zweithöchste Gebäude der Welt, der Tokyo Skytree (634 Meter), ist ein Fingerzeig aus dem 22. Jahrhundert. Die obere Aussichtsplattform (450 Meter) war zum Zeitpunkt meines Besuches mit Figuren aus »Krieg der Sterne« dekoriert, so daß man die futuristische Kulisse, die Tokio ohnehin bietet, mit den passenden futuristischen Lebewesen fotografieren konnte. An speziellen Fotopoints konnte der Besucher selber mit Laserschwert vor dem Panorama posieren. Die untere Plattform (350 Meter) bietet eine überraschend andere Perspektive auf die Stadt als die, die man hundert Meter höher gewinnt – der Einfallswinkel des Blicks ist flacher, »menschlicher«. Hier gibt es meterlange Touchscreens, auf denen die Aussicht in Ruhe als interaktives Foto zu genießen ist, falls man das Gedränge an den Glasfronten vermeiden will. Einzelne Ausschnitte der Wolkenkratzerkulisse kann man heranzoomen oder auf Nachtbeleuchtung umschalten. Jahreszeitlich (in meinem Fall: mit Weihnachtsbäumen) dekorierte Fotopunkte gibt es natürlich auch.
Dann aber Dubai. Das Burj Khalifa (828 Meter) ist derzeit mit Abstand das höchste Gebäude der Welt; Zweiklassentourismus auch hier. Auf der höchsten der drei Aussichtsplattformen (555,70 Meter) werden Säfte und Pralinen gereicht, die in der deftigen Eintrittsgebühr von 125 Euro (2015) enthalten sind. Man spricht in gedämpftem Ton, als wäre man in einem exklusiven Club, und tatsächlich ist man’s für die Dauer des Besuchs ja auch. Man fühlt sich noch weit mehr wie im Turmbau zu Babel als auf den beiden unteren Aussichtsplattformen, wo sich die Wucht des Anblicks schon wieder reduziert hat. Selbst mitten in der Stadt entdeckt man überall unbebaute Planquadrate, die noch von der Wüste beherrscht werden. Und plötzlich sieht man schon die Ruinen, wie sie vielleicht irgendwann in der Zukunft hier zu besichtigen sein werden, wenn sich die Wüste all das verlorene Terrain wieder zurückgeholt hat.
Dubai als das Babylon unseres Jahrhunderts, das ist ein Anblick, der weit über die bloße Orientierung hinaus beschäftigt. Die Hybris des Menschen, etwas innerhalb weniger Jahre aus dem Boden zu stampfen, das im Falle Tokios während einer 1000jährigen Geschichte langsam gewachsen ist – eine Weltstadt –, wirkt gleichermaßen niederschmetternd wie beflügelnd. Manch einer zieht sich zur Erinnerung einen Goldbarren aus dem Automaten, bevor er das Burj Khalifa verläßt.
Seitdem ich in Kairo die Zeit vergaß, weil mich die Ansicht der Welt von oben so in den Bann schlug, habe ich zielstrebig überall in der Fremde ähnliche Blicke gesammelt. Nicht nur meine Reisen sind davon geprägt, mein Blick auf die Welt insgesamt ist es. Als ich damals endlich vom Minarett der Ibn-Tulun-Moschee hinabstieg, war die Tür verschlossen. Ich stieg wieder hoch, ging über die Dächer zum Haupttor und warf Steinchen zwischen die Bettler, die traditionell vor dem Eingang sitzen. Auf der Stelle hob ein Geschrei an, wenige Minuten später stand ich selber dort unten. Und dann ging ich los.