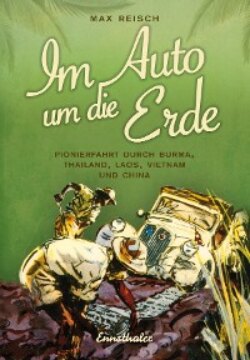Читать книгу Im Auto um die Erde - Max Reisch - Страница 9
Auf der Ölstraße nach Bagdad
ОглавлениеAm Toten Meer • Weltmacht I.P.C. •
Wir werden weitergereicht • Ein Wüstenfest auf H. 2
Auf der Motorradtour nach Indien war ich mit Herbert Tichy vorsorglich am Rande der Wüste und fast stets den Ufern des Euphrat folgend nach Bagdad gefahren. Jetzt wollten wir den kürzesten Weg durch die Wüste wählen. Je mehr ich mich erkundigte, desto verwirrender gestalteten sich unsere Pläne. Es kostete viel Geduld und Nerven, alle verlangten und unverlangten Ratschläge entgegenzunehmen und auf ihren Ernst zu prüfen. »Hundertsiebzig Pfund sind zu erlegen, wenn Sie die Wüste allein durchqueren wollen. Das Geld dient zur Sicherstellung der Kosten, wenn Sie mit Flugzeug gesucht werden müssen«, sagte der Zolldirektor in Haifa. Diese Bestimmung besteht tatsächlich, doch wird sie umgangen, indem sich mehrere Autos zu einer Kolonne zusammenschließen.
Mr. Nairn, Besitzer der größten Transportgesellschaft durch die Wüste, will uns richtig bange machen. Er spricht von allerhand Unglücks- und Überfällen. Am besten sei es wohl, »this funny little car« auf einen seiner großen Lastwagen zu verladen. Fünfunddreißig Pfund. Ausnahmsweise so billig, weil er ein sportliches Herz habe. Wir aber sind gekränkt. Die Zumutung, die »Transasien-Expedition« huckepack durch die Wüste zu schleppen, ist doch zu schimpflich. Das geht zu weit, Mister Nairn, good-bye.
Beim »Automobilclub of Palestine« suchen wir als nächstes Rat. Ein ältliches englisches Fräulein empfängt uns in den vornehmen Klubräumen im King David Hotel. Sie wisse nicht recht, wie das zu machen sei. Landkarten, Streckenbeschreibungen habe sie auch nicht. Aber morgen sei ein Gymkhana, ein Autogeschicklichkeits-Wettbewerb, auf dem arabischen Sportplatz. Ob wir da nicht mitmachen wollten?
So geht das weiter und wir wundern uns: Fast täglich fahren Autos durch die Wüste zur »Stadt von Tausend und einer Nacht«, und niemand weiß, wie man das macht. Mit Ausnahme von Mr. Nairn, der lebt ja davon.
Tipp Nr. 4 gibt uns Chaim Nathaniel und sein Rat ist nicht der schlechteste: »Schließen Sie sich meinem Konvoi an. Das ist eine Autokarawane unter militärischer Bedeckung. Nächsten Donnerstag ab Damaskus. Ich bin bereit, Sie mitzunehmen, obwohl ich sicher Ärger haben werde, denn nur gute Wagen sollen in der Wüste fahren.« Wir fragten erst gar nicht nach dem Preis, weil mich die letzte Bemerkung wurmte.
Es war Helmuths ausgezeichnete Idee, der Niederlassung der »Iraq Petrol Company« in Jerusalem einen Besuch abzustatten. Im Trubel unserer Sorgen hatte ich ganz vergessen, dass ich einen Empfehlungsbrief an diese Ölgesellschaft besaß.
Um es gleich vorwegzunehmen: Dieser Besuch war Balsam auf die Wunden, die uns Mr. Nairn, Chaim Nathaniel und das sauertöpfische Fräulein im Autoklub zugefügt hatten.
»Wo bleiben Sie denn so lange? Wir warten schon seit Wochen auf Sie!«
Wir sind sprachlos.
Mr. MacPherson, der Allgewaltige der I.P.C., blättert in dem Aktenumschlag, auf dem fein säuberlich geschrieben steht: Austrian Transasian Expedition. Briefe aus Wien und London und Zeitungsausschnitte über die geplante Reise liegen geordnet in der Mappe. Ich fühle, dass hier die Geschicke unserer Reise in eine weltumspannende Organisation verwoben sind und dass uns nun ein guter Stern führen wird.
»Was also kann ich für Sie tun?«
»Wie kommen wir am besten nach Bagdad?«
»Oh – das ist alles schon vorbereitet. Sie sind Gäste der I.P.C. und erhalten die Erlaubnis, unsere Privatstraße durch die Wüste zu benützen. Die Straße ist nur für die Dienstautos der I.P.C.; jeden anderen Verkehr weisen unsere Patrouillen zurück. Aber hier sind Ihre Ausweise.« Damit eröffnen sich für die Wüstendurchquerung völlig neue Perspektiven. Wir werden nicht den üblichen Weg über Damaskus und die Oase Rutbah Wells nehmen, sondern entlang der Erdölleitung bis El Hadithe am Euphrat und von dort auf bekanntem Weg nach Bagdad.
Sofort gehen fünf Telegramme an die entsprechenden Pumpstationen in der Wüste und liebenswürdig verabschiedet uns Mr. MacPherson: »Sie werden staunen, wie angenehm wir Engländer auch in der Wüste zu leben verstehen.«
Voll hochgespannter Erwartungen und guter Laune treten wir noch am selben Nachmittag die Fahrt in die Wüste an. Über siedend heißen Asphalt gleitet der Wagen durch die Schluchten Judäas abwärts, bis eine Tafel auf Arabisch, Hebräisch und Englisch das Wort »Meereshöhe« verkündet. Vierhundert Meter geht es dann noch tiefer und es ist ein eigenartiges Gefühl, »über sich« Berge vom Wasser aller Weltmeere zu wissen.
Nun stehen wir an der bleiern schweren Fläche des Toten Meeres. Kann man darin wirklich nicht untergehen? Wir machen einen praktischen Versuch. Regungslos, gleich einem Kork, liegt man auf dem Wasser. Schwimmen im üblichen Sinn ist kaum möglich, weil man mit Händen und Füßen mehr in der Luft als im Wasser herumrudert. »Man raucht eine Zigarette, liest ungestört die Zeitung oder beschattet sich mit einem Schirm«, so steht es in den Prospekten. Solche Ansichtskarten kann man kaufen und in dieser Pose kann man sich fotografieren lassen. Ein jüdischer Fotograf wartet ständig auf neue Opfer. Wie wird doch Miss Liddledale in Nashville, Tennessee, staunen über das Bild von Mrs. Tucker: »Myself in the Dead Sea, in the beautiful Holy Land!«
Indessen ist das gemütliche Zeitunglesen nur geschäftstüchtige Theorie. Schon nach wenigen Minuten tut das Salz seine Wirkung. Es kribbelt und brennt in den Poren und man hat nur einen Wunsch: Heraus aus der Tunke! Zwanzig Prozent Salzgehalt wollen mit Vorsicht genossen sein. Schnell in den Jordan hinein und die Salzkruste gründlich abgespült! Mag sein, dass just an dieser Stelle einst Johannes Jesum Christum taufte. Sicher ist, dass dort, wo einst der tüchtige englische General Allenby den Fluss überquerte, jetzt eine schöne Brücke, nach diesem General benannt, den Fluss überspannt. Wir sind ihm weniger für seine Taten als für diese Brücke dankbar. Damit hört aber auch alles auf, was mit Straßenbau und Zivilisation zusammenhängt. Wir verlassen Palästina und treten ein in das selbständige Emirat Transjordanien.
Damit beginnt endlich das wirkliche Asien.
Steinig und steil steigt der Weg aus der Depression des Toten Meeres an den Hängen des Jordantales aufwärts. 1200 Meter Höhe sind im El-Barka-Gebirge zu überwinden bis nach Amman, der Hauptstadt Transjordaniens. Mörderisch brennt die Maisonne auf die kahlen Felswände und schwer arbeitet sich der Motor im ersten Gang höher. Das Kühlerthermometer zeigt schon über 90 Grad.
»Der Wagen ist viel zu schwer!«
Helmuth nickt schweigend. Ich schiele zu ihm hinüber und sehe sein besorgtes Gesicht. Die überlasteten Federn ächzen auf dem holprigen Weg.
100 Grad. Der Kühler pfeift und kocht. Ich halte den Wagen an. Helmuth kramt eine Landkarte von Asien hervor: »Da ist Palästina und da ist China. Etwa 400 Kilometer sind wir schon gefahren und rund 23.000 sind es noch.«
Wir saßen lange grübelnd nebeneinander, die große Asienkarte auf den Knien. Wir waren beide sehr bedrückt und ich dachte mit einer gewissen Wehmut an die Indienfahrt mit dem Motorrad zurück. Damals gab es keinen kochenden Kühler und keine Möglichkeit, Berge von Gepäck mitzuschleppen …
Unser Ballast war die Ursache allen Übels und in dieser Erkenntnis sagte ich schließlich: »Wir müssen uns bescheiden! Der hintere Teil der Karosserie muss radikal beschnitten und das Gepäck nochmals reduziert werden.«
Ob das aber gegen die Überhitzung des Motors bei diesem Klima entscheidend hilft? Im Bordbuch steht: »Warum hat der Motor keine Wasserpumpe?« Dazu ist zu sagen: »Die serienmäßige Thermosiphon-Kühlung war für Europa sicher ausreichend. Aber für diese Expedition? Warum hat die Fabrik keine Wasserpumpe eingebaut? – So schiebe ich die halbe Schuld auf andere: Andererseits wäre es wohl meine Aufgabe gewesen, die Fabrik auf die Klima-Probleme aufmerksam zu machen. Und wiederum andererseits: Die Direktion hatte darauf bestanden, dass nichts geändert werde; ein serienmäßiger Wagen, wie ihn jeder Kunde kaufen kann, soll Asien durchqueren! Das war sicherlich ein gewichtiges Werbeargument. Aber wir hatten darunter zu leiden.
Durch die Syrische Wüste
Helmuth lächelte, aber er sagte nichts. Wir wurden uns einig, dass in Bagdad der Umbau der Karosserie erfolgen sollte.
Zumindest seelisch erleichtert fuhren wir bei Einbruch der Dunkelheit weiter. Schön sind die Nachtfahrten im Orient. Ein satt funkelnder Sternenhimmel, fast greifbar nahe, wölbt sich über der Landschaft. In den Felsen der Schlucht sitzen eng beisammen Scharen von Störchen. Wie Schneeflächen leuchten sie auf, wenn das Licht auf ihr Gefieder fällt. Sie scheuen nicht auf, denn sie sind müde von der langen Reise. Vom Sudan kommen sie und wissen, morgen geht es weiter, den nordischen Gefilden, dem europäischen Frühling entgegen. Einige heben verschlafen den Kopf aus dem Gefieder und sehen uns mit den ernsten Philosophenaugen lange nach. Vielleich denkt einer: Komische Menschen, jetzt nach dem Süden zu reisen!
Um elf Uhr abends schlagen wir das Zelt auf. Es ist das erste Nachtlager der Expedition unter freiem Himmel. Auf den Feldbetten schläft es sich herrlich und ich dachte an die vielen, endlos langen Nächte zurück, die ich auf früheren Motorradfahrten auf nackter Erde verbracht hatte. Aber ich konnte mich meines weichen Bettes nicht richtig freuen. Dieser Komfort war teuer erkauft.
Wir schlafen kaum, als grelles Licht uns weckt. Aus einem Auto springen verwegene Gestalten und eilen auf uns zu. Auch wir springen von den Betten hoch. Arabische Stimmen reden auf uns ein, bis wir uns auf Englisch einigen: Nein, wir sind keine Briganten und Räuber. Nein, wir fühlen uns ganz sicher hier und brauchen keinen Schutz. Vielen Dank!
Die Militärpatrouille des Emirs Abdullah salutiert, besteigt ihren Wagen und ist bald im Dunkel der Nacht verschwunden.
Sechzig Kilometer nördlich von Amman verläuft in ziemlich genauer Ost-West-Richtung die Ölleitung. An sie wollen wir baldmöglichst Anschluss gewinnen. Mehrmals quert die sandige Piste die Schienen der berühmten Hedschasbahn, auf der jetzt nur mehr einmal die Woche ein Zug bis Maan in Südtransjordanien fährt. Früher verkehrte diese Bahn 1300 Kilometer lang bis Medina, heute besteht sie nur mehr auf der Karte. Schwellen, Schienen, Signalanlagen, ja selbst die Stationsgebäude wurden stückweise von den Beduinen verschleppt. Ich möchte kein Aktionär der Hedschasbahn sein, schon lieber von der Iraq Petrol Company, deren Ölleitung jetzt vor uns in der gleißenden Wüste liegt. Sehen kann man sie freilich nicht. Nur ein endlos langer Erdwall deutet an, dass unter ihm das dreißig Zentimeter starke Stahlrohr liegt, durch das das »flüssige Gold« pulsiert. Von unserem Standort sind es achthundert Kilometer bis nach Kirkuk, wo das Erdöl aus der Tiefe quillt. Nach der anderen Seite hundertfünfzig Kilometer bis zum Mittelmeer.
Nach Osten wendet sich der Blick. Immer kleiner und kleiner werden die Masten der Telegraphenleitung, schließlich verschwinden sie am flimmernden Horizont.
Noch sechshundert Kilometer Wüste bis Bagdad. Werden wir uns verirren? Brauchen wir einen Kompass? Ist die Wüstenfahrt ein Wagnis? Nein, dreimal nein.
Wir haben drei gute Freunde als Begleiter: über uns die Telegraphendrähte, unter uns die Erdölleitung und mit uns der Brief der I.P.C. Solcherart ist eine Wüstenfahrt ein Kinderspiel. Wir brauchen nur einen Draht an einen Stein binden und diesen über die Leitung werfen. In spätestens einem halben Tag wird ein Störtrupp der I.P.C. zur Stelle sein.
Von der gebauten Straße, von der MacPherson sprach, ist nicht viel zu sehen: Hart und felsig ist der Wüstenboden, man muss den Spuren der I.P.C.-Dienstautos folgen. Oft geht der Weg weitab von der Telegraphenleitung, aber immer wieder kehrt er zu ihr zurück.
Am Abend des 30. Mai tauchen aus dem Dunst der Steppe zwei schlanke Türme auf. Bald erkennen wir auch die Antenne, die sich zwischen ihnen spannt; Mauern und Häuser nehmen Gestalt an. Die erste Pumpstation, »H.5«, liegt vor uns. Ein stacheldrahtartiges, hohes Gitter, wohl einige hundert Meter im Quadrat, umschließt die weitläufige Anlage. Der Wachposten lässt uns passieren, weiße Männer sind keine Räuber, das weiß er.
Trotz der abendlichen Stunde ist es noch drückend heiß. Mr. Meadows, der Leiter der H.5, sitzt in Hemdsärmeln in seinem Bungalow. Whisky-Soda wird aufgetragen und der kreisende Ventilator peitscht einen wohltuenden Luftstrom in die weit offenen Hemden.
»Gute Fahrt gehabt?«, fragt der Manager und dann übergibt er uns ein Telegramm:
»Hoffe Sie gut in H.5 angekommen, wünsche gute Weiterreise. MacPherson.«
Einfach rührend und englisch sportlich ist die Fürsorge, mit der man uns umgibt. Das stellen wir fest, als wir wohlig in der Badewanne sitzen und den Wüstenstaub vom Körper spülen. Mit kristallklarem Wasser tun wir das, aus beträchtlicher Tiefe holen es Pumpen herauf. Man darf sich überhaupt unter diesen Stationen der Ölleitung nicht etwa ein einsames Häuschen in der Wüste vorstellen. Es sind fünf Wüstenstädte, die wie ein Ei dem anderen gleichen. Um die Maschinenhäuser, Kraftanlagen und Pumpen gruppieren sich die Reparaturwerkstätten, die Garagen für Transport-, Personen- und Panzerautos, die Hangars, die Funk- und Telegraphenstationen und die Zelte der eingeborenen Arbeiter. Eine einigermaßen grün aussehende Gartenfläche mit ein paar kümmerlichen Bäumchen ist auch vorhanden. Sie trennt die technischen Anlagen der Stationen von den Bungalows der Ingenieure, dem gemeinsamen Speise- und Aufenthaltsbungalow und dem Gästehaus. Die Bungalows sind flach geduckt in die Breite gebaut, um den Wüstenstürmen möglichst wenig Angriffsflächen zu bieten. Doppelfenster sind in Stahlrahmen verpasst und sorgfältig mit Filzleisten gedichtet. Ein engmaschiges Drahtnetz soll vor Moskitos schützen. Wie diese den Weg in die einsame Station gefunden haben, erscheint rätselhaft. Mit Karawanen und an windgeschützten Stellen der Autos machen sie offenbar als blinde Passagiere die Reise durch die Wüste. Nachts hat man die Wahl, entweder unter dem kreisenden Ventilator zu schlafen und sich dabei ein Rheuma zu holen oder aber sich zerstechen zu lassen. Die Wahl zwischen beiden Übeln schafft wenigstens Abwechslung.
Bald hätte ich über Kleinigkeiten die Hauptsache der Pumpstation vergessen, das Fort! Es liegt inmitten der Wüstenstadt und sein massiger Turm ist das einzige mehrstöckige Gebäude. Man staunt über die starke Befestigung der Anlage und Mr. Meadows scheint mich für einigermaßen naiv zu halten, als ich fragte, ob eine solche Festung überhaupt notwendig sei.
»Es sind häufig Überfälle vorgekommen auf die Ölleitung«, werde ich aufgeklärt. »Bei Unruhen kann sich die ganze europäische und eingeborene Besatzung der Station in das Fort zurückziehen, wo Wasser und Lebensmittel für drei Monate aufgespeichert sind.«
So gemütlich, wie Mr. MacPherson in seinem sicheren Büro in Jerusalem die Wüste geschildert hat, scheint sie also doch nicht zu sein.
Ibn Saud, der Beherrscher fast ganz Arabiens, wird immer anspruchsvoller. Man erzählt uns, dass erst kürzlich zwei englische Flugzeuge durch einen Sturm in sein Gebiet abgetrieben wurden. Sie wurden abgeschossen und Ibn Saud sandte die beiden Leichen dem High Commissioner von Palästina.
Die Weltmacht I.P.C. aber lässt sich nicht abschrecken. Ihre Zehn-Millionen-Pfund-Ölleitung schützt sie mit allen Mitteln. Panzerwagen und mit Maschinengewehren bewaffnete Lastwagen versehen den Sicherheitsdienst. Von all dem ist freilich nichts zu merken, als wir abends mit den Ingenieuren beim Essen sitzen. Würde draußen nicht ein Sturm rasen und feiner Sand an den Fensterscheiben herunterrieseln, so könnte man glauben, sich im Speisesaal des »King David« in Jerusalem aufzuhalten. Genauso geborgen fühlt man sich. Die Aufmachung lässt noch viel weniger vermuten, dass wir uns mitten in der Wüste befinden. Lautlos serviert ein in tadelloses Weiß gekleideter Araberboy. Eine in der Druckerei der Station hergestellte Speisekarte verkündet Genüsse, die zum Teil per Flugzeug frisch herangeschafft worden waren.
Trotz solcher Genüsse und eines hohen Monatsgehaltes möchte ich doch kein Ingenieur der I.P.C. sein. Die Langeweile frisst die Seele bei lebendigem Leibe auf. Drei Jahre in der Wüste sind keine Kleinigkeit. In der nächsten Station ist alles so wie in H.5. Das Bad ist gleich erfrischend, das Essen gleich gut, der Boy gleich sauber, die Ingenieure gleich freudlos. So ist es auch im H.3; Zimmer Nummer 2 und 3, das Bad gleich erfrischend und so weiter. Er ist schon fast langweilig, dieser Komfort der Wüste. So undankbar ist der Mensch.
Mr. Taylor, der Manager der Pumpstation H.2, überreichte uns eine gedruckte Einladung zu seiner Wüsten-Party: »Es sind die geselligen Zusammenkünfte, die alle zwei Monate abwechselnd in einer der fünf Pumpstationen stattfinden; sie sind die einzige Erholung von dem nerventötenden Dienst auf den weltvergessenen Stationen.«
»Siehst du, wie gut, dass wir unseren Smoking mithaben«, sagte Helmuth. Es war rührend, wie er mich tröstete über den unsinnigen Haufen Gepäck, der wie ein Alptraum auf meinem Gewissen lag.
Das Wüstenfest überstieg die kühnsten Erwartungen. Von den anderen Pumpstationen kamen die Ingenieure viele hunderte Kilometer mit geländegängigen Autos angefahren und noch am späten Abend landete ein Flugzeug, das den Generaldirektor und sechs Damen aus Haifa brachte.
Wir kamen aus dem Staunen nicht heraus. Die Damen waren in Abendkleidern und festlich gekleidete arabische Diener servierten ein erlesenes Essen. Auch an Getränken wurde nicht gespart. Wäre nicht das Surren der Ventilatoren gewesen und die engen Fliegengitter vor den Fenstern, man hätte völlig vergessen, mitten in der Wüste zu sein. Dann wurde getanzt. Es waren allerdings vierzehn Herren, die sechs Damen gegenüberstanden. In später Stunde holten wir unsere Platten und die Wiener Walzer fanden großen Beifall.
»Siehst du…«, sagte Helmuth.
»Ja, ich weiß schon«, unterbrach ich ihn. »Es ist nett von dir, dass du mich immer trösten willst; trotzdem, es bleibt dabei.«
Zum Abschied übergaben wir Mr. Taylor all unsere Walzerplatten als kleinen Dank für die große Gastfreundschaft.
Wieder ein paar Kilo weniger. Das Koffergrammophon getrauten wir uns nicht zu verschenken, weil die Ingenieure alle so schöne elektrische Plattenspieler hatten. Aber in Bagdad wollten wir uns des Grammophons entledigen. Auch die Smokings, die wir in der Wüste einmal in Ehren getragen hatten, mussten nun über Bord. Klugerweise hatten wir beim Fest auf H.2 Photos machen lassen. Wir, smokingbekleidet, mit den smokingbekleideten Ingenieuren in Arabien. Bei nächster Gelegenheit konnten wir sagen: »Bitte sehr: Wir hatten Smoking mit, hier ist der bildliche Beweis, aber leider sind diese (für englische Begriffe) unentbehrlichen Kleidungsstücke den Strapazen der Expedition zum Opfer gefallen.« Mit diesen Photos hofften wir, auch ohne Smoking in der englischen Kolonialwelt salonfähig zu bleiben. In der Brieftasche wohlverwahrt und doch stets griffbereit trugen wir unsere Smoking-Photos stets bei uns. Lächerlich mag dies erscheinen, aber es ist englisch.
In der letzten Station H. 1, in El Hadithe am Euphrat, trennten wir uns von der Ölleitung und all ihrem Komfort.
Mit einer gewissen Wehmut nahmen wir das letzte englische Frühstück ein und waren dann wieder allein. So sicher und bequem war diese Wüstendurchquerung, dass ich mich ihrer fast schäme.