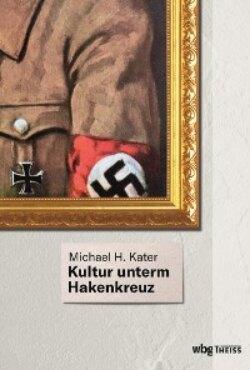Читать книгу Kultur unterm Hakenkreuz - Michael Kater - Страница 12
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Der Expressionismusstreit
Оглавление1912, im Alter von 26 Jahren, nahm Gottfried Benn, Sohn eines ostelbischen Geistlichen, seinen Abschied vom Militär. Der junge Arzt trat in Berlin eine Stelle als Pathologe an und veröffentlichte noch im selben Jahr sein erstes Buch, einen schmalen Gedichtband mit dem Titel Morgue – Eindrücke, die er bei seinen Autopsien gewonnen hatte. Der Umschlag zeigt ein Geige spielendes Skelett bei einem nackten Mädchen, das sich zurücklehnt. Das vierte Gedicht (mit dem Titel Negerbraut) beginnt: »Dann lag, auf Kissen dunklen Bluts gebettet/der blonde Nacken einer weißen Frau./Die Sonne wütete in ihrem Haar/und leckte ihr die hellen Schenkel lang/…/Ein Nigger neben ihr: durch Pferdehufschlag/Augen und Stirn zerfetzt. Der bohrte/zwei Zehen seines schmutzigen linken Fußes/ins Innere ihres kleinen weißen Ohrs./…«106 Das Buch mit dem Anspruch, »die Banalität der menschlichen Existenz und ihres körperlichen Verfalls« zu untersuchen, ging mit seiner neuartigen, direkten Sprache gleich in den Kanon des literarischen Expressionismus ein. Der folgende Band, Söhne, war der jüdischen Dichterin Else Lasker-Schüler gewidmet, mit der Benn ein Liebesverhältnis hatte.
Im Ersten Weltkrieg trat Benn erneut in den Militärdienst ein und wurde in Brüssel als Feldarzt eingesetzt. Zu der Zeit entstanden seine sogenannten Rönne-Novellen, dessen sexbesessener Protagonist Rönne auf Benn selbst verweist. 1917 zurück in Berlin, ließ er sich als Hautarzt nieder. Er veröffentlichte die Prosasammlung Gehirne und den Gedichtband Fleisch. Beide spiegeln mit ihrer nihilistischen Menschheitsverachtung Benns Reaktion auf die Grausamkeiten des Krieges wider, darin den Bildern von Grosz und Dix ähnlich, die sich ebenfalls als zynische Antwort auf das Kriegsgeschehen und die Auswüchse nach dem Waffenstillstand vom November 1918 auffassen lassen. Für das weltliche Oratorium Das Unaufhörliche zu der Musik von Hindemith – einem Vertreter der Neuen Sachlichkeit – verfasste Benn den Text. Das 1931 uraufgeführte Werk galt allgemein als definitiv nihilistisch. 1932 wurde Benn in die Preußische Akademie der Künste aufgenommen und blieb, im Gegensatz zu Ricarda Huch und anderen, auch nach der Machtergreifung Mitglied. Im Februar 1933 übernahm er sogar kommissarisch den Vorsitz der Sektion der Dichtung.107
Die Weimarer Republik, erklärte Benn im Frühjahr 1933 im Rundfunk, habe ihn enttäuscht, weil die Demokratie entartet sei und eine korrupte liberale Intelligenzia mehr Interesse an Grundstücken in Ascona gezeigt habe als daran, den heimischen Boden mit der eigenen Hände Arbeit zu bestellen. Im Gegensatz dazu sei die Jugend, die jetzt das neue Reich unterstütze, lebenskräftig, Vorläuferin einer neuen biologischen Rasse, einer »Herrenrasse«, die bereits Nietzsche vorhergesagt habe. Diese Jugend ziehe der Intellektualität der Stadt die organische Ordnung des Landes vor. Sie sei Beschützerin der weißen Rasse und verteidige ihre Werte gegen niedere Arten wie jene schwarzen Kolonialtruppen, die sich im Dienst der französischen Besatzungsarmee in Deutschland herumgetrieben hätten. Die neue Form der Herrschaft finde schon jetzt die Unterstützung der unteren Klassen und mache damit die Kommunisten und Sozialisten alten Schlages überflüssig. Hitlers populistische, direkte Demokratie verdiene daher, wie der neue Staat, den er aufbaue, Beistand.108
Im November veröffentlichte Benn allerdings unter dem Titel »Bekenntnis zum Expressionismus« einen Artikel, in dem er die kritische Haltung des NS-Regimes gegenüber dieser Kunstform bedauerte und betonte, er selbst halte weiterhin daran fest. Der Expressionismus sei eine europäische Bewegung hauptsächlich der Jahre 1910 bis 1925 gewesen, der Spanier wie Pablo Picasso ebenso angehört hätten wie der Franzose Georges Braque, der Rumäne Constantin Brancusi und der Russe Wassily Kandinsky. In Deutschland sei Hindemith ihr Vertreter, in Italien seien es Gian Francesco Malipiero und Filippo Tommaso Marinetti, der Begründer des Futurismus, den Mussolini als Element des Faschismus akzeptiert habe. In der etwas ferneren Vergangenheit hätten Nietzsche, Hölderlin und Goethe zu den Vorläufern gehört und, nicht zuletzt, Richard Wagner. Der Expressionismus sei deshalb politisch von Bedeutung für das nationalsozialistische Zeitalter, weil ihm eine »anti-liberale Funktion des Geistes« eigen sei; eine »Verhöhnung des Volkes«, fügte Benn eilends hinzu, sei diese Kunstform keineswegs. Nach dem Ersten Weltkrieg habe ein »Destruktionismus« Fuß gefasst, dem der Expressionismus mit einem »jedes Chaos ausschließenden formalen Absolutismus« entgegentreten sei.109
Benn bekannte sich also zum Faschismus und verteidigte zugleich eine Kunstrichtung, von der er wusste, dass die meisten NS-Größen sie ablehnten. Auf diese Weise versuchte er sich an der Quadratur des Kreises – was für ihn nicht gut ausgehen sollte. Sein furchtloser Hinweis auf die europäische Universalität des Expressionismus sowie die Erwähnung von Nicht-»Ariern« wie Sigmund Freud und Marcel Proust als dessen Verfechtern rief feindselige Reaktionen hervor. Man beschuldigte ihn, Jude zu sein – was er öffentlich dementierte. Ferner sang er in weiteren Artikeln das Loblied des neuen Regimes und scheute dabei auch vor rassistisch-eugenischen Begrifflichkeiten nicht zurück, deren Verwendung er als Arzt für legitim hielt. Aber als 1936 eine bis 1911 zurückreichende Sammlung seiner früheren Gedichte erschien, fuhr die SS-Zeitung Das Schwarze Korps schwere Geschütze gegen Benn auf und warf seinen Gedichten Obszönität vor. Benn, nunmehr Persona non grata, zog sich erneut in die Armee zurück und arbeitete wieder als Stabsarzt. Im März 1938 wurde er aus der Reichsschrifttumskammer ausgeschlossen.110 So hatte der Versuch eines Nationalsozialisten, den Expressionismus für das NS-Regime zu verwerten, ein unrühmliches Ende gefunden.111 Aber es war nicht der einzige Versuch dieser Art.
Unter den Künstlern der expressionistischen Avantgarde nach dem Ersten Weltkrieg ragten neben Benn der Bildhauer Ernst Barlach und der Maler Emil Nolde hervor. Wie Benn galten sie den Nationalsozialisten als beispielhaft für die Moderne in der Kunst und damit als mögliche Zielscheibe der Verfolgung. Aber in ihren Haltungen und Lebenswegen unterschieden sie sich voneinander und von Benn; dasselbe gilt für ihr jeweiliges Schicksal.
Barlach war 1870 als Sohn eines Landarztes in einer kleinen Stadt in Holstein geboren worden. Er studierte in Hamburg und Dresden, seit Mitte der 1890er Jahre in Paris. Auf einer Reise durch das zaristische Russland entwickelte er 1906 ein Talent für die Wahrnehmung menschlicher Ausdrucksformen, das zu seinem Markenzeichen werden sollte. Im Jahr darauf schloss er sich wie viele andere bildende Künstler in Deutschland der Berliner Secession an. Er heiratete nie, wurde aber 1906 Vater eines Sohnes. Die Mutter, Näherin, galt als eine Frau weit unter seinem Stand. 1907 wurde er literarisch tätig, zumeist mit Bühnenwerken. 1910 zog er in die mecklenburgische Kleinstadt Güstrow. Hier entwickelte er den Stil, mit dem er sich als expressionistischer Maler und Bildhauer einen Namen machen sollte: Er nahm den menschlichen Torso gegenüber Händen und Gesicht zurück, womit er die innere Verfassung der Figur zeigen wollte. An den Barlach’schen Figuren wirkten Hände und Gesicht stets übertrieben. Nach einem kurzen Kriegsdienst in Sonderburg nahe der dänischen Grenze wandte er sich erneut biblischen Motiven zu, an denen er bereits gearbeitet hatte. 1919 wurde er Mitglied der Preußischen Akademie der Künste, der bekannte (jüdische) Kunsthändler und Galerist Paul Cassirer kümmerte sich als sein Hauptagent um den Verkauf seiner graphischen Arbeiten und Dramen. 1924 erhielt Barlach den Kleist-Preis für Literatur, seit 1926 wurde er mit der Gestaltung von Gedenkmonumenten für die Kriegsopfer betraut. Bis 1933 schuf er bedeutende bildhauerische Werke, darunter das schon bald berühmte Ehrenmal im Magdeburger Dom, und 1928 Skulpturen in Kiel, die schon damals von fanatischen Nationalisten angegriffen wurden.112
Nach der Machtergreifung geriet Barlach durch Rosenberg-Anhänger unter Beschuss: Seine Skulpturen verströmten grüblerischen Individualismus, so der Vorwurf, wohingegen die deutschen Männer und Frauen im Dienst für »Führer« und Vaterland aufgingen.113 Als der Kunsthändler Alfred Flechtheim seine Düsseldorfer Galerie im März an die Nationalsozialisten abtreten musste, verlor Barlach auch noch seinen derzeitigen Agenten. Er verkaufte weniger, Verträge wurden nicht eingehalten und man schuldete ihm Geld. Schon bald war er in finanziellen Schwierigkeiten, geriet mit Steuer- und Hypothekenzahlungen in Rückstand. Wie Benn wurde er bezichtigt, Jude zu sein, sah sich aber, anders als der Dichter, außerstande, öffentlich dagegen vorzugehen. Er wusste, dass unorthodoxe radikale Studenten vom NS-Studentenbund (NSDStB) sich für ihn aussprachen, maß dem aber realistischerweise keine Bedeutung bei.114
Im Februar 1934 griff Heinrich Hildebrandt, der Gauleiter von Mecklenburg, Barlach in einer Rede heftig an. Der Mann sei zwar vielleicht ein Künstler, aber dem deutschen Wesen fremd. »Der Künstlerstand hat die Pflicht, den deutschen Menschen zu verstehen in seiner einfachen Echtheit, so, wie er von Gott geschaffen ist … Der deutsche Mensch kennt nicht den Bauern als einen faul auf die Erde gestreckten Menschen, sondern als den harten, selbstbewussten Mann, der gewillt ist, alle Schwierigkeiten zu überwinden, der mit brutaler Faust, mit dem Schwert in der Hand sich den Weg bahnt.«115 Nur noch wenige Nationalsozialisten waren bereit, ihn zu unterstützen, und Rosenberg krakeelte lautstark wie eh und je gegen ihn. Mit Barlachs Gesundheit ging es bergab.116 In der Hoffnung auf Nachsicht seitens der Herrschenden unterschrieb er zusammen mit weiteren Künstlern und Intellektuellen im Sommer einen »Aufruf der Kulturschaffenden«, Hitler die Loyalität zu bekunden. Halbherzig schrieb er im September an einen Freund, er rate allen jungen Menschen, sich der NSDAP anzuschließen, weil dafür nur »das beste Blut, die besten Charaktereigenschaften gut genug« seien.117 Im März 1935 war er auch als Dramatiker nicht mehr gefragt.118
1936 stellte sich Goebbels – einst ein Bewunderer – offen gegen Barlach, nachdem Rosenberg, wie es schien, den Expressionismusstreit in ideologischer Hinsicht für sich entschieden hatte. Als die bayerische Polizei im März ein Buch mit Zeichnungen des Künstlers verbot und 3149 bereits gedruckte Exemplare im Lager von Barlachs Verleger Reinhard Piper in München beschlagnahmte, schrieb Barlach an Goebbels und bat ihn zu intervenieren: »Der künstlerische Wert oder Unwert meiner Arbeiten steht außerhalb der von der politischen Polizei zu treffenden Entscheidungen.« Goebbels tat nichts, sondern vermerkte, höchstwahrscheinlich in einem Akt des Selbstbetrugs, in seinem Tagebuch: »Das ist keine Kunst mehr. Das ist Destruktion, ungekonnte Mache. Scheußlich! Dieses Gift darf nicht ins Volk hinein.«119
In den folgenden Monaten wurden Werke Barlachs aus laufenden Ausstellungen entfernt, er selbst schuf weniger, verkaufte weniger und versank in der Güstrower Einsamkeit. Als Freunde waren ihm nur noch seine Lebensgefährtin Marga Böhmer und gelegentlich deren Ex-Gatte, der Kunsthändler Bernhard Böhmer, geblieben. Der stand zwar dem Nationalsozialismus nahe, tat aber sein Bestes, um Barlach im Umgang mit der Obrigkeit beizustehen. Obwohl die Nationalsozialisten gegen seine Kunstwerke vorgingen und er an Ausstellungen nicht mehr teilnehmen durfte, wurde ihm doch nie, wovor er sich fürchtete, seine Berufstätigkeit als Künstler untersagt. Aber er verbitterte und wollte auch keine Besucher mehr empfangen. Dann wurde das bedeutende Ehrenmal aus dem Magdeburger Dom entfernt, der Auftakt zu einer Reihe weiterer derartiger Aktionen – allein im Jahr 1937 wurden 317 seiner Skulpturen beschlagnahmt. Darüber hinaus sollte die deutsche Öffentlichkeit anlässlich der Ausstellung »Entartete Kunst« die Ablehnung seiner Werke bekunden. Einsam und verlassen, starb Ernst Barlach am 24. Oktober 1938 im Alter von 68 Jahren.120
Ähnlich wie Barlach wurde Emil Nolde nach 1945 zum Opfer nationalsozialistischer Kulturpolitik erklärt. Aber Barlach hatte der Politik – ob in Kaiserreich, Weimarer Republik oder Drittem Reich – immer gleichgültig gegenübergestanden, während Nolde sich wie Benn schon früh als Nazi verstand, auch wenn es später Schwierigkeiten gab. Es war daher unangemessen, ihn als den unerschrockenen Widerstandskämpfer Max Ludwig Nansen aus Rugbüll darzustellen, wie es Siegfried Lenz in seinem 1968 erschienenen Roman Deutschstunde tat. (Auch andere Autoren vertraten die Legende vom verfolgten Künstler.) Nicht zuletzt Noldes autobiographische Schriften haben solchen Entstellungen den Weg geebnet.121
Nolde bewegte sich im Dritten Reich zwischen Beifallsbekundungen und Niederlagen, wobei Letztere langsam, aber sicher die Oberhand gewannen. Geboren wurde der Maler 1867 als Hans Emil Hansen im schleswigschen Dorf Nolde; die Eltern waren Bauern. Als Kind eines Deutschen und einer Dänin gehörte er zur dänischen Minderheit, die für die Zugehörigkeit zum Deutschen Reich eintrat. Nolde wurde zunächst Schnitzer und Zeichner. 1892 begann er in der Schweiz mit der Darstellung von Bergmotiven in Aquarelltechnik. 1899 wies Franz von Stuck seine Bewerbung für die Münchener Kunstakademie ab (acht Jahre später sollte Adolf Hitler von der Wiener Akademie eine Abfuhr erhalten). Nun ging Nolde nach Paris, um an der privaten Académie Julian in Paris zu studieren, die den traditionellen Stil lehrte und den Impressionismus ablehnte. 1901 wurde er Mitglied der Berliner Secession und gewann damit Anschluss an die Moderne. Zwei Jahre später war sein Malstil durch leuchtende Farben und große Intensität geprägt. Bei einer Ausstellung in Dresden lernte Emil Nolde (wie er sich jetzt nannte) 1906 Künstler der Vereinigung Die Brücke kennen, was seinen Stil noch einmal grundlegend veränderte: hin zum Expressiven, zu einfachen Umrissen und einer Betonung der Form. 1911 lehnte die Secession Noldes Bilder ab, die mittlerweile vielfach biblische Motive zeigten. Das führte zu einer Auseinandersetzung mit Max Liebermann, Deutschlands führendem Impressionisten, und zu Noldes Ausschluss aus der Secession. Der Streit mit Liebermann, der damals die Secession leitete, wie auch mit dem Kunsthändler Paul Cassirer – beides Juden – war sehr wahrscheinlich der Grund für Noldes folgenden Judenhass sowie für seine endgültige Ablehnung des Impressionismus, den er als französisch und entartet bezeichnete. Womöglich aus dieser Gefühlslage heraus wurde Nolde schon 1920 Sympathisant und bald Mitglied der antisemitischen und fremdenfeindlichen NSDAP. 1926 zog er ins nordfriesische Seebüll, 1931 wurde er Mitglied der Preußischen Akademie der Künste. Die Machtergreifung begrüßte er mit Begeisterung.122
Zu Beginn der NS-Herrschaft wollte Goebbels Nolde als Vertreter einer Kunstrichtung, in der viele einen »Nordischen Expressionismus« erblickten, zum Direktor einer Berliner Kunstakademie machen. Aber Hitler hatte in Goebbels’ Räumlichkeiten ein Gemälde von Nolde entdeckt und ihm befohlen, es zu entfernen. Hitlers künstlerische Auffassung war rein traditionalistisch; er hasste Nolde wegen der Konzentration auf neutestamentliche Themen und der Verzerrungen von Form und Farbe in seinem Werk.123 Nolde aber sprach sich bei jeder Gelegenheit, bei der er im Propagandaministerium zu der neuen Position befragt wurde, für eine Neuordnung der deutschen Kunstwelt aus und denunzierte seinen Konkurrenten um die Stelle, den einstigen Mitstreiter von der Brücke Max Pechstein, als »Juden« – eine falsche Anschuldigung.124 In den folgenden Monaten und Jahren kämpfte Nolde, sehr wahrscheinlich in Kenntnis von Hitlers Ablehnung und Goebbels’ Schwanken, hart für seine Anerkennung in der NS-Bewegung. Von früher her gab es immer noch Menschen, die ihn unterstützten, so etwa Erna Hanfstaengl aus der einflussreichen Kunstverlegerfamilie, die Hitler gleich nach dem fehlgeschlagenen Putschversuch von 1923 geschützt hatte. In ihrer privaten Galerie am Münchner Karlsplatz stellte Erna Hanfstaengl diverse Gemälde von Nolde aus, denn theoretisch kämen dort alle wichtigen Nazis einmal vorbei. Sie platzierte auch einige Aquarelle in der Münchner Wohnung ihres Bruders Ernst (»Putzi«) Hanfstaengl, damit dessen Freund Hitler sie dort sah.125 Im November 1933 bat Erna ihre enge Freundin Marga Himmler, sich bei ihrem Mann Heinrich dafür einzusetzen, dass Nolde zu einem Bankett zum Gedenken an den Putsch von 1923 eingeladen wurde. Bei der Feier saß Nolde neben dem SA-Führer Ernst Röhm, einem Schrank von Mann. Kurz danach äußerte er sich in seinem Tagebuch lobend über Hitler. Der Führer verfolge, meinte er, große und edle Absichten, sei aber von dunklen Gestalten in einem künstlich geschaffenen kulturellen Nebel umgeben. Der könne sich aber in naher Zukunft lichten und der Sonne weichen.126
Mag Nolde in diesem Zusammenhang auch an sich gedacht haben, so wurde er enttäuscht. Selbst wenn er, wie Barlach, noch Bewunderer unter den Nationalsozialisten besaß und, wie dieser, 1934 den »Aufruf der Kulturschaffenden« unterschrieben hatte, gab es von Rosenberg beeinflusste und Hitler ergebene Kräfte, die sich zunehmend gegen ihn wandten.127 In Theodor Fritschs einflussreichem Handbuch der Judenfrage wurde Nolde 1935 mit jüdischen Malern in einem Atemzug genannt: Er sei genau so schuldig wie sie an der Verbreitung des Expressionismus und habe die Grenzen der Ästhetik sogar noch weiter ausgelotet als sie.128 Rosenbergs Gefolgsmann, der Maler und Kritiker Wolfgang Willrich, schrieb 1937, dass Nolde zwar politisch akzeptabel sein mochte, doch »sein Schaffen und seine Phantasie ist [sic] krank«; damit liege er ganz auf der Linie des Kunstbolschewismus.129 Zu eben dieser Zeit wurde Nolde aufgefordert, die Preußische Akademie der Künste zu verlassen. Nur nach heftigem Protest, bei dem er voller Stolz auf seine Parteimitgliedschaft verwies, konnte er seine Mitgliedschaft vorerst behalten. Doch bis zum Juli, als die Ausstellung »Entartete Kunst« eröffnet wurde, waren 1052 Werke Noldes aus der Öffentlichkeit entfernt worden, mehr als von jedem anderen Künstler.130
Obwohl Nolde im Laufe der Zeit einige der beschlagnahmten Bilder zurückerhielt, besserte sich seine Lage insgesamt nicht. Im August 1941 wurde er aus der Reichskunstkammer ausgeschlossen und drei Monate später offiziell mit dem Verbot belegt, Bilder zu malen und die Gemälde zu verkaufen.131 Zwar hat Nolde diese Ungerechtigkeit nach dem Krieg dramatisiert, doch durfte er privatim durchaus weiter malen, nur eben nicht verkaufen. Nachdem ein Treffen mit Gauleiter Baldur von Schirach in Wien, das der Filmstar Mathias Wieman, ein Nolde-Bewunderer, 1942 arrangiert hatte, ergebnislos geblieben war, malte Nolde für sich in der Einsamkeit seines norddeutschen Dorfes. Noch 1944 schrieb seine dänische Frau Ada Briefe an hochgestellte Persönlichkeiten in Partei und Regierung, wobei sie Noldes Patriotismus und seine Parteimitgliedschaft hervorhob.
Zu Beginn der nationalsozialistischen Herrschaft hatte sich Nolde, wie Benn, im Lager einer ganzen Reihe von Nationalsozialisten gesehen, die den Expressionismus für eine perfekte Verkörperung des neuen, faschistischen Geistes hielten. Zu dieser Gruppe gehörten Studenten, Künstler, Intellektuelle, auch Politiker wie beispielsweise Goebbels, der in seiner Jugend als Mann von Geist und Geschmack an der Moderne durchaus Gefallen gefunden hatte. Zwar begegnete er führenden Expressionisten wie Georg Kaiser mit Ablehnung, doch enthielt sein eigenes Stück Der Wanderer (1927), das frohlockend mit der Vorhersage eines »Neuen Reiches« endete, expressionistische Elemente, wie Kritiker damals anmerkten. Helmut Heiber, Goebbels’ erster seriöser Biograph, entdeckte in Michael, dem zwischen 1923 und 1929 geschriebenen Roman des jungen Mannes, »expressionistische Liebeslyrik«. Zwar war Goebbels’ Geschmack in Sachen Musik, wie aus seinen Tagebüchern hervorgeht, eher traditionell; er schätzte die Werke von Beethoven, Richard Strauss und, wenn auch weniger, Richard Wagner – aber in den bildenden Künsten bewunderte er die Arbeiten von Barlach und Nolde.132
Das einstweilige Fortbestehen des Expressionismus im Dritten Reich kann auf dreierlei Weise erklärt werden: erstens als Reaktion auf präexistente Kunstformen, zweitens waren die Nazis unfähig, auf die Schnelle selbst etwas ideologisch Angemessenes zu produzieren, und drittens stand die Kunst auch in der letzten, umkämpften Phase der Weimarer Republik der Politik indifferent gegenüber. Soll heißen: Die Kunstschaffenden der Moderne waren in der Weimarer Zeit zwar vielfach, aber nicht notwendigerweise links; sie konnten auch neutral sein (wie Barlach) oder konservativ bis rechtsextrem (wie Benn und Nolde).133
Entschieden wurde das Schicksal des Expressionismus vor dem Hintergrund des institutionellen Gerangels zwischen Rosenberg und Goebbels. Am 29. Juni 1933 organisierten NS-Studentenführer an der Berliner Universität – nur Wochen nach der Bücherverbrennung – eine öffentliche Veranstaltung unter dem Motto »Jugend kämpft für deutsche Kunst«. Höchstwahrscheinlich hatten sie sich von einem seinem Inhalt nach intellektuellen Artikel inspirieren lassen, der Mitte März in der Berliner Deutschen Allgemeinen Zeitung (DAZ) erschienen war und gegen Rosenberg polemisierte. Der Verfasser hieß Bruno E. Werner, war 36 Jahre alt und Doktor der Philosophie aus Leipzig. Er stand zwar politisch rechts, war aber ein früher Bewunderer der Bauhaus-Bewegung. Werner sah in der »neuen Kunst« die Vorreiterin der nationalen Revolution, habe sie doch schon vor 25 Jahren gegen das liberale 19. Jahrhundert und das französische Modell des Expressionismus gekämpft. Zu jener Zeit hätten Maler der Brücke und des Blauen Reiters – vor allem Nolde, Barlach, Pechstein, Franz Marc, Paul Klee und Lyonel Feininger – zur Avantgarde gehört.134 Rosenberg konterte mit einem Artikel im Völkischen Beobachter: Zwar hätten Barlach und Nolde Talent, doch sei insbesondere Noldes Werk »negroid, pietätlos, roh und bar jeder echten innern Formkunst« und manches von Barlach »halbidiotisch«.135 Am 29. Juni schlugen sich die (im NSDStB organisierten) Studenten im Bündnis mit Goebbels’ Ministerium gleichwohl auf Werners Seite und brachten eigene Argumente vor – gegen Rosenberg und für Expressionisten wie Nolde und Barlach.136 »Sie glaubten«, so fasst Peter Paret ihre Ansichten treffend zusammen, »an die mythische Kraft des deutschen Blutes, an die Wesensbindung zwischen dem deutschen Volk und dem deutschen Künstler, der der Rasse diene, dessen Arbeit vielleicht nicht notwendigerweise formal oder thematisch, aber im Geiste jene nordischen, arischen Werte verkörpere, die Deutschland in Jahrhunderten voller Täuschungen und Betrügereien aufrechterhalten hätten und denen nun durch Hitler politische Macht und neues Leben eingeflößt werde.« Antisemitisch müsse man sein, meinten die Studenten, denn Juden hätten den Impressionismus nach Deutschland gebracht, und der Expressionismus sei ein Gegengift.137
Im Herbst eskalierte der Streit. Hans Weidemann, der Leiter der Berliner Studentengruppe und selbst Maler, gründete eine neue Zeitschrift mit dem Titel Kunst der Nation. Ziel war die Förderung eines »Nordischen Expressionismus«, weshalb Werke von Nolde, Barlach, Käthe Kollwitz und anderen abgebildet wurden. Derart ermutigt, zeigte Museumsdirektor Alois Schardt im Oktober auf der Galerie des Berliner Kronprinzenpalais eine Ausstellung mit expressionistischen Gemälden, die im Einführungsvortrag sogar zur deutschen Kunst des Bronzezeitalters in Beziehung gesetzt wurden. Im Monat darauf erschien Benns Aufsatz »Bekenntnis zum Expressionismus«. Auf dem Reichsparteitag im September hatte Hitler die moderne Kunst allerdings insgesamt als »kubistisch-dadaistischen Primitivitätskult« abgestempelt. Es dauerte nur einige Wochen, da verlor Schardt seinen Posten und floh schließlich in die USA. Die Zukunft der neuen Zeitschrift stand in den Sternen.138
1934 beschleunigte sich der Niedergang des studentischen Engagements für den Expressionismus. Anfang des Jahres erschien ein Buch des NS-nahen Kunsthistorikers Kurt Karl Eberlein. Unter dem Titel Was ist deutsch in der deutschen Kunst? vertrat Eberlein die Ansicht, die gerade stattfindende Schlacht werde »gegen das Undeutsche, Fremde, Blutferne, gegen das Romanische, Französische, Slawisch-russische, gegen alles Anationale, Antinationale, Internationale in der deutschen Kunst« ausgetragen. Er frage sich, ob es »sehr leicht« sei, »zu behaupten, dass doch das Deutsche in diesen ›Expressionisten‹-Bildern auch erkennbar sei«. Ihm wurde zwar widersprochen, allerdings recht kleinlaut. Wilhelm Pinder, Nationalsozialist, aber eine international anerkannte Autorität, hielt Eberleins Aussagen für »ein Vernichtungsurteil über die Expressionisten«, erläuterte das allerdings nicht näher.139 Auch andere gemäßigt fortschrittliche Kunsthistoriker wie Winfried Wendland und Hans Weigert versuchten sich in der Verteidigung der umstrittenen Kunstform. Weigert meinte, »das Erbe des besten Expressionismus« sei bewahrenswert, doch waren die Versuche mutlos, und die Autoren schrieben im Schatten von Rosenberg.140
Dessen Position hatte Hitler persönlich am 24. Januar 1934 aufgewertet, als er den Chefideologen der Partei zum Beauftragten für die Überwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung der NSDAP machte.141 Obwohl dies nur ein Partei-, kein Regierungsamt war, konnte Rosenberg sich umfassende Vorrechte sichern und so in alle Winkel des öffentlichen Lebens eingreifen. Soweit es die Kultur betraf, gelang es ihm sogar, eine Art Gleichgewicht mit den Amtsbefugnissen von Goebbels und Göring herzustellen. Nun schlug er zu und warf den Studenten vor, von jüdischen Kunsthändlern dazu verführt worden zu sein, »eine Linie von Grünewald über Caspar David Friedrich zu – Nolde und Genossen« zu ziehen, womit sie das Ziel verfolgten, das »Untermenschentum« der Expressionisten hoffähig zu machen.142 Auch der sogenannte Röhm-Putsch Ende Juni kam Rosenberg zugute, da Hitler im September erneut seine Entschlossenheit bekundete, die Kunst von »diesen Scharlatanen« zu säubern.143
1935 musste Kunst der Nation das Erscheinen einstellen. Weidemanns Mitstreiter Otto Andreas Schreiber und Fritz Hippler waren bereits aus dem NSDStB geworfen worden und suchten nun im sich stetig weiter verzweigenden Netzwerk der Goebbels’schen Operationen eine Stellung. Dessen vergleichsweise fortschrittlichen Bestrebungen wurde zwar sowohl von Hitlers ästhetischem Traditionalismus als auch von Rosenbergs Ehrgeiz Einhalt geboten. Aber Goebbels’ Machtbefugnisse erweiterten sich mit dem Ausbau der ihm unterstehenden Institutionen: des Propagandaministeriums und der (nominell zum Ministerium gehörenden) Reichskulturkammer mit ihren vielen Unterkammern. Damit konnte er Rosenbergs neue Dienststelle ausstechen; dessen Kampfbund jedenfalls verschwand in der Versenkung, und die Nachfolgeorganisation namens Nationalsozialistische Kulturgemeinde (NSKG) verlor ihre Macht, als sie in den Umkreis von Robert Leys Deutscher Arbeitsfront (DAF) geriet, der übergreifenden NS-Organisation, die nach der Machtergreifung die unabhängigen Gewerkschaften ersetzen sollte.144 Im Mai hielt Goebbels in Weimar eine Rede, in der er sich einerseits gegen ehrgeizige Reaktionäre wandte (und so indirekt die Avantgarde zu schützen schien), andererseits »kulturbolschewistische Versuche, die sich des Nationalsozialismus bedienen«, um öffentliche Anerkennung zu gewinnen, aufs Korn nahm (womit er den Traditionalisten entgegenkam).145
Es folgten weitere Polemiken, in denen die Antimodernisten die Zähne zeigten.146 Am 18. Juli 1937 schließlich führte Hitler selbst den entscheidenden Schlag, als er in einer Rede zur Eröffnung der Großen Deutschen Kunstausstellung der Avantgarde den Todesstoß versetzte: »Bis zum Machtantritt des Nationalsozialismus hat es in Deutschland eine sogenannte ›moderne‹ Kunst gegeben, d. h. also, wie es schon im Wesen dieses Wortes liegt, fast jedes Jahr eine andere. Das nationalsozialistische Deutschland aber will wieder eine ›deutsche Kunst‹, und diese soll und wird wie alle schöpferischen Werte eines Volkes eine ewige sein.«147
Die Protagonisten des Expressionismus kämpften um ihr künstlerisches oder gar physisches Überleben. Ihre angeblich subversive Kunst indes offenbarte sich hier und da bis 1937 und sogar darüber hinaus. Bereits 1933 hatte sich Schreiber, mit Goebbels’ Billigung, bei Robert Ley in Sicherheit gebracht. Der Führer der DAF war ideologisch weniger festgelegt als Goebbels oder Rosenberg. Er baute gerade seine Organisation Kraft durch Freude (KdF) auf, und dort richtete Schreiber eine Abteilung für Bildende Kunst ein. In den folgenden zehn Jahren sorgte sie dafür, dass die Arbeiten von Expressionisten wie Pechstein, Marc und Schmitt-Rottluff landesweit in Fabriken gezeigt wurden, bis die Niederlage von Stalingrad im Winter 1942/43 alles veränderte.148
Ebenfalls 1933 erblickten wenigstens zwei den Nationalsozialismus verherrlichende Kunstwerke das Licht der Öffentlichkeit, die den Stempel des Expressionismus trugen. Da war zum einen das Bühnenstück Schlageter von Hanns Johst, das am 20. April, Hitlers Geburtstag, in Berlin Premiere feierte. Johst war schon seit dem Ersten Weltkrieg als Expressionist hervorgetreten; er kannte und bewunderte Gottfried Benn. Den Text seines Dramas schrieb er gegen Ende der Weimarer Republik. Das Modernistische zeigte sich besonders am Ende des Stücks, als der nationalistische Märtyrer Albert Leo Schlageter, angeklagt und verurteilt wegen Sabotage, Aug in Aug mit dem französischen Hinrichtungskommando ausruft: »Ein letztes Wort! Ein Wunsch! Befehl! Deutschland!!! Erwache! Entflamme!! Entbrenne! Brenn ungeheuer!!«149
Zum anderen gab es den Film Hitlerjunge Quex, vielleicht der nationalsozialistischste Film überhaupt. Er feierte den Märtyrertod von Herbert Norkus, der im Januar 1932 von kommunistischen Jugendlichen umgebracht worden war. Ironischerweise zeigte er sich Filmen aus der Weimarer Zeit verpflichtet. Ein aufmerksamer Beobachter musste vor allem Anklänge an Kuhle Wampe (1932), Die Dreigroschenoper (1931) und Mutter Krausens Fahrt ins Glück (1929) bemerken.150 Alle spektakulären Stücke – insbesondere die vom NS geförderten Thingspiele –, die zwischen 1933 und 1936 ihre Blütezeit erlebten, wiesen Ähnlichkeiten mit expressionistischen Bühnenwerken und den Arbeiterdramen auf, ein Faktor, der später zu ihrem Niedergang beitrug.151
1937 sorgte Hitler höchstpersönlich für einen grundlegenden Wandel in der deutschen Kunstwelt. Aber das Gebäude, in dem er diesen Wandel verkündete, das neue, monumentale, neo-klassizistische Haus der Deutschen Kunst in München, hatte ein Flachdach und war von schlichter, funktionaler Bauweise, die Beobachter an das Bauhaus erinnerte. Die Historikerin Barbara Miller Lane bemerkt: »Das massiv Blockförmige und die glatten Oberflächen, die frei sind von allen Verzierungen mit Ausnahme minimaler Vorsprünge an Basis und Gesims sowie die horizontale Ausrichtung des Gebäudes künden von den Anleihen bei den Radikalen der zwanziger Jahre.« Und in der von Hitler nach der Rede eröffneten Großen Deutschen Kunstausstellung fanden sich objets d’art, die von eben jenem modernen Stil beeinflusst waren, den Hitler jetzt verächtlich machte.152 Ebenfalls 1937 führte der Regisseur Jürgen Fehling (nach NS-Terminologie ein »Vierteljude«) im Preußischen Staatstheater in Berlin Shakespeares Richard III. auf. Fehling, der Barlach bewunderte und selbst durch die Schule des Expressionismus gegangen war, wies Werner Krauß, der den Tyrannen spielte, an, sich dem Charakter Joseph Goebbels’ anzuverwandeln – düster, bedrohlich ruhig und mit Hinkefuß. Das Bühnenbild war karg und gleichfalls düster, mit kaum mehr ausgestattet als mit den an das Bauhaus erinnernden Sitzmöbeln aus Stahlrohr.153 Fehling wagte einen Drahtseilakt, blieb aber unbehelligt.