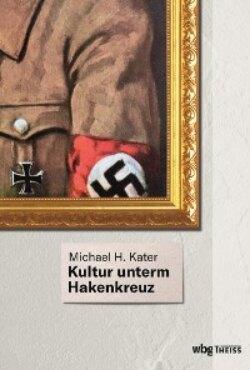Читать книгу Kultur unterm Hakenkreuz - Michael Kater - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Literatur
Оглавление2009 äußerte sich der amerikanische Kultur- und Literaturhistoriker Sander L. Gilman zur NS-Literatur dahingehend, dass »es einfach uninteressant sei, sich mit der massenhaften Literatur der NS-Zeit zu beschäftigen«.47 Schriftsteller wie Josef Magnus Wehner, Hans Zöberlein oder Kurt Eggers »repräsentieren nicht die ›wahre‹ Literatur im Deutschland der Jahre 1933 bis 1945«. Gilman begründete seine Ansicht nicht, dachte aber allem Anschein nach an gravierende Mängel in Form und Inhalt – an eine Literatur, die nicht der hauptsächlichen Tradition deutscher Belletristik im 19. und 20. Jahrhundert entsprach. Doch abgesehen davon war Literatur, was deutsche Schriftsteller an Prosa oder Poesie hervorbrachten; ob es gut oder schlecht war, steht auf einem anderen Blatt. Was damals von NS-Autoren oder von Schriftstellern, die ganz oder nur zeitweise im Dritten Reich lebten, zu Papier gebracht wurde, war genuin deutsche Literatur, gleichgültig, ob abgeleitet oder originell oder eine Mischung aus beidem.
Zugegebenermaßen gab es bis mindestens 1940 keine Literatur, die im zeitgenössischen, nationalsozialistischen Milieu spielte.48 Romanautoren fühlten sich den ständig im Fluss befindlichen Ereignissen zu nahe, um eine maßvoll-objektive Haltung einnehmen zu können, und wenn sie, um dem Zeitgeschehen auf der Spur zu bleiben, von Heiklem oder Negativem wie dem »Röhm-Putsch« oder Konzentrationslagern berichten wollten, wussten sie um die Zensur. So tauchten nationalsozialistische Symbole, Persönlichkeiten oder Geschehnisse in erzählerischen Handlungen auf, die vor 1933 spielten. Darüber konnten Schriftsteller aus sicherer Distanz und Perspektive berichten. In Romanen über die sogenannte Kampfzeit der NSDAP – 1919 bis 1933 –, in denen die Weimarer Republik den historischen Rahmen bildet, taucht häufig Hitler auf, gefolgt von Goebbels und Horst Wessel: Personal von hohem Wiedererkennungswert und Charisma.49
Romane mit historischem Ausgangspunkt und post-industriellem Szenario begannen zumeist während des Ersten Weltkriegs, begaben sich dann in die Welt der zwischen 1919 und 1925 operierenden Freikorps und behandelten bestimmte Problemfelder der Weimarer Republik. Hans Zöberlein, Edwin Erich Dwinger und Werner Beumelburg spezialisierten sich auf solche Geschichten. Mehr oder weniger deutlich stellten sie die Weltkriegskämpfer über die Freikorps mit den Männern aus SA oder SS in eine Linie. Einige ihrer Romane waren schon in den zwanziger Jahren veröffentlicht worden und erlebten nach der Machtergreifung höchst erfolgreiche Neuauflagen. All dies qualifiziert sie als NS-Literatur. Dass diese Autoren wie andere ihrer Sorte selbst Soldat gewesen waren, verlieh ihren Arbeiten einen hohen Grad an Authentizität.50
Zu den Hinweisen, dass die Autoren faschistisch waren, zählen zum Ersten die Kriegsverherrlichung im Interesse der als patriotisch (lies: chauvinistisch) verstandenen deutschen Sache, zum Zweiten die Konstruktion einer Situation von Befehl und Gehorsam, in der eine autoritäre Führungspersönlichkeit ganz oben steht, und zum Dritten die Schilderung eines Individuums, etwa eines Soldaten, in dieser Kommandokette, das nur als Teil einer größeren Gemeinschaft, zum Beispiel eines militärischen Zugs, Bedeutung erlangt. Das ist schon ein Vorgeschmack auf die »Volksgemeinschaft«. Für Ernst Jünger war der Krieg von erhabener, moralisierender Wirkung, denn hier »begegnete der deutsche Mensch einer stärkeren Macht: er begegnete sich selbst«.51 Edith Gräfin Salburg glorifizierte den Tod auf dem Feld als »Heldentod im höchsten Sinn«, für den Soldaten bedeute er »das Hinauswachsen über die eigene Persönlichkeit, das Sichselbstvergessen im Dienste des Ganzen«.52 Dwinger erinnerte sich an das Gefühl der Gemeinschaft mit den zum Tode verdammten studentischen Freiwilligen, die im November 1914 in der berühmten Schlacht von Langemarck fielen, und er sowie Beumelburg, Heinrich Zerkaulen und Heinz Steguweit schilderten Szenen erbärmlichen Gehorsams der Soldaten gegenüber ihren Vorgesetzten.53 In Literatur umgesetzt wurden neben den Ereignissen des Ersten Weltkriegs auch der als Schmach empfundene Versailler Friedensvertrag sowie die Legende vom »Dolchstoß« der Heimatfront in den Rücken der Armee.54
Die sogenannten Freikorps, kleine paramilitärische Gruppen, geführt von schlachterprobten Kommandanten, die zumeist den mittleren Rängen entstammten, formierten sich schon Anfang 1919, kurz nach der Auflösung der kaiserlichen Armee. Anfänglich wurden die Freikorps von der jungen Weimarer Republik als Polizeikräfte eingesetzt, aber seit 1920 kämpften sie, unabhängig und illegal, vor allem im Osten, und zwar gegen Bolschewiki, Balten und Polen, die, so hieß es, im Verein mit den Westalliierten deutschen Boden okkupierten. Hypernationalistische Freikorps ergriffen früh Partei für Hitler und seine Bewegung; bisweilen hatten sie Hakenkreuze auf ihre Stahlhelme gemalt. In seiner Pathographie der Freikorps hat KlausTheweleit ein scharf umrissenes Bild gezeichnet, wobei er vor allem die Obsession der Männer mit Grausamkeit hervorhob; »Blut« stand für sie einerseits im Zusammenhang mit Verwundung und Tod, andererseits mit Lebenskraft und Rassegemeinschaft. Bei den Frauen unterschieden sie die »weißen Schwestern«, die Krankenschwestern, die als Mütter und Schwestern zu verteidigen waren, von den »roten Schwestern«, den kommunistischen Frontkämpferinnen – Huren, die (mit dem phallischen Gewehr) erschossen werden mussten.55
Das Wesen dieser Freikorps erfasste Zöberlein in seinem Roman Der Befehl des Gewissens (1937). Dort geben die Truppen ihrer Enttäuschung darüber Ausdruck, von der republikanischen Regierung nach dem Waffenstillstand vom November 1918, dessen Bestimmungen ihre Illegalität vorsah, verraten worden zu sein. Nun warteten sie auf einen Führer, der diesen Zustand beenden würde. In Dwingers Roman Die letzten Reiter (1935) erklärt Hauptmann Wollmeier seinen Kameraden, warum er sich schon früh der NS-Bewegung angeschlossen hat. Und in Rebellen um Ehre (1939) erläuterte der Autor, Herbert Volck, das Ethos der Freikorps, als die Truppen in Litauen dem »asiatischen Bolschewismus« gegenüberstanden: »Soldaten kann jeder gute Offizier kommandieren, Herzen führen nicht jeder. Wer nur befiehlt, ohne dass seine eigene Todesbereitschaft herauszufühlen ist, für den werden die Freiwilligen bald Verweigerer.«56
Einige Freikorps, wie das von Albert Leo Schlageter geführte, verübten Sabotageakte gegen die Franzosen im besetzten Rheinland.57 Diese Männer und ihre Taten wurden in der nun auftauchenden neonationalistischen Literatur heldenhaft verklärt.58 Weiter geschürt wurden antifranzösische Ressentiments von Romanen, die sich mit der (angeblichen) Vergewaltigung deutscher Frauen durch Angehörige französischer Kolonialtruppen im Rheinland beschäftigten. Die so Beschuldigten wurden als »Neger« beschimpft (tatsächlich handelte es sich um Araber aus dem Maghreb und Indonesier).59
Die Verlierer des Ersten Weltkriegs und die Freikorps richteten ihre ganze Wut gegen die Weimarer Republik, die den Versailler Vertrag und die Besetzung des Rheinlands hingenommen hatte – und die Populärliteratur im Dritten Reich zeugte davon. Die Zustände in der Weimarer Republik wurden auf schrille Weise detailreich karikiert, zuvörderst die »Asphaltkultur«, angeblich ein besonders negatives Merkmal der Weimarer Zeit. Herbert Volck äußerte sich kritisch über »Kaffeehäuser, Bars, Bodegas, für den Abend Tanzdielen, Luxuskabaretts«, des Weiteren über »die neuen Negertänze, die plärrende Jazzmusik, die neue Mode«.60 Zöberlein richtete anklagend den Finger auf »Kellner im schwarzen Frack«, die »frechen Augen geschminkter Halbweltdamen« und die Versorgung der gut Betuchten mit »französischem Sekt«.61 Zu dieser Subkultur zählte man außerdem »entartete« Bücher (und Filme) von so gottverlassenen Liberalen wie Erich Maria Remarque, dessen Roman Im Westen nichts Neues offen pazifistisch war.62 Ernst Wiechert beklagte denn auch die »verschwommene Humanität« der Weimarer Zeit, und Ernst Jünger machte diese Ära verantwortlich für die »optische Täuschung« der Massen durch das allgemeine Wahlrecht.63 Durch »Feindblockade« und Inflation verursachte wirtschaftliche Erschütterungen, durch von den »Novemberverbrechern« heraufbeschworenes Unheil sei die vormals so wohlgeordnete Gesellschaft aus den Fugen geraten, und nun bewege sich ein Heer von Kriegskrüppeln auf den Straßen, während Akademiker, Kriegshelden, Ladenbesitzer und ungelernte Arbeiter ohne Job dastünden.64 Neben den Juden galten die Kommunisten und ihre paramilitärischen Einheiten, die verhassten Rotfrontkämpfer, als Hauptschuldige am Desaster; dennoch wurden viele Mitglieder der Rotfront als potenzielle oder tatsächliche Überläufer zum Nationalsozialismus beschrieben.65
Die in diesen Romanen gegen Weimar gerichteten Ressentiments lösten antidemokratische Stimmungen aus und fanden ihren Höhepunkt im schließlich durch Hitler verkörperten Autoritarismus. In Ernst Wiecherts Roman Das einfache Leben (1939) zieht sich Thomas von Orla, ehemals Kapitän der kaiserlichen Marine, aus der Großstadt in einen einsamen Winkel Ostpreußens zurück. Als einzige Autorität akzeptiert er einen General im Ruhestand, der sich so knapp ausdrückt wie Friedrich der Große. Orla selbst wiederum ist die Autorität für Bildermann, einen ehemaligen Matrosen, der ihm, ohne zu fragen, in die Einsamkeit gefolgt ist, als wäre der Erste Weltkrieg noch nicht vorbei.66 Ernst Jünger geht in seinem Essay Die totale Mobilmachung (1934) davon aus, dass infolge einer den Individuen auferlegten »unbarmherzigen Disziplin« eine totale Mobilmachung der Massen möglich sei, die nicht durch die Demokratie, sondern die Erfordernisse autoritärer Herrschaft bestimmt wird.67 In seinem Roman Der Großtyrann und das Gericht (1935) zeichnet Werner Bergengruen das Bild eines allmächtigen Herrschers zur Zeit der Renaissance, der in seinem Garten einen Mönch tötet, um dann die Suche nach dem Mörder anzuordnen. Mit Psychoterror bringt er seine Untertanen dazu, schon bald in jedem Nachbarn den Mörder zu sehen. Nach und nach verklärt der Autor den Großtyrannen, einen Herrscher, der durch reinen Befehl regiert, als käme es ihm natürlicherweise zu, der Gesetze schafft ohne Begründung, der die Infrastruktur seines Herrschaftsgebiets nach Belieben verändert. Er liebt es, Riesenbauten zu errichten, ganz wie Hitler. Am Ende erklärt der Tyrann vor einem von ihm selbst zusammengerufenen Gericht, dass »die Tötung des Fra Agostino … außerhalb der Gerichtsbarkeit« stehe – eine zeitnahe Verteidigung der Vorgänge um den »Röhm-Putsch«, der gerade vermeintlich niedergeschlagen worden war. Bergengruens abschließende Interpretation des Herrschers taugte zur Erklärung historischer Tyrannen, las sich aber keineswegs zufällig auch wie eine Rechtfertigung Hitlers. Vom Großtyrannen heißt es, »dass er zu handeln hat einzig nach den Grundsätzen seiner Wesenheit, nicht aber nach Richtmaßen, die außerhalb seiner entstanden sind«.68 Rosenbergs Völkischer Beobachter feierte das Buch als »Führerroman der Renaissancezeit«.69
Das war die post-industrielle Literatur. Die vorindustriell orientierte Prosa und Poesie beschäftigte sich mit der »rassischen« Abkunft der Deutschen im Wege der »Ahnenpflege«. Es ging darum, die Wurzeln der deutschen Bevölkerung möglichst weit zurückzuverfolgen, um glaubhaft behaupten zu können, es führe eine ununterbrochene Linie von den frühen Germanen und ihrer Kultur zum jetzigen Volk. Da solch eine Linie aufgrund der Vermischung der Germanen mit anderen Ethnien und der Schwierigkeit, die frühe Stammesgeschichte angemessen zu rekonstruieren, bestenfalls lückenhaft war, enthielten »historische« Romane üblicherweise mehr fiktive Elemente, als wissenschaftlich vertretbar war. Die »Ahnenpflege« war tatsächlich nur unkritische Ahnenverehrung, die den altgermanischen Stämmen Eigenschaften zuschrieb, welche sie in Wahrheit nie besessen hatten, die jedoch der nationalsozialistischen Weltanschauung zupass kamen. An die Stelle von Tatsachen trat die Fiktion.70
Ein beliebtes Genre in diesem Bereich waren Romane um die Sagenwelt der Wikinger, wie Werner Jansen, Will Vesper und Hans Friedrich Blunck sie schrieben. Der Arzt und SS-Standartenführer Jansen war ein rabiater Antisemit; sein Roman Die Insel Heldentum (1936) schilderte Stammesfehden von äußerster Brutalität und handelte vom Niedergang der Wikinger auf Island. Mochten sie auch töricht und tollkühn sein, gehorchten sie doch den Gesetzen ihres Blutes und wussten, dass »der Einzelne nichts, die Sippe alles« galt.71 Für den NS-Literaturkritiker Norbert Langer reflektierte der Roman Gesetze des Denkens und Fühlens.72 Walter Best erklärte ihn in Das Schwarze Korps zur Pflichtlektüre für jeden SS-Mann, weil Jansen zeigen könne, dass »der geschichtliche Ablauf unserer Vergangenheit nur dann einen Sinn auch in Tod und Untergang hat, wenn die Erben dieser Geschichte die Lehren daraus zu ziehen vermögen«.73 Will Vespers Helden waren Isländer, Islandreisende oder Menschen, die mit germanischen Göttern in Kontakt kamen.74 Hans Friedrich Blunck, 1933 Nachfolger Heinrich Manns als Vorsitzender der Sektion für Dichtung in der Preußischen Akademie der Künste, schilderte im Roman König Geiserich (1936) die idealen Eigenschaften früher germanischer Führer. König Geiserich, eine historische Figur (389–477), war bei Blunck mit selbstloser Liebe zu seinem Volk, staatsmännischer Weisheit sowie moralischer und physischer Stärke ausgestattet. Geiserich führte die Vandalen durch Spanien nach Nordafrika, um dann bei Karthago zu regieren. Nebenbei unternahm er Feldzüge, die u. a. zur Plünderung Roms führten. Er blieb die ganze Zeit unverheiratet, um seinem Volk besser dienen zu können – ein unübersehbares Kompliment an Hitler.75
Solche Phantasien über Blut und Sippe konnten auch zu einer anderen Zeit spielen und sich zum Beispiel mit germanischen Bräuchen im Früh-oder Hochmittelalter beschäftigen. Josefa Berens-Totenohls Roman Der Femhof spielt um 1350 im Westfälischen. Auf dem Femhof bewahrt Magdlene, Tochter und einziges Kind eines wohlhabenden Bauern namens Wulf, Vorläufer von NS-Erbhofbauern, das Blut und die Tradition ihrer Vorfahren. Sie verliebt sich in einen Landarbeiter, der einmal im Versuch, seinen rechtmäßigen Besitz zu wahren, einen Mann tötete. Magdlenes Vater ist gegen die Verbindung und ersticht den Freier, nachdem ein Femegericht ihn zum Tode verurteilt hat.76 Angeblich hat die Feme das Gerichtsbarkeitssystem der germanischen Stämme konstituiert; wohl nicht zufällig wurde sie von illegalen Freikorpskämpfern in den zwanziger Jahren wiederbelebt. Sie sprachen das Urteil und vollstreckten es gegen Verräter in ihrer Mitte. (Martin Bormann und Rudolf Höß, der erste Kommandant von Auschwitz, wurden während der Weimarer Republik wegen Fememorden zu Gefängnisstrafen verurteilt.) Im Roman gibt es trotz des Todes des jungen Mannes Nachkommenschaft für die Familie Wulf, hat er doch mit Magdlene gegen den Willen des Vaters geschlafen, und so trägt sie das Kind nach seinem Tod aus. Die Autorin zeigt damit den Nutzen der Feme und den Vorrang einer ununterbrochenen Blutsverwandtschaft von urfernen Zeiten an bis zur zukünftigen Genealogie der Familie Wulf auf, die im Folgeroman – Frau Magdlene – geschildert wird. Ihre Botschaft lautet, dass man die Bräuche der Gemeinschaft übertreten kann und infolgedessen bestraft werden muss, dass aber die Langlebigkeit der Sippe höher steht als das individuelle Glück.77 Das Buch war im Dritten Reich höchst erfolgreich, mehr als eine Viertelmillion Exemplare wurden verkauft.78
Mit dem außerehelichen Beischlaf und der unehelichen Geburt von Bauer Wulfs Enkel werden Themen eingeführt, die den Großteil der völkischen Literatur vor der nationalsozialistischen Herrschaft und währenddessen bestimmen, unabhängig davon, ob sie in grauer Vorzeit oder in der Gegenwart spielen. Die typische Literatur der NS-Zeit handelt von Wikingern, Germanen und Genealogien.79 Ferner geht es um Frauenbilder, Eugenik, Rassenbewusstsein bis hin zur Fremdenfeindlichkeit, Liebe zum Landleben, Besiedlung (Osteuropas), Handwerk und einen damit einhergehenden Hass auf die Stadt und ihre Eigenschaften. Lässt man ästhetische Erwägungen beiseite (Saul Friedländer hat die ganze Melange zutreffend als »Kitsch« bezeichnet), ergibt sich ein Muster aus männlich dominierten archaischen Strukturen und anti-intellektuellen Impulsen, eine antimoderne, von verschwommenen Gefühlen regierte Welt.80
Vielfach war die NS-Literatur von biopolitischen, organologischen Obsessionen beherrscht. In der germanozentrischen Welt dieser Autoren galt die Mutter, wie im Beispiel von Magdlene Wulf, als Quell alles lebenswerten Lebens. In der NS-Ideologie wie in der entsprechenden Literatur war Mutterschaft die Hauptaufgabe der Frau. Danach kam ihre Rolle als Gehilfin des Mannes, als eugenische und erotische Partnerin. Schilderungen verehrungswürdiger Mütter finden sich in vielen NS-Romanen, besonders in Walter Bauers Das Herz der Erde (1933), in dem der Autor allein das Klischee pflegt.81 Bauer schilderte die Mutter in den höchsten Tönen einer alles Erlaubte überschreitenden Gefühligkeit. In einer quasi-masturbatorischen Szene entkleidet sich die schwangere Alma und, von »Nachtluft umweht«, spürt sie »die Kraft ihres Leibes«. Einige Seiten später heißt es: »Ich habe dich erkannt, Mutter. Sollten ihre Brüste nicht mehr seinem Durste dienen? Sie war seine Mutter.« Dann wieder sieht Alma sich in einem Ladenfenster und findet sich »stark, braun, mütterlich gesund«.82 Auch andere Romane huldigten dem Mutterkult, ja, der Fruchtbarkeit an sich. Jansen hat dafür die Isländer vorgesehen, Steguweit den Weltkrieg, als Deutschland selbst die Mutter war, Otto Paust zeichnet die Freikorps als mütterlich, während Karl Benno von Mechow, Hans Carossa und Ernst Wiechert dafür das Land wählen.83 Der SA-Barde Heinrich Anacker fasste das Thema für die Nationalisten in einem Gedicht zusammen, in dem eine Mutter drei Söhne geboren hatte, damit sie für Deutschland sterben konnten, und Hans-Jürgen Nierentz empfahl, ebenfalls in einem Gedicht, zimperlichen Frauen, ruhig auf die Geburt ihres Kindes zu warten.84
In gewissen Szenarien, in denen das Mädchen, die Mutter (für völkische Eugenikanhänger nur ein Gebärgefäß) als erotisches Lustobjekt hätte fungieren können, wichen die Autoren häufig der Versuchung aus, um nicht, wie die Naturalisten oder Expressionisten – Hauptmann und Halbe, Schnitzler und Wedekind – der Pornographie bezichtigt zu werden.85 Vielmehr wurden Freundinnen und sogar Ehefrauen als »Kameraden«, pragmatische Gehilfinnen des Mannes, dargestellt.86 Oder es gab die Möglichkeit, sie zu infantilisieren und dadurch zu marginalisieren, damit sie die organische Hierarchie mit der Vorherrschaft des Mannes nicht gefährden konnten.87
Die Gesetze der Eugenik mussten beachtet werden, sonst waren die natürlichen Folgen solcher Vernachlässigung unabwendbar. Idealerweise sollten Männer wie Frauen für die Volksgemeinschaft ein Vorbild an genetischer Gesundheit sein und den (auch außer-)ehelichen Geschlechtsverkehr meiden, wenn erbliche Belastungen vorlagen. In Betina Ewerbecks Roman Angela Koldewey (1939) ist dies das Schicksal des Malers Martin, den die Medizinstudentin Angela nicht heiraten kann, weil es in seiner Familie eine Erbkrankheit gibt.88 (Ewerbeck war die Ehefrau des führenden SS-Arztes Kurt Blome, der später im Nürnberger Ärzteprozess zu den Angeklagten gehörte.) Edwin Erich Dwinger ließ einen seiner Freikorpsanführer predigen: »Mit der Verhätschelung der Armen beginnt das Ungesunde, mit der Bevorzugung der Kranken der Selbstmord!«89 Mit getragenem Ernst schilderte Friedrich Griese in seinem Roman Die Weißköpfe (1939) den Umgang mit einem behindert geborenen Kind in den alten Zeiten: »Das Kind sei hinausgetragen und an einer verschwiegenen Stelle im Wald niedergelegt worden, zuweilen habe man es ertränkt oder lebendig begraben, um einen schnelleren Tod herbeizuführen.«90 Das Veröffentlichungsjahr der Bücher von Ewerbeck und Griese fällt mit dem Beginn der NS-Euthanasiekampagne zusammen, die behinderte Kinder als »lebensunwertes Leben« zum Tode verdammte.91
Auch Rassereinheit war ein Thema für die eugenischen Eiferer. In der erstickenden Atmosphäre der Xenophobie gerieten die Juden, als potenzielle »Rassenschänder«, als Erste zur Zielscheibe, vor allem die nach dem Ersten Weltkrieg vermehrt eingewanderten Ostjuden, obwohl die Assimilierten weiterhin die überwiegende Mehrheit der jüdischen Bevölkerung bildeten. Danach kamen die Schwarzen und schließlich die Sinti und Roma (»Zigeuner«).92 Hitlers zeitweiliger Mentor Dietrich Eckart wurde gefeiert, weil er, so glaubte man, die »jüdische Frage« in den Mittelpunkt der nationalen Aufmerksamkeit gerückt habe. In Romanen wurde Juden häufig angelastet, sie hätten das deutsche Volk und insbesondere das Heer nach dem November 1918 betrogen. Die Folge, so wurde insinuiert, seien die Verstrickung der Juden in alle möglichen Korruptionsnetzwerke und, damit einhergehend, sexuelle Übergriffe auf »arische« Frauen.93 Auch die Jazzbegeisterung der zwanziger Jahre war völkischen Autoren zufolge das Ergebnis jüdischer Manipulation der von »Negern« erfundenen Jazzmusik.94
Die Angst der Nationalisten vor Menschen dunkler Hautfarbe hielt sich vor und nach 1933 zwar in Grenzen, weil es nur wenige davon – als Zeugnis von Deutschlands kolonialer Vergangenheit – im Lande gab. Dennoch fehlten sie nicht im Katalog der völkischen Phobien und waren dergestalt Gegenstand eugenischer Besorgnisse. Vor allem der Schriftsteller Hans Grimm, einst Korrespondent in (Deutsch-)Südwestafrika, fachte den Hass auf Schwarze an, als er in seinen Büchern vor »Rassenvermischung« warnte. Das begann mit Volk ohne Raum, zuerst veröffentlicht 1926 und mit über 300 000 verkauften Exemplaren ein Bestseller im sogenannten Dritten Reich. Es folgten Geschichten wie in Lüderitzland (1936), in denen er die Deutschen in Südwestafrika (dem heutigen Namibia) verherrlichte, die Hereros, die Opfer des ersten deutschen Genozids (1903/04), dagegen verunglimpfte. »Kaffern« röchen schlecht, meinte Grimm, und die Mädchen, sexuell zügellos, seien fortwährend darauf aus, weiße Männer zu verführen. Auch Hanns Johst warnte vor »schwarz-weißen Mesalliancen« wie in Marseille, wo 1936 »achtzehntausend Mischlinge … zur Schule angemeldet« worden seien.95
Lektüre über angeblich feindselige Nachbarländer, allen voran über den geheimnisvollen Riesen Sowjetunion, nicht zuletzt, weil dort, so hieß es, Juden lauerten, die im Hintergrund die Strippen zögen, wurde zum beliebten Zeitvertreib. Angeblich konspirierten die Juden dort mit den herrschenden Kommunisten, um deutsche Minderheiten zu unterdrücken – anständige Bauern, die sich unter Katharina der Großen oder später auf der Krim und im Kaukasus niedergelassen hatten. Deutsche, nicht Russen oder ukrainische Kulaken waren in diesen Darstellungen die Opfer der vom Kreml inszenierten Hungersnöte, an denen Millionen starben. Zudem würden die Deutschen dort von wilden Bergvölkern gejagt. Waren die Russen keine Juden, dann eben hässliche und grässliche Tataren ohne Sitte und Anstand, dem Wodka verfallen.96 Als sich 1938 die Sudetenkrise entwickelte, kamen außerdem Romane über die deutschen Minderheiten in der Tschechoslowakei auf den Markt, in denen die Tschechen als gerissene Schurken dargestellt wurden.97 So wurde psychologisch vorbereitet, womit Hitler dann sein Streben nach Raum im Osten für die »Volksgemeinschaft« rechtfertigen sollte.
In seinen Büchern polemisierte Grimm auch gegen Briten und Franzosen, in denen er hauptsächlich skrupellose Händler und rücksichtslose Kolonisatoren sah. Ähnlich, wenn auch weniger auf die Kolonien bezogen, verfuhr Karl Aloys Schenzinger im Roman Anilin (1937), in dem deutsche Wissenschaftler als Erfinder gegen unfaire englische Konkurrenten kämpfen.98 Wenn es in Romanen gegen Briten und Franzosen ging, drehte es sich hinsichtlich der Ersteren meist um Handelsprobleme, in Bezug auf die Letzteren um Intellekt und Moral: Das von den Franzosen mit der Aufklärung ausgerufene Zeitalter der Vernunft werde durch die in Paris zu beobachtenden Orgien und Perversionen korrumpiert.99
Durch diese ganze Literatur zieht sich ein dünner Faden an Anti-Intellektualität, der mit der Irrationalität der NS-Ideologie selbst korrespondiert. »Denken« sei »ein Strudel«, sagt der Graf zu Kapitän von Orla in Wiecherts Das einfache Leben, nachdem Orla versucht hatte, »die Wunder des Universums« ausfindig zu machen.100 Von Mechow bezweifelte eine »gelehrte Schulphilosophie vom Schreibtisch«, und in Tüdel Wellers Roman Rabauken (1938) wird jedes Gespräch über Freud und Psychoanalyse von Juden geführt.101 In Will Vespers Geschichten von Liebe, Traum und Tod (1937) ist »tüchtiges, ehrliches Wissen« mehr wert als eine akademische Karriere.102
Der Intellektuelle war in der Großstadt zu Hause, darum brachten die Schriftsteller im Dritten Reich dem Urbanen ganz besondere Verachtung entgegen, während sie das Landleben verherrlichten. Für diese Neoromantiker war die Stadt ein Prisma, das in Verdichtung alles Schlechte zeigte, dem ihre Ablehnung galt. Die Häuser der Stadt waren laut Wiechert wie »Gräber in einem toten Land«.103 Er verwarf, wie ein ihm Gleichgesinnter richtig bemerkte, alles, was nicht Natur war, während alles, was von ihr stammte, vollkommen war.104 Für Autoren wie Will Vesper, Fritz Stelzner und Kuni Tremel-Eggert war die Stadt anonym und seelenlos.105 Bordelle und verbotener Sex seien kein Umfeld für das Gebären und Aufziehen von Kindern. Die Stadt sei voll von Juden und den eitlen Vergnügungen, die Korruption und Raub boten. Dort konnten aus ihrer Sicht nur Kommunisten leben.106
Was aber blühte auf dem Lande im Gegensatz zur anonymen Industriestadt? Natürlich das Bauerntum, darüber hinaus aber die alten Handelsgeschäfte und Handwerke, all das, was Frauen und Männer mit ihren Händen verrichteten. Viele Romane und auch Gedichte feierten die Tugenden des Handwerkers und Kunsthandwerkers; dem zugrunde lag Hitlers Maxime, »Arbeiter der Stirn und der Faust« seien einander gleichwertig. In Ernst Wiecherts ostpreußischer Abgeschiedenheit sieht Kapitän von Orla seinen Lebensinhalt darin, fischen zu gehen, im Wald zu roden und Zimmermannsarbeit zu verrichten.107 Ähnlich heben andere Schriftsteller Arbeiten wie Sattlerei, Maurerei und Blechschmiederei hervor.108 Heinz Steguweit jubelte dichterisch: »Der Schreiner sprach zum Dichter stolz:/Wir sind von gleichen Sorten;/ich schaff mit Säge, Hobel, Holz,/mit Hammer, Nagel oder Bolz –/Du schreinerst fein mit Worten.«109
Die Glorifizierung der Handarbeit entsprach der Verherrlichung von Ländlichkeit, Dörflichkeit und heimatlicher Scholle durch NS-Schriftsteller. Das Ländlichkeitsideal war nicht den Vorstellungen Hitlers entsprungen, sondern einem frühen Gefolgsmann, dem Agrarpolitiker Richard Walther Darré; allerdings benutzten Hitler und Goebbels dieses Ideal, um die Massen in den ländlichen Gebieten anzusprechen.110 Auch literarisch ging die Idolisierung des Landlebens bereits auf vorindustrielle Zeiten zurück, wobei alle anschließend durch die industrielle Revolution verursachten Veränderungen standhaft geleugnet wurden. Schon im späten 19. Jahrhundert hatten sich der Bayer Ludwig Thoma und der Steiermärker Peter Rosegger als die unbestrittenen Vorkämpfer des Ländlichen hervorgetan. Thoma gehörte zu Goebbels’ Lieblingsschriftstellern.111
Die Ländlichkeit wird in den Büchern deutscher Schriftsteller zwischen 1933 und 1939 sehr holzschnittartig gezeichnet: Zumeist geht es um das Alltagsleben des Bauern, um seinen Acker und dessen Früchte, um die Arbeitstiere (Traktoren fehlen), Vieh, das versorgt oder verkauft werden muss. Die (erweiterte) Familie, die ihn unterstützt und die zu ernähren er die Verantwortung trägt, besteht aus seiner Ehefrau, den Kindern (vorzugsweise Söhnen als Erben), manchmal auch Schwägern und Enkeln und, mangels Maschinerie, dem mit auf dem Hof lebenden Knecht. Die Menschen sind archaisiert dargestellt und sprechen den lokalen Dialekt, lesen kaum und ernähren sich von einfacher Kost. Sie gehen im Sonntagsstaat in die Kirche, treffen sich, um in gemeinsamer Runde Bier oder Wein zu trinken oder wichtige Familienfeste zu feiern. Die Ehefrauen leben zumeist unterm Joch, die Töchter erst recht; häufig werden sie gegen ihren Willen verheiratet; Bekannt- und Freundschaften gibt es wenige, dafür sind sie umso enger. Wie im Mittelalter lasten uralte Flüche, böse Vorahnungen schwelen, vor allem, wenn Untaten verübt worden sind. Die Vorsehung spielt ihre Rolle – eine Macht, auf die Hitler sich gerne berief. Naturkatastrophen werden tapfer bewältigt, wobei das Überleben nicht immer gesichert ist. Aber der Bauer und die Seinen halten auf der von ihnen bewahrten Scholle stand, wenn die patriarchale Daseinsweise ernsthaft und bisweilen unwiderruflich bedroht wird – vor allem durch Einflüsse einer nahe gelegenen Stadt. Aber alles in allem sind diese ländlichen Szenerien in ihrem So-Sein festgeschrieben, gegen die Dynamik der Stadt, der Modernität.112
In seinem Gedicht »Flieg, deutsche Fahne, flieg!« fing Hans-Jürgen Nierentz die Fetischisierung von »Blut und Boden« ein, als dieses Konzept zum literarischen Inventar avancierte. Das Gedicht zog die Verbindung zwischen der bäuerlichen Liebe zur Scholle und dem Blut, das er möglicherweise vergießen müsse, wenn er sich aufmachte zur Eroberung von »Lebensraum im Osten«. Das Gedicht sprach vom Führer, der bereit sei, Bauern mit ihren Hacken und Spaten durch deutsche Lande zu leiten, die vor Soldaten bereits nur so strotzten.113 Das Gedicht wies mit offener Militanz schon 1936 auf den Angriff hin, der drei Jahre später auf den Osten erfolgen sollte. 1938 veröffentlichte Hans Friedrich Blunck seinen Roman über den Deutschordensritter Walter von Plettenberg, der den russischen Großfürsten Iwan III. in der Schlacht besiegte114 – ein Jahr, bevor Hitler in Polen einmarschierte, und drei Jahre vor dem Überfall auf die Sowjetunion.