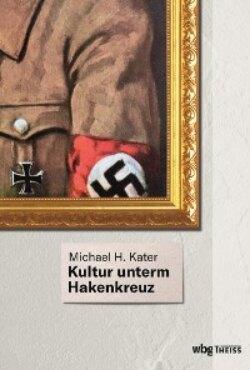Читать книгу Kultur unterm Hakenkreuz - Michael Kater - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Presse und Rundfunk
ОглавлениеPraktisch keine Zeitung oder Zeitschrift konnte nach der Machtergreifung irgendetwas ungeprüft veröffentlichen, mochte der Inhalt auch noch so trivial sein. Einige Autoren arbeiteten für die Presse, manche sogar als fest Angestellte. Zu diesen gehörte Friedrich Sieburg, der, geboren 1893, schon als 26-Jähriger im Ersten Weltkrieg sich als Flieger betätigt und dann in Berlin seine schriftstellerische Karriere begonnen hatte. Mitte der zwanziger Jahre arbeitete er für die liberal-konservative Frankfurter Zeitung und zu Beginn der NS-Herrschaft war er ihr Korrespondent in Paris. Er selbst tendierte zur politischen Rechten und verteidigte den Nationalsozialismus gegenüber ausländischen Kritikern so überzeugend, dass Berlin ihn 1939 in den Auswärtigen Dienst berief.115 Seinem Konservatismus hatte Sieburg nicht nur in Artikeln für die Frankfurter Zeitung, sondern auch in einigen Büchern Ausdruck verliehen. So erklärte er, Humanismus und Liberalismus seien mit der französischen Aufklärung verbunden und für das »neue Deutschland« nicht geeignet.116 Oder er pries den portugiesischen Diktator Salazar als Führerpersönlichkeit ersten Ranges. Er zog Parallelen zu Hitler, indem er den früheren Professor für Wirtschaftswissenschaften als anspruchslosen, bescheidenen Menschen beschrieb, der nicht aus persönlichem Ehrgeiz, sondern aus Notwendigkeit zum autokratischen Herrscher seines Landes geworden sei. Seinen Kampf gegen den Kommunismus rechnete Sieburg ihm hoch an; Salazar müsse allerdings auf dem Weg in eine vielversprechende Zukunft noch eine Lösung für das »Rassenproblem« finden. Denn der portugiesische Eroberer Alfonso de Albuquerque habe zu Beginn des 16. Jahrhunderts den schweren Fehler begangen, die Heirat von Seeleuten und Siedlern mit farbigen Eingeborenen in den neu erworbenen Kolonien zu fördern. Die Ergebnisse könne man, so Sieburg, heute noch auf den Straßen portugiesischer Städte sehen.117
Sieburg und seine Kollegen in den deutschen Zeitungen ließen sich vom im Oktober 1933 verabschiedeten Schriftleitergesetz ebenso leiten wie von den regelmäßigen Direktiven aus dem Propagandaministerium. Eine neue Institution, das Deutsche Nachrichtenbüro (DNB), sorgte des Weiteren für die politisch genehme Steuerung des Informationsflusses mittels einer restlos gleichgeschalteten Presse.118 Die Nachrichten waren häufig geschönt oder gänzlich erfunden, und was Berlin veröffentlicht sehen wollte, wurde den Redaktionen diktiert. Ein Beispiel dafür ist eine Richtlinie vom Dezember 1935, frisch veröffentlichte Goebbels-Reden positiv zu rezensieren, weil das Buch auf dem freien Markt bis dato wenig Resonanz gefunden hatte.119 Als 1937 die Stadt Guernica im Spanischen Bürgerkrieg von der deutschen Legion Condor bombardiert worden war, erfuhr die deutsche Öffentlichkeit, spanische Flugzeuge seien dafür verantwortlich.120 Im Herbst 1938 verschärften die Deutschen im Kampf um das Sudetenland das Vorgehen gegen die Tschechoslowakei. Als dabei der sudetendeutsche Politiker Wilhelm Baierle ermordet wurde, erhielten die deutschen Zeitungen die Anweisung, darüber auf der Titelseite zu berichten und die wahrscheinliche Komplizenschaft deutscher Emigranten ins Spiel zu bringen (die ja niemals eine Gelegenheit auslassen würden, NS-Politiker zu verleumden).121
Wie gut diese Anweisungen in der Alltagspraxis funktionierten, zeigt eine Bemerkung in Goebbels’ Tagebuch. Am 10. November 1938, einen Tag nach den vom Propagandaministerium reichsweit initiierten antisemitischen Pogromen, sollten die Zeitungen die Ereignisse herunterspielen. Stattdessen, überlegte Goebbels, könnten sie schreiben, dass hier und dort Fenster eingeschlagen worden seien und »Synagogen sich selbst entzündet« hätten oder »sonstwie in Flammen aufgegangen« seien. Auf der Titelseite solle gar nicht oder nur sehr zurückhaltend und ohne Fotos berichtet werden. Kommentare dürften sein, sollten sich aber auf »eine begreifliche Empörung der Bevölkerung« und darauf konzentrieren, dass »eine spontane Antwort auf die Ermordung des Gesandschaftsrates« Ernst vom Rath in Paris gegeben worden sei. Goebbels’ Anordnungen wurden befolgt, und er notierte erfreut: »Die deutsche Presse leistet prachtvolle Hilfestellung. Sie weiß, worum es geht.«122
Haben sich aber alle Zeitungen im Dritten Reich diesen Anordnungen in gleichem Maße unterworfen? Es gibt Hinweise darauf, dass die Frankfurter Zeitung dazu am wenigsten bereit war. Sie besaß eine lange bürgerlich-liberale Tradition, war für manche Schriftsteller und Redakteure der Rettungsanker, weil sie der Zensur eine Zeit lang Widerstand leistete, zudem hielt Goebbels es für angebracht, für das Ausland ein Organ von traditionellem Anstrich als Aushängeschild zu behalten.123 Sieburg etwa gab sich eher erzkonservativ als nazistisch, und zwei wichtige Redakteure hatten allen Grund, den Nationalsozialisten zu misstrauen: Benno Reifenberg hatte einen jüdischen Elternteil und Dolf Sternberger eine jüdische Frau.124 Vormals hatte die Zeitung deutschen Juden gehört und über eine bedeutsame Anzahl jüdischer Beiträger verfügt. Erst als die prominenten Autoren Walter Benjamin und Siegfried Kracauer nicht mehr für die Frankfurter Zeitung arbeiteten, erlaubte Goebbels das weitere Erscheinen. Gegen Hitler allerdings, der die Zeitung immer verabscheut hatte, kam auch er nicht an: 1943 wurde sie verboten.125
Es gab noch einige – weniger widerstandsfähige– bürgerliche Zeitungen, die in Städten wie Köln, Hamburg und Berlin weiter erscheinen durften: die Deutsche Allgemeine Zeitung, die Berliner Zeitung und die Neue Rundschau.126 Wie weit diese Zeitungen bereits, freiwillig oder erzwungen, der NS-Ideologie erlegen waren, zeigt sich u. a. daran, dass Organe wie die Deutsche Allgemeine Zeitung im Juli 1937 die Ausstellung »Entartete Kunst« positiv besprachen oder die Frankfurter Zeitung Hitlers Einmarsch in Österreich im Frühjahr 1938 feierte.127 Sie druckte als erste Zeitung Hitlers bombastische Proklamation, um dann den »Anschluss« in einem langen Artikel zu würdigen, dessen Höhepunkt diese Sätze bildeten: »Ohne große Umschweife, mit ebenso großer Offenheit wie Entschlossenheit zeigt die Proklamation des Führers und Reichskanzlers, was in der letzten Nacht in Österreich vorgegangen ist. Die getroffenen Entscheidungen haben sich in der Sicherheit des Handelns vollzogen, die den Weg einer ruhigen und geordneten Lösung nicht verließ.«128 Am 20. April 1939, Hitlers 50. Geburtstag, verglich Sternberger des »Führers« historische Größe mit der von Caesar, Barbarossa und Napoleon.129 Weitere positive Artikel zu Hitler gossen Öl ins Feuer der Aggression gegen Polen.130
Da die Nationalsozialisten viel Wert darauf legten, im Volk verwurzelt zu sein, vor allem im Landvolk, brachten sie auch auf dem Land und in der Provinz die Zeitungen auf Linie (oder eliminierten sie ganz).131 Um sie schwach und abhängig zu halten, durften nicht mehr sie, sondern nur noch die Parteipresse Verlautbarungen der Regierung veröffentlichen. Außerdem musste sich das Regime mit kleinen bis mittelgroßen katholischen Blättern ins Benehmen setzen, was trotz des im September 1933 mit dem Papst geschlossenen Konkordats ein heikles Problem blieb.132
Doch insgesamt war die Presse ein ideales Medium für Goebbels’ Propagandazwecke. Zum einen konnte er die Bevölkerung per Mitteilung administrativer Verfügungen oder durch speziell zugeschnittene Nachrichten kontrollieren, zum anderen sie unterhalten und so dem Regime gewogen halten. Folglich wurden auch Handels-, Familien- und Hobbyzeitschriften in den Dienst des Staates gestellt. Im März 1938 würdigten beispielsweise nicht nur ein Technikerjournal, sondern auch das illustrierte Familienmagazin Der Rundblick und die Schlesischen Monatshefte den »Anschluss« Österreichs. Eine Imkerzeitschrift setzte »Ein Volk! Ein Reich! Ein Führer!« auf die Titelseite und erklärte das Ereignis dann zum »Wendepunkt auch der deutschen Imkergeschichte«.133