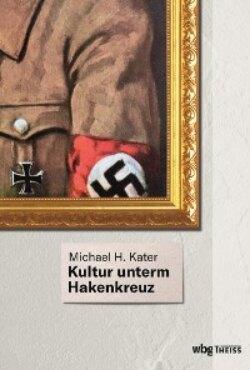Читать книгу Kultur unterm Hakenkreuz - Michael Kater - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Die Weimarer Kultur wird gesäubert
ОглавлениеEnde Februar 1933 erhielt der Schauspieler Hans Otto, zu der Zeit beschäftigt am Preußischen Staatstheater in Berlin, die Mitteilung seiner Kündigung. Nach über 100 Bühnenauftritten in der Spielzeit 1932/33 gab er nun Ende Mai zum letzten Mal den Kaiser in Goethes Faust II. Angebote von Theatern in Wien und Zürich schlug er aus, weil er dem Druck der Nazis nicht weichen wollte. Stattdessen ging er in den Untergrund, wurde aber Mitte November in einem Café am Viktoria-Luise-Platz von SA-Leuten verhaftet, im SA-Quartier, später im Gestapo-Hauptquartier und in der Voßkaserne, dem Sitz der NSDAP-Gauleitung, bis zur Bewusstlosigkeit misshandelt und dann aus dem Fenster gestürzt. Am 23. November starb er in einem Berliner Krankenhaus.29
Der junge, gut aussehende und enorm populäre Hans Otto war ein typischer Vertreter jener Weimarer Kultur, die die Nationalsozialisten zerstören wollten. Er hatte in klassischen Stücken ebenso geglänzt wie in modernen Schauspielen von Wedekind oder Strindberg. Aber er war auch Mitglied der Kommunistischen Partei. Jan Petersen war ebenfalls Kommunist; er arbeitete von Berlin aus als Journalist. Zu seinem Glück wurde er nicht aufgegriffen und konnte ein Buch über das proletarische Leben in der letzten Phase der Weimarer Republik schreiben, das die Nazis nicht verschonte. Das Manuskript wurde in einen Kuchen eingebacken und von dem als Skitouristen verkleideten Petersen Weihnachten 1934 über die Grenze zur Tschechoslowakei geschmuggelt. Das Buch konnte im Ausland veröffentlicht werden, und Petersen gelang Mitte der dreißiger Jahre die Flucht über die Schweiz nach Großbritannien.30
Ein weiterer kommunistischer Schauspieler war Wolfgang Langhoff aus Düsseldorf. Der 32-Jährige verbrachte die meiste Zeit des Jahres 1933 in den Konzentrationslagern (KZ) Papenburg-Börgermoor und Lichtenburg. In Papenburg schrieb er mit am Text für das Moorsoldaten-Lied, das mit seinem trotzigen Refrain – Wir sind die Moorsoldaten/und ziehen mit dem Spaten/ins Moor – von vielen zukünftigen KZ-Häftlingen gesungen werden würde. 1934 wurde Langhoff aus der Haft entlassen und floh in die Schweiz, wo der junge Mann mit den, wie Thomas Mann notierte, »ausgeschlagenen Zähnen« in einem Transitlager auf die Familie des Autors traf.31
Andere in der Weimarer Republik bekannte Künstler konnten Deutschland leichter verlassen, weil sie nicht zur Linken gehörten. Der Dirigent Erich Kleiber zum Beispiel, Österreicher und ein Liebhaber der Musik Alban Bergs, wurde 1935 vertrieben. Dabei war seine Haltung gegenüber dem Nationalsozialismus durchaus zwiespältig. Denn zunächst hatte er, zusammen mit Wilhelm Furtwängler, als Mitglied eines NS-Gremiums für Filmzensur Hermann Göring unterstützt. Im Juni/Juli 1934, während des sogenannten Röhm-Putsches, soll Kleiber im engen Freundeskreis auf Sylt die Hoffnung geäußert haben, dass Hitler, »dem Erretter Deutschlands«, nichts geschehen sei. Dennoch musste er aufgrund seiner Förderung der Avantgarde-Musik scließlich ins Exil gehen und fand Zuflucht in Argentinien.32
Manche flohen in den Suizid. Der 1880 geborene Maler Ernst Ludwig Kirchner, zunächst beeinflusst von Kandinsky und französischen Neo-Impressionisten, hatte 1905 zusammen mit Erich Heckel und Karl Schmidt-Rottluff die Dresdner Künstlervereinigung Die Brücke gegründet. Das Jahr 1911 verbrachte er in Berlin; Straßen- sowie Zirkus- und Variétészenen bestimmten nun seine Bilder. Durch die Gesellschaft, in der er sich befand – hauptsächlich Prostituierte –, geriet er an Morphium und trank schließlich einen Liter Absinth am Tag. Er meldete sich als Freiwilliger im Ersten Weltkrieg und erlitt einen Nervenzusammenbruch. Bis 1917 hielt er sich in einem Sanatorium in Davos auf und blieb anschließend in der Schweiz. Aber der Hauptabsatzmarkt für seine Bilder war nach wie vor Deutschland, und Kirchner betrachtete sich selbst als deutschen Patrioten. Dass die Nationalsozialisten seine Kunst bei ihrem Machtantritt als »entartet« ablehnten, verwirrte und ärgerte ihn. Doch auch seine Bilder hingen im Juli 1937 in der NS-Ausstellung »Entartete Kunst«, und aus der Preußischen Akademie der Künste wurde er ausgeschlossen. Kirchner verzweifelte an seinen Süchten, der Abwertung seiner Bilder und der politischen Stimmung in Deutschland nach dem »Anschluss« Österreichs. Im Juni 1938 erschoss er sich in der Nähe seines Hauses bei Davos.33
Ungeachtet ihrer politischen Haltung galten Kirchner und seine künstlerisch ebenso modernistischen Gefährten den meisten NS-Politikern seit dem Januar 1933 als Verfechter einer Kultur, die ausgelöscht werden musste. Entschiedener noch als in der ausgehenden Weimarer Republik setzten diese Politiker die kulturellen Strömungen der Moderne, die im Gefolge des Ersten Weltkriegs hervorgebrochen waren, in Beziehung zur deutschen Niederlage, zur vermeintlichen Vorherrschaft von Juden als Künstlern oder Kulturmanagern, zu linker und anarchistischer Politik und einer ästhetischen Verzerrung von Form und Inhalt. »Verdrehte« Sexualität, abweichendes Verhalten, Atonalität, »Nigger-Jazz«, unanständige Tanzstile, Zuhälter und Huren, Bilder von Krüppeln und Bettlern – für die NS-Kritiker waren all das Phänomene einer »Asphaltkultur«.
Was als Dada, Kubismus, Expressionismus oder L’art pour l’art bezeichnet wurde, galt ihnen als wertloses Treibgut der Großstadt, ohne organische Verbindung zur Sittlichkeit des Landes. Die Kultur sei in Deutschland in den Bann fremdländischer Einflüsse geraten und dadurch »undeutsch« geworden. Das Individuum zähle mehr als die Gemeinschaft, verstanden als eine nationale Gemeinschaft, die sich durch die »Blutsreinheit« ihrer Mitglieder auszeichne. »Kranke und Irre gehören nicht auf eine Bühne«, wetterte Propagandaminister Goebbels. Der Expressionismus müsse bekämpft werden, weil er, so der Kunstrezensent Karl Hans Bühner, »das Schrille, das Unharmonische und das Kranke« anziehe.34
Viele »Maßnahmen« gegen Kunst und Künstler wurden gerade in der Frühzeit des Regimes spontan von paramilitärischen Gruppierungen wie der SA, der SS oder der Veteranenorganisation Stahlhelm ergriffen, die auf die Rückendeckung der neuen Herrscher zählen konnten. Andere Maßnahmen wiederum beruhten auf Gesetzen wie etwa der Reichstagsbrandverordnung vom 28. Februar und dem Ermächtigungsgesetz vom 23. März 1933. Beide hatten ihre Grundlage in der Notverordnung (Artikel 48) der Weimarer Verfassung, die noch nicht außer Kraft gesetzt war.35 Auch wurden Sondergesetze die Kultur betreffend erlassen, darunter das Schriftleitergesetz vom 4. Oktober 1933, das die freie Tätigkeit von Redakteuren aufs Äußerste einschränkte und die Gleichschaltung der Presse beförderte.36 Aber als flexibelstes und regelrechtes Totschlaginstrument in der Hand der neuen Zensoren erwies sich das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, das am 7. April 1933 verkündet wurde. Paragraf 4 sah vor, dass Personen von zweifelhafter politischer Überzeugung, die nicht rückhaltlos den neuen Staat unterstützten, aus dem Dienst entlassen werden konnten und nur noch drei Monate lang Anspruch auf ihre Bezüge hatten. Paragraf 3 nahm auf dieselbe Weise Juden ins Visier, während laut Paragraf 2 Beamte, die nicht über die entsprechende Vorbildung oder Eignung verfügten, zu entlassen seien.37 Das Gesetz verfolgte den Zweck, Beamte und Beschäftigte im öffentlichen Dienst ohne Rücksicht auf deren hergebrachte Ansprüche auf lebenslange Anstellung bzw. Pensionsbezüge auszuschalten. Es war daher höchst geeignet, um »verdächtige« Künstler aus öffentlichen Einrichtungen zu drängen, sei es auf städtischer, regionaler oder nationaler Ebene – das galt etwa für Opernsänger, die an der Preußischen Staatsoper in Berlin arbeiteten, ebenso wie für Schauspieler an Stadttheatern in Hamburg und Düsseldorf. Doch das Gesetz zielte nicht nur auf den öffentlichen Dienst; es ließ sich auch gegen Vereinigungen wie Lehrerverbände oder Ärztebünde in Anschlag bringen. Im Kultursektor konnte sich letztlich jede NS-Gruppierung mit modernefeindlichen Einstellungen dieses Gesetzes bedienen, um unliebsame Kollegen loszuwerden.
Der Ausschluss aus der Preußischen Akademie der Künste in Berlin, einem Symbol des Weimarer Kulturlebens, sollte die Betroffenen außerdem in den Augen aller anderen Mitglieder, gleich welcher Kunstgattung, diskreditieren. Ein frühes Opfer war Heinrich Mann, der Präsident der Sektion Dichtkunst. Ihn setzte Akademiepräsident Max von Schillings am 15. Februar 1933 vor die Tür.38 Der Komponist Arnold Schönberg, ein Kollege Max von Schillings’, der seit 1925 an der Akademie gelehrt hatte, wurde im März ausgeschlossen, nachdem von Schillings erklärt hatte, der »jüdische Einfluss« in der Akademie müsse beseitigt werden. Er floh mit Frau und Kind nach Frankreich und kam am 17. Mai in Paris an.39 Ebenfalls im Mai erklärte Max Liebermann, Ehrenpräsident der Akademie und Jude, seinen Rücktritt und sein gänzliches Ausscheiden aus der Akademie. In einem von der Presse veröffentlichten Schreiben begründete Deutschlands bedeutendster Impressionist seinen Schritt so: Er habe sein ganzes Leben der deutschen Kunst gewidmet, und Kunst habe »weder mit Politik noch mit Abstammung etwas zu tun«.40 In den folgenden Monaten und Jahren wurden jüdische, linke oder ausgesprochen modernistische Künstler entweder direkt entlassen oder, wie der Bildhauer Ernst Barlach, unter Druck gesetzt, »freiwillig« zurückzutreten.41 Protest kam nur von der hochgeschätzten Schriftstellerin Ricarda Huch, die zwar politisch eher rechts der Mitte stand, aber für Toleranz eintrat. Sie ließ von Schillings wissen, dass sie »verschiedene der inzwischen von der neuen Regierung vorgenommenen Handlungen« ablehne, darunter die Aufforderung an die Akademiemitglieder, eine Loyalitätserklärung gegenüber dem Regime zu unterzeichnen. Ricarda Huch ging richtig davon aus, dass ihr Protest den sofortigen Bruch mit der Akademie zur Folge haben würde. Sie zog sich ins Privatleben zurück.42
Wenden wir uns nun den einzelnen Kunstgattungen zu. Allein die deutschen Bühnen – ohne Berücksichtigung der Filmindustrie – verloren in den ersten Monaten der NS-Herrschaft zehn Prozent ihres Vorkriegspersonals und ein Drittel der Intendanten, von denen viele Juden waren. In München wurde der umtriebige Intendant Otto Falckenberg, der Stücke von Brecht und anderen modernen Autoren aufgeführt hatte, von der Geheimpolizei inhaftiert, nach kurzer Zeit aber wieder freigelassen.43 Falckenberg hatte gerade jene Genres in den Mittelpunkt gerückt, die jetzt tabu waren: den Naturalismus der Jahrhundertwende und anschließend den Expressionismus, der noch vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs seinen Anfang genommen hatte. Die naturalistischen und expressionistischen Dramen setzten sich mit der Psychologie von Individuen in ihren zwischenmenschlichen, oftmals konfliktreichen Beziehungen auseinander, während die Nationalsozialisten eine in »rassisch« bestimmten Gemeinschaften positiv-dynamisch verlaufende Handlung bevorzugten. Zu den naturalistischen Autoren, deren Werke während der Weimarer Republik fast die Hälfte des Repertoires ausgemacht hatten und jetzt offiziell verbannt wurden, gehörten Hermann Sudermann, Arthur Schnitzler, Frank Wedekind, Walter Hasenclever, Ernst Toller und Carl Zuckmayer.44 Georg Kaiser, der produktivste expressionistische Dramatiker der zwanziger Jahre, brachte sein neuestes Stück Der Silbersee, ein quasi-sozialistisches Lehrstück, Ende Februar 1933 gleichzeitig an drei Theatern – in Magdeburg, Leipzig und Erfurt – zur Premiere. Die Musik stammte von Kurt Weill. In Magdeburg spielte der Kommunist Ernst Busch die Hauptrolle. Der Stahlhelm und NSDAP-Funktionäre erklärten die Aufführung für verboten und erwirkten die vorzeitige Absetzung des Stücks. Ähnliches geschah in Erfurt und in Leipzig, wo der jüdische Komponist Gustav Brecher die Aufführung musikalisch leitete. Brecher musste später fliehen und nahm sich 1940 im belgischen Ostende das Leben.45
Viele deutsche Bühnenschauspieler waren auch im Film tätig, wo ebenso Verbote ausgesprochen wurden. Wer in einschlägigen Filmen der Weimarer Zeit gespielt hatte, verlor seine Stellung, so wie die vormals beliebte Hertha Thiele, die in dem linken, expressionistischen Klassiker Kuhle Wampe oder Wem gehört die Welt? von 1932 mitgewirkt hatte. Mitautor des Drehbuches war Bertolt Brecht, die männliche Hauptrolle spielte Ernst Busch. Nachdem Thiele es abgelehnt hatte, in einem Film Erna Jänicke zu verkörpern, die Freundin des 1930 von Mitgliedern des Rotfrontkämpferbunds umgebrachten SA-Manns und NS-Helden Horst Wessel, erhielt sie Berufsverbot und ging in die Schweiz. Nicht nur Kuhle Wampe, auch viele weitere in der Republik produzierte Filme wurden verboten; entweder galten Thema oder Stil als inakzeptabel oder führende Beteiligte als Juden. Fritz Langs Das Testament des Dr. Mabuse (1933) wurde beispielsweise abgelehnt, weil es den Zensoren zu expressionistisch war, ganz abgesehen davon, dass Langs »Ahnenreihe« nicht überzeugte. Nach dem Januar 1933 wurden diverse Sondergesetze zur Ermöglichung von Verboten erlassen. Das wichtigste war das Lichtspielgesetz vom 16. Februar 1934, das eine allumfassende Filmzensur vorsah.46
In einem kulturellen Milieu, das auf einer Skala von eins bis zehn Richard Wagner auf die Zehn und Jazz sowie atonale Musik auf die Eins setzte, standen die Überlebenschancen für traditionelle Musik gut, für die meisten Werke der Moderne dagegen schlecht. Das galt insbesondere für konsequent atonale Kompositionen wie die von Schönberg und dessen Schüler Alban Berg. Die Nationalsozialisten begingen allerdings den Fehler, die Atonalität mit jeglicher Form von »Katzenmusik« in einen Topf zu werfen, worunter sie nicht nur Jazz, sondern auch moderne, wenngleich nicht zwölftönig komponierte Stücke wie die von Paul Hindemith oder Hermann Reutter verstanden. Noch im Januar 1938 sprach sich Goebbels wegen dessen vermeintlich atonaler Kompositionen gegen Reutters Anstellung im Frankfurter Konservatorium aus, die Bernhard Rust, Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, ins Auge gefasst hatte. (Der Konflikt zwischen zwei Ministern war typisch für die heterogenen Regierungsstrukturen im sogenannten Dritten Reich. Im Kulturbereich war zumeist Goebbels der Sieger; auf diese ungewöhnliche Kompetenzenkonstellation in Hitlers Regierungsmodell werden wir in Kapitel 2 näher eingehen.)47 Was Berg betraf, so stießen sich die Nazis nicht nur an der Atonalität seiner Oper Wozzeck, sondern auch an deren gesellschaftlicher Botschaft, in der sich humanitäre Impulse der Nachkriegszeit widerspiegelten. Ablehnung erfuhr auch Bergs andere Oper, Lulu, die Geschichte einer sexuell freizügigen Frau. Aufgrund einer Berliner Aufführung von Orchester-Auszügen musste Erich Kleiber, ursprünglich kein Gegner der Nationalsozialisten, Deutschland verlassen. Auch andere Musiker wichen gezwungenermaßen ins Ausland aus, während weitere, nachdem sie ihre Anstellung bei einem Opernhaus oder einem Orchester verloren hatten, sich irgendwie durchzuschlagen suchten. Zu Ersteren gehörten Paul Hindemith und Vladimir Vogel, ein moderner, aber nicht atonaler Komponist, der jedoch als solcher gebrandmarkt wurde. Alban Berg starb am Weihnachtsabend 1935 in seiner Heimatstadt Wien an einer durch einen Bienenstich ausgelösten Infektion.48
Eine letzte Opernaufführung à la Weimar gab es am 12. Februar in der Berliner Staatsoper. Monatelange Proben waren ihr vorausgegangen, und ihre Schöpfer gehörten sämtlich der Avantgarde an: Regisseur war Jürgen Fehling, das Dirigat hatte Otto Klemperer, das Bühnenbild stammte von Oskar Strnad. Gegeben wurde Wagners Tannhäuser, dessen in Teilen surreale Interpretation sich gegen Bayreuth und den von Wagners farblosem Sohn Siegfried dort gepflegten, von den Nationalsozialisten geschätzten Stil richtete. Aber Klemperer und Strnad waren Juden und beide verließen das Land. Klemperer ging in die USA und Strnad in seine Heimat Österreich, wo er 1935 starb. Fehling dagegen blieb in Berlin und arrangierte sich mit dem Regime.49
Musik wurde dem Publikum nach wie vor häufig über den Rundfunk zu Gehör gebracht. Dessen Struktur und Inhalt wurden nun gravierenden Änderungen unterworfen. Bis zu ihrer Machtergreifung hatten die Nationalsozialisten den Wert des Radios als Propagandainstrument noch nicht in vollem Umfang realisiert, und zwar aus zwei Gründen: Zum einen hatte Hitler nach seiner Haft in Landsberg 1924 nur begrenzte Möglichkeiten zur öffentlichen Ansprache, weil die Genehmigung seiner Auftritte den Zensurbehörden der jeweiligen deutschen Länder oblag. Einer Präsenz im Radio war das nicht förderlich. Zum anderen war der Rundfunk eine Schöpfung der Weimarer Republik und in Funktion und Idee daher aufs Engste mit ihr verbunden, weshalb Propagandaexperten der NSDAP wie Goebbels ihm mit Misstrauen begegneten.50
Das änderte sich mit der Machtergreifung. In einer am 18. August 1933 gehaltenen Rede versicherte Goebbels seinen Gefolgsleuten, das Radio sei ein ausgezeichnetes Instrument zu politischer Kontrolle und müsse daher in den Dienst des »Führerprinzips« gestellt werden. Doch zuvor seien die Missbräuchlichkeiten des alten Personals – Korruption, Pfründenwirtschaft, aufgeblähte Gehälter – zu beseitigen, von inhaltlichen Änderungen gar nicht zu reden.51 Die nun einsetzenden Säuberungen zielten vor allem auf das Führungspersonal, darunter die Intendanten fast aller lokalen Sender der früheren deutschlandweiten Reichs-Rundfunk-Gesellschaft (RRG). Einige von ihnen wie der Begründer des deutschen Rundfunks Hans Bredow wurden nach der Entlassung vor Gericht gestellt; andere wählten den Freitod.52 Ernst Hardt, der den Westdeutschen Rundfunk in Köln leitete, hatte schon als Intendant des Nationaltheaters in Weimar Erfahrungen mit Angriffen von rechts gesammelt. Wie viele seiner Kollegen war er ein aufrechter Sozialdemokrat. Obwohl seine Gefängnishaft in Köln nur ein paar Tage währte, stand er danach mittellos da und suchte Zuflucht bei seiner verheirateten Tochter in Berlin.53
Goebbels, der seit seiner Ernennung zum Minister für Volksaufklärung und Propaganda im März 1933 durch Hitler offiziell für alle Aspekte des Rundfunks Verantwortung trug, sorgte neben den personellen Säuberungen auch im Programm für Veränderungen. Zunächst nahm er sich die moderne Musik vor: »Niggerjazz« erhielt Sendeverbot. Darunter fielen Stücke von jüdischen oder – in NS-Diktion – halb-jüdischen Komponisten ebenso wie einige ausländische Kompositionen. Stattdessen sollte die Musik »deutscher Komponisten« in den Vordergrund rücken. Insbesondere die Werke Beethovens galten als starkes Gegengift »zum Dissonanzensport, zur Unzucht der Harmonie und zum Chaos der Form«.54
Mit einer Mischung aus paramilitärischen Gewaltmaßnahmen und gesetzlichen Regelungen wurde außerdem die Presse in die Knie gezwungen. Zuerst nahm man die linksorientierten Zeitungen aufs Korn: den Vorwärts der SPD und die Rote Fahne der KPD. Die gewaltsamen Ausschreitungen erhielten durch ein Notstandsgesetz vom 4. Februar 1933 den Anschein von Legalität, und im März waren alle linken Presseorgane ausgeschaltet.55 In kurzer Folge fielen auch viele Zeitungen und Zeitschriften der bürgerlichen Mitte dem Regime zum Opfer, ebenso die konfessionellen Blätter. Sie wurden direkt verboten, mussten fusionieren oder wurden auf Linie gebracht. Hatte es im Januar 1933 noch mehr als 3000 Zeitungen gegeben, waren es vier Jahre später nur noch an die 2000. In vielen Fällen wurden nicht nur die Beschäftigten der alten Redaktionen entlassen oder inhaftiert, sondern auch Gebäude und andere Vermögenswerte konfisziert oder von Unternehmen der Partei für Summen erworben, die weit unter dem Marktpreis lagen. Auf die Notverordnungen vom Frühling und Frühsommer folgte am 4. Oktober das sogenannte Schriftleitergesetz, in dessen Paragraf 5 Entlassungskriterien formuliert waren: ein nicht-»arischer« Stammbaum sowie Defizite mit Blick auf »die Aufgabe der geistigen Einwirkung auf die Öffentlichkeit«.56
Einige Fallbeispiele zeigen das Ausmaß der Umwälzungen und Gewalt gegen Presseorgane und des damit verursachten menschlichen Leids. Die SA stürmte den Hauptsitz der sozialdemokratischen Münchener Post, schlug alles kurz und klein und verhaftete alle, denen die Flucht nicht gelungen war. Auch die ebenfalls in München ansässige katholische Wochenzeitung Der gerade Weg, die schon vor 1933 in Gegnerschaft zu den Nationalsozialisten gestanden hatte, wurde heimgesucht und der Herausgeber, Franz Gerlach, gleich vor Ort schwer misshandelt und später in Dachau ermordet. In den Räumen der bildungsbürgerlichen Frankfurter Zeitung, einer Hauptvertreterin liberal-konservativer Anschauungen in der Weimarer Republik und berühmt für ihr Feuilleton, tauchten bereits am 31. März 1933 Polizisten auf und verhafteten einige Redakteure. Dadurch wurden die (zu der Zeit noch jüdischen) Eigner eingeschüchtert, und die Frankfurter Zeitung geriet zum Paradeblatt der Nationalsozialisten. Die Neue Badische Landeszeitung aus Mannheim wurde am 1. März 1934 verboten, wahrscheinlich aufgrund einer Denunziation durch einen den Nazis nahestehenden Mitarbeiter. Der leitende Redakteur, Heinrich Rumpf, versuchte noch eine Zeit lang, in einer Leihbibliothek zu arbeiten, beging dann aber Suizid.57
Für die Künste galten andere Bedingungen als für Presse und Rundfunk, weil die Kunstschaffenden als Individuen unabhängiger waren. In der Architektur zum Beispiel konnten nur Architekten entlassen werden, die institutionell gebunden waren: in der Verwaltung, in Lehreinrichtungen, in staatlichen oder regimeeigenen Unternehmen. Selbstständig Tätige bezogen ihr Einkommen aus Aufträgen und konnten in Deutschland bleiben, sofern sie nicht als Juden oder Linke verfemt wurden. Ein nationalsozialistischer Architekturstil hatte sich noch nicht herausgebildet, sodass es in dieser Hinsicht erst einmal keine Diskriminierungen gab.
Eine Ausnahme bildete der zutiefst mit der Weimarer Republik verknüpfte Bauhaus-Stil, der sofort nach der Machtergreifung in Ungnade fiel. Bauhaus-Gründer Walter Gropius, Mies van der Rohe und andere Architekten aus dem berühmten »Ring« – der sich dem Neuen Bauen verschrieben hatte –wurden kaltgestellt. Dem Bauhaus als Teil dieser Bewegung wurde die Bevorzugung des Flachdachs gegenüber dem traditionellen deutschen Giebelhaus vorgehalten. Das Flachdach aber sei technisch schwierig und ästhetisch misslungen, mit der Betonung der Horizontalen statt – wie in der Gotik – der Vertikalen sei der Bauhaus-Stil nicht deutsch, sondern »bolschewistisch«, passend zur Weimarer »Asphaltkultur«.58 Im Großen und Ganzen wollten die NS-Ideologen zum Historismus der Vorkriegszeit zurückkehren, wobei die Betonung eher auf ländlichen denn auf urbanen Stilformen lag.59
In der Weimarer Republik hatte der Verband Deutscher Architekten (VDA) nahezu eine Monopolstellung innegehabt; 1933 nun wurde er von einer Gruppe Nationalsozialisten um den ehemaligen Architekten Alfred Rosenberg infiltriert, nicht zuletzt, um unerwünschte Kollegen loszuwerden, darunter einige »Ring«-Architekten wie Gropius’ Freund Erich Mendelsohn. Noch im selben Jahr wurde der VDA in die von Goebbels neu gegründete Reichskulturkammer (RKK) integriert.60 Im April 1933 fiel, was vom Weimarer Bauhaus nach Berlin gerettet worden war, den NS-Zensoren zum Opfer; die Schule wurde aufgrund des entschiedenen Vorgehens Rosenbergs, Chefideologe der NSDAP und aufgeblasener Obskurant, geschlossen. Vom Bauhaus beeinflusste Architekten verloren ihre Stellung: Fritz Wichert an der Städelschule in Frankfurt/M., Hans Scharoun und Adolf Rading, »deren Entwürfe für die Wohnungsbauentwicklung zu den radikalsten gehörten, die während der Weimarer Zeit gebaut wurden«; beide waren Mitglied der Akademie für Kunst und Kunstgewerbe in Breslau. Hans Poelzig büßte seinen Posten als Direktor der Vereinigten Staatsschulen für Freie und Angewandte Kunst in Berlin ein, und Robert Vorhoelzer durfte nicht mehr an der Technischen Hochschule München lehren. Indes konnten die weniger prominenten Adepten je nach Grad ihrer Anpassung an die Erfordernisse des Regimes ihre Jobs als Lehrkräfte oder anderweitig im Staatsdienst Beschäftigte zumeist behalten. Gropius und sein Nachfolger Mies van der Rohe mühten sich, trotz ihrer Bauhaus-Aura Arbeit als selbstständige Berater zu erhalten. Sie boten ihre Dienste für Ausstellungen an, die vom Regime gefördert wurden, und Gropius entwarf 1934 für eine Veranstaltung sogar hakenkreuzgeschmückte Fahnenreihen, »wodurch er sich eindeutig dem NS-Regime anzudienen suchte«. Doch noch im selben Jahr wurde seine finanzielle Lage so schwierig, dass er in der Hoffnung auf bessere Zeiten nach Großbritannien ging. 1937, mittlerweile an der Universität Harvard, bestand er allerdings nach wie vor darauf, er sei kein Einwanderer, sondern da, um »der deutschen Kunst zu dienen«. Mies van der Rohe machte in Deutschland ähnlich enttäuschende Erfahrungen und folgte Gropius 1938 in die USA, während ihr Mentor Peter Behrens in Deutschland blieb, im Dienst des sogenannten Dritten Reiches.61
Malerei und Bildhauerei gerieten unter den Nationalsozialisten indes in viel höherem Maße ins Kreuzfeuer der Kritik als die Architektur, die, unabhängig vom Design, letztlich immerhin einen praktischen Nutzen hatte. Die bildnerische Avantgardekunst der Nachkriegszeit wurde von Kritikern im Gefolge von Rosenberg und Goebbels schlechtgemacht, die sich ihrerseits auf Urteile von Hitler bezogen (der die Aufnahmeprüfung an der Wiener Kunstakademie nicht bestanden hatte). Bereits Mitte der zwanziger Jahre hatte er »Kubismus und Dadaismus« in Mein Kampf dem »Bolschewismus der Kunst« zugerechnet. In seinen öffentlichen Hauptreden zwischen 1933 und 1937 wiederholte er diese Phrasen fast wörtlich, ohne sie jemals genauer auszuführen; nie ließ er erkennen, dass ihm die Unterschiede zwischen den neuen Kunstrichtungen – Dadaismus oder Kubismus, Impressionismus oder Expressionismus – geläufig gewesen wären. Unvermeidlich und höchst vereinfachend sah er in all dem nur Entartung, die er mit körperlicher und geistiger Krankheit und »den Juden« in Verbindung brachte.62 Entsprechend behauptete Rosenbergs Sykophant Robert Scholz 1933, dass Karl Hofer, Paul Klee und ihre Freunde durch ihre Beschäftigung mit Expressionismus und Kubismus das »Gift des künstlerischen Nihilismus« nach Deutschland gebracht hätten. 1934 zeigte der NS-Kunstpropagandist Wolfgang Willrich Reproduktionen von Werken Noldes und Barlachs, um daran »die Entartung zu Missgestalt und Gemeinheit« zu demonstrieren.63 Das oftmals schwer verständliche Geschreibsel der NS-Zensoren lässt immerhin erkennen, dass sie die naturfremde Farbgebung der modernen Kunst ebenso hassten wie deren ungegenständliche bis abstrakte Formen.
Auf der Grundlage dieser Ideologie gingen die Nationalsozialisten zweigleisig gegen die moderne Kunst vor: Sie entzogen unerwünschte objets d’art dem Blick der Öffentlichkeit, um sie ihr dann in eigens inszenierten Schreckensausstellungen so zu präsentieren, dass diese sich davon abwenden sollte. Im Juni 1933 empfing Hitler höchstpersönlich eine Gruppe von Gegnern der Moderne – darunter der Hauptfeind des Bauhauses, der Architekt Schultze-Naumburg –, die ihm eine Reihe von Fotos moderner Kunst vorlegten. 500 Gemälde der Avantgarde ließ er daraufhin aus der Neuen Abteilung der Nationalgalerie, der weltweit ersten öffentlichen Sammlung moderner Kunst im Berliner Kronprinzenpalais, entfernen. Im Oktober 1936 verfügte er die dauerhafte Schließung der Abteilung. Danach wurden regionale Galerien, hauptsächlich von Gefolgsleuten Rosenbergs, geschlossen oder in ihren Beständen ausgedünnt. In München riss 1935 der bayrische Innenminister und Gauleiter Adolf Wagner Bilder einer Ausstellung Berliner Künstler von der Wand. In Essen entfernte Klaus Graf von Baudissin Bilder des gebürtigen Russen Kandinsky, den Baudissin einen »Entwurzelten« nannte, aus dem Folkwang-Museum, zu dessen Direktor er gerade ernannt worden war. Den Anfang der Schandschauen machte Mannheim 1933 – die Ausstellung wanderte dann weiter nach München und Erlangen. Vergleichbare folgten in Karlsruhe, Stuttgart, Chemnitz und insbesondere der Kunstmetropole Dresden. Hier war Hitler so beeindruckt von dem, was er als entartete Kunst ansah, dass er befahl, daraus eine Wanderausstellung zu machen, die in ganz Deutschland gezeigt werden sollte. Institutionell wurden diese frühen Aktivitäten von Rosenbergs Kampfbund für deutsche Kultur ebenso unterstützt wie vom Deutschen Kunstverein, einer Neugründung von NS-Fanatikern unter Leitung der obskuren Malerin Bettina Feistel-Rohmeder.64
Gleich nach der Machtergreifung setzten die Nazis in der deutschen Kunstwelt eine Welle von Entlassungen in Gang, die sich über Jahre hinziehen sollte. Einer der Ersten, der gehen musste, war der künstlerische Mentor der Weimarer Republik, Reichskunstwart Edwin Redslob, zu dessen Aufgaben die Ausrichtung von Staatsbegräbnissen ebenso gehört hatte wie die Gestaltung von Münzen und Briefmarken. Vor die Tür gesetzt wurden ferner Direktoren von Museen und Galerien, etwa Gustav F. Hartlaub in Mannheim oder Carl Georg Heise in Lübeck. Ihre Lehramt verloren: Karl Hofer in Berlin, Willi Baumeister in Frankfurt/M. und der Bildhauer Gerhard Marcks, der früher, ebenso wie Paul Klee, am Bauhaus tätig gewesen war; Klee musste seinen Posten an der Düsseldorfer Kunstakademie aufgeben und ging Ende 1933 in die heimatliche Schweiz zurück.65
Manchen von Klees Kollegen war so ein Ausweg nicht vergönnt. Ihre Versuche, nach dem Rauswurf beruflich wieder Fuß zu fassen, liefen zumeist ebenfalls ins Leere. Diese Fälle verdienen eine nähere Betrachtung. Da ist zunächst Otto Dix, der erst Expressionist gewesen und dann zur Neuen Sachlichkeit übergegangen war, die in gewisser Weise eine Fortschreibung des Expressionismus darstellte wie auch eine Reaktion darauf. Denn die Künstler suchten nun der Wirklichkeit wie in einer detaillierten Fotografie nachzueifern, während der Expressionismus auf exaltierte Farben und Formen gesetzt hatte.66 Auf die Spitze getriebener Realismus und Sozialkritik, diese Kennzeichen der Neuen Sachlichkeit führten dazu, dass Dix’ Darstellungen des Bordelllebens von bigotten NS-Fanatikern als »Unflätigkeiten unterster Geschmacksstufe« bezeichnet wurden. Am 8. April 1933 wurde Dix, bis dahin Professor an der Kunstakademie zu Dresden, von der sächsischen Regierung im Rahmen der neuen Gesetzgebung zum Berufsbeamtentum entlassen. Er zog an den Bodensee und wohnte eine Zeit lang im Schloss seines Schwagers. Er litt unter Geldnot und war von allen Ausstellungen des Jahres 1934 ausgeschlossen. Bis 1945 musste er sich mit kleineren lokalen Privataufträgen durchschlagen.67 Auch Max Beckmann, der an der Frankfurter Städelschule unterrichtete, verlor seine Professur schon Anfang 1933. Zunächst versuchte er in Berlin zu überleben, floh aber im Juli 1937, als Hunderte seiner Bilder in der Münchner Ausstellung »Entartete Kunst« zu sehen waren, nach Amsterdam und von dort weiter nach New York. 1935 hatte der NS-affine Kunsthistoriker Carl Linfert, der den Fanatiker Rosenberg nicht mochte, sich bemüht, Beckmanns Haut zu retten, indem er ihn öffentlich als dem Expressionismus fernstehend bezeichnete – selbst aus heutiger Sicht ein wenig überzeugender Ansatz.68 Im April 1933 wurde Oskar Schlemmer entlassen. Vergeblich waren alle Versuche, die Stellung am mittlerweile nach Berlin übergesiedelten Bauhaus zu behalten. In materieller Not und mit dem Willen zur Anpassung beharrte er in einem Brief an Goebbels darauf, er sei »jener Typ Künstler, den der Nationalsozialismus brauche«. An Baudissin schrieb er, unter Verwendung ästhetischer Termini des Bauhauses: »Ist denn der Nationalsozialismus nicht auch eine Form-Idee? Ein ganzes Reich soll doch geformt werden, neu geformt!« Und in dieser Neuformung sah er auch einen Platz für sich selbst.69
Ferner setzten die Nationalsozialisten dem Einfluss von Büchern aus der Weimarer Zeit durch Zensurmaßnahmen, Druckverbote und spektakuläre, deutschlandweite Verbrennungsaktionen ein Ende. Schriftsteller der Moderne mit Lehrverpflichtungen an Universitäten oder Schulen waren ohnehin rar gesät; weniger prominente konnten sich anpassen, indem sie ihre Manuskripte umschrieben. Die unnachsichtige Behandlung einiger berühmter freigeistiger Autoren sollte allen, die abweichende Vorstellungen hatten, als Warnung diesen. Ein Beispiel ist Thomas Mann, der zum Zeitpunkt der Machtergreifung auf einer Vortragstour im Ausland unterwegs war und erst nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs aus Anlass eines Besuchs nach Deutschland zurückkehrte. Im Dezember 1936 wurden ihm die Staatsbürgerschaft und die Ehrendoktorwürde der Universität Bonn aberkannt. Heinrich, der ältere Bruder, war schon im Februar 1933 nach Frankreich geflohen; ihm hatte das Regime noch im August jenes Jahres demonstrativ die Staatsbürgerschaft entzogen.70
NS-Literaturkritiker sahen die Vernichtung von Werken kommunistischer und sozialdemokratischer, aber auch christlicher (lutherischer) Autoren vor, desgleichen Bücher über Frauenemanzipation, Pazifismus, Sexualität und ähnliche Themen. Die Bücher zu Sachthemen umfassten nahezu die gesamte Literatur der Weimarer Avantgarde; hinzu kamen Werke von Juden und international bekannten Autoren wie dem französischen Kommunisten Henri Barbusse und dem US-amerikanischen Sozialkritiker Upton Sinclair. Diverse Partei- und Regierungsorganisationen hatten, bisweilen längst vor dem Januar 1933, schwarze Listen erstellt, aufgrund deren renommierte Verlage wie die Deutsche Verlags-Anstalt (DVA), Rowohlt und Propyläen nun die Produktion solcher Bücher einstellen mussten, welche von den Nationalsozialisten als naturalistisch, expressionistisch, dadaistisch oder der Neuen Sachlichkeit verpflichtet abgelehnt wurden. Öffentliche Bibliotheken und Leihbüchereien mussten sich von umfangreichen Beständen trennen. Bereits im Dezember 1933 waren über tausend Titel verboten oder aus dem Verkehr gezogen worden – eine Zahl, die in den folgenden Jahren noch anwachsen sollte.71
Bei den Bücherverbrennungen ging es hauptsächlich um die Bestände der öffentlichen Büchereien und der Universitätsbibliotheken. Offenkundig auf Betreiben Goebbels’, der darin von Hitler unterstützt wurde, fanden an den meisten deutschen Universitäten Autodafés statt. Auf Grundlage der schwarzen Listen und mit Hilfe von Kampfbund und Kripo suchten Mitglieder der Deutschen Studentenschaft (DSt) – des Dachverbands der deutschen Studenten – indexierte Bücher von bereits verbotenen Autoren heraus. Auch Schulbüchereien wurden durchforstet, außerdem sollten Privathaushalte ihre Sammlungen durchsehen. Nach wochenlanger Vorbereitung wurden die Scheiterhaufen am 10. Mai 1933 in Anwesenheit von Mitgliedern von Partei, SA und SS entzündet. Professoren in vollem Ornat gingen den Studenten zur Hand: Ernst Bertram in Köln, Hans Naumann in Bonn und in München Universitätsrektor Leo von Zumbusch. In Frankfurt wurden die Bücher auf einem von Ochsen gezogenen Düngerwagen herbeigeschafft, in Mannheim war es ein Schinderkarren. In Würzburg wurden mindestens 280 Bücher vernichtet, eine Größenordnung, die auch für andere Universitätsstädte zugetroffen haben dürfte. In Göttingen krönte ein Leninporträt den Bücherstapel, auf anderen wurde die Fahne der Weimarer Republik drapiert.72
In Berlin verlangte die Inszenierung die Anwesenheit des Propagandaministers. Auf dem Kaiser-Franz-Joseph-Platz – gemeinhin Opernplatz – zwischen Staatsoper und Friedrich-Wilhelm-Universität hielt Goebbels von einem offenen Wagen aus eine Rede zum Motto der »Aktion wider den undeutschen Geist«. Er polemisierte gegen das, was er für jüdischen Intellektualismus und den Materialismus des November 1918 hielt, und forderte die Studenten auf, den »geistigen Dreck« der Vergangenheit in die Flammen zu werfen. Dann landeten die Werke von Sigmund Freud, Karl Marx, Heinrich Mann, Carl von Ossietzky, Erich Maria Remarque und anderen prominenten Autoren, auch solchen aus dem 19. Jahrhundert, jeweils mit einem »Feuerspruch« versehen, auf dem Scheiterhaufen.73