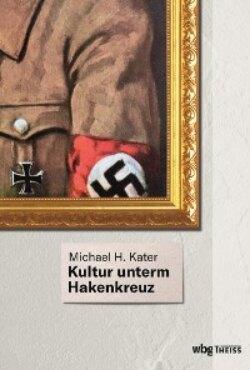Читать книгу Kultur unterm Hakenkreuz - Michael Kater - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das Propagandaministerium und die Kultur
ОглавлениеEs war an einem Morgen Ende Oktober 1938 im Weimarer Hotel Elephant, als sich der Wiener Dichter Josef Weinheber aus den Reihen seiner 250 Landsleute erhob und, beflügelt vom Inhalt zweier Flaschen Wein, zum Lesepult an der Stirnseite des Saals schritt, um zu Ehren des großen – und von den Nationalsozialisten hochgeschätzten – Dichters Friedrich Hölderlin eine schwungvolle Rede zu halten. Kurz zuvor war Österreich ans Deutsche Reich »angeschlossen« worden, und Weinheber zog samt Freunden nach der Besichtigung von Weimars klassischen Schätzen stolzgeschwellt und dankbar am Abend zum Vortrag von Dr. Goebbels, der die Abschlussrede zum politisch arrangierten ersten Treffen deutscher Dichter hielt (weitere sollten folgen). Befeuert von weiterem Weingenuss, unterbrach Weinheber den Minister mehrfach durch »Heil Hitler«-Rufe, was den ministeriellen Redefluss ins Stocken brachte. Da man wusste, wie sehr Hitler und Weinheber einander zugetan waren, näherten sich schließlich zwei baumlange SS-Männer und überredeten den Dichter sanft, sich in sein treppaufwärts gelegenes Gästezimmer zurückzuziehen, sodass Goebbels seine Rede nunmehr ungestört fortsetzen konnte. Weinheber, ein schwerer Alkoholiker, schied 1945, als die Rote Armee auf Wien zumarschierte, freiwillig aus dem Leben.26
Die Anwesenheit prominenter Autoren aus der neuen »Ostmark« und dem frisch besetzten Sudetenland war für Goebbels wichtig, um die Bedeutung der NS-Politik im Allgemeinen und die Prärogative dieser Politik über die Dichtung im Besonderen zu erläutern. Jegliche Kultur, gab Goebbels zu verstehen, müsse in Zeiten nationaler Alarmbereitschaft dem Staate dienen und in dessen totalitäre Struktur eingebunden sein. Daran wollte er die deutschen Schriftsteller, wie alle Künstler im Reich, erinnern. Solche Forderungen formulierte er nicht zum ersten Mal, da er aber wusste, dass sich das Reich auf Expansionskurs befand und er sich einem ungewöhnlich aufmerksamen Publikum gegenübersah, ergriff er die Gelegenheit, die Intellektuellen und Künstler aufs Neue zu mobilisieren.27
Goebbels sprach hier in seiner Eigenschaft als Minister für Volksaufklärung und Propaganda. Diese Doppelbenennung des Ministeriums war nicht das Resultat einer zufälligen Laune, sondern ein sorgsam überlegter Schachzug: Es ging um die Lenkung der Bevölkerung durch Verabreichung von Botschaften, die je nach den Erfordernissen des Tages und ausschließlich im Interesse des politischen Führungspersonals lanciert und manipuliert wurden. Das Konzept lässt sich schon in Hitlers Mein Kampf finden, und er selbst ernannte Goebbels im März 1933 zum Minister. Ende Juni führte Hitler aus, dass Goebbels für »alle Aufgaben der geistigen Einwirkung auf die Nation, der Werbung für Staat, Kultur und Wirtschaft« verantwortlich sei.28 Daraus leitete Goebbels den Auftrag ab, Kultur als Propagandainstrument zu definieren, betrachtet als eine Art Lebenselixier für die rassisch verfasste »Volksgemeinschaft« und schließlich als deren Ausdruck. »Das Wesen der Propaganda«, betonte Goebbels, »ist deshalb unentwegt die Einfachheit und die Wiederholung.« In diesem Rahmen bewegte sich der Propagandagehalt je nach politischem Bedarf zwischen Wahrheiten, Halbwahrheiten und direkten Lügen. Als Minister hob Goebbels immer wieder den inneren Zusammenhang zwischen Kultur, Propaganda und Politik hervor. Seine Mitarbeiter im Ministerium ergingen sich fortwährend in diesbezüglichen Lippenbekenntnissen, und Beamte in jedem Winkel des Reichs beteten sie nach.29 Ein wichtiger Aspekt dieser Bemühungen war des Ausbau des bereits existierenden »Führermythos«; das begann mit volkstümlichen, auch filmischen Kulturveranstaltungen und gipfelte in staatlich geförderten, absurden hagiographischen Hymnen.30
In diesem Kosmos konnte es kein L’art pour l’art geben: Kunst war nicht um ihrer selbst willen da. Als »Vorkämpfer nationaler Kultur«, so Goebbels, konnte der künstlerische Ausdruck viele Formen annehmen, und den Kunstschaffenden kamen viele Rollen zu, solange sie dem Staat dienten.31 Erstens sollte die Kunst, was nicht verwundert, die Haltung der Bevölkerung zum Regime so beeinflussen, dass diese der vorherrschenden Politik bereitwillig zustimmte. Laut George L. Mosse bestand »die zentrale Aufgabe der Kultur im Dritten Reich [darin], die Weltanschauung der Nationalsozialisten zu verbreiten«.32 Dazu war es zum Beispiel erforderlich, für die Akzeptanz rassischer Normierungen zu sorgen, etwa durch die Darstellung blonder, blauäugiger »Arier« in Gemälden. Wer sich dieser Beeinflussung verweigerte, wurde als abweichend gebrandmarkt und entweder auf Linie gebracht oder aus der sogenannten Volksgemeinschaft entfernt. Zweitens ging es um – populäre oder anspruchsvolle – Unterhaltung, um die Leute bei Laune zu halten und ihre Aufmerksamkeit von Alltagsproblemen wie der Arbeitslosigkeit in der Frühzeit des Regimes oder dem Mangel an Kartoffeln und Schuhleder auf dem Höhepunkt des Krieges abzulenken. Daher war kein Genre und kein noch so unschuldiges Produkt künstlerischen Schaffens bar eines politischen Wertes – und alles unterlag der Zensur. Drittens galt es, ausländische Regierungen zu beeindrucken, um dem NS-Regime Glaubwürdigkeit als Anwalt der Zivilisation zu verschaffen. So entschloss sich Hitler beispielsweise, Richard Strauss auch nach 1935 nicht auf die schwarze Liste zu setzen, obwohl er dazu Anlass gegeben hatte. Während des Krieges trat die Aufgabe, das Ausland zu beeindrucken, hinter die Einflussnahme auf bestimmte Gruppen in den besetzten Gebieten zurück. Die Flamen in Belgien etwa wurden mit Nachdruck an das gemeinsame »germanische« Erbe erinnert.33 Schon diese drei Aufgaben verdeutlichen, dass man nach dem Krieg mit Recht behaupten konnte, dass Kulturschaffende die NS-Herrschaft durch ihre Komplizenschaft legitimiert und verklärt hatten – was der prominente Schauspieler Bernhard Minetti, der von der Vergabe von Film- und Bühnenrollen erheblich profitiert hatte, bestritt.34
Nicht jede Kunstgattung galt als für die politischen Erfordernisse gleichermaßen geeignet. Hier trug der Film den Sieg davon. Es würde, so die Einschätzung, vergleichsweise einfach sein, NS-konforme Bilder auf die Leinwand zu bannen und in Filmgeschichten Nazilegenden zu erfinden. Dergestalt erklärte Goebbels schon bald nach der Machtergreifung den Film zum erstrangigen »Führungsmittel des Staates«, in dem sich politische Ideen ästhetisch umsetzen ließen. Zu solchen Ideen zählten beispielsweise die Straßenkämpfe zwischen Nationalsozialisten und Kommunisten gegen Ende der Weimarer Republik, bewegend aufbereitet als Geschichtsfilm, oder das Ideal einer gesunden, eugenisch tadellosen Familie, denn »die Keimzelle des Staates ist die Familie«. Scheinbar harmlose Unterhaltungsfilme, Komödien etwa, würden den sogenannten Volksgenossen das »Ausruhen in den Kampfpausen« ermöglichen, damit sie als treue Mitglieder der Rassengemeinschaft weitermachen könnten.35
Das nächstbeste Medium, und mit dem Film verwandt, war die Bühne. Sie müsse den politischen Zielen erst angepasst werden, damit sich »politisches Selbstbewusstsein am Theater« entwickeln könne, wie der gefeierte Bühnenautor Hanns Johst meinte. Das Theater müsse dazu beitragen, den deutschen Menschen zu formen, »einen Menschen nationalsozialistischer Gesinnung und Haltungen«, orientiert an den Germanen der Edda-Sage, deren Praktiken als beispielhaft galten. Rasse, Kult, Heldentum und insbesondere die Opferbereitschaft des Einzelnen für die Gemeinschaft – das alles seien Themen für die Tragödie im neu zu entwickelnden Drama. Die Individualität sollte nicht zuletzt im Schauspielbetrieb durch die Abschaffung des überkommenen Starsystems geopfert werden. Oberstes Darstellungsziel des neuen Theaters war das »Ringen um die großen Fragen des deutschen Daseins«.36
In den bildenden Künsten trat das Rassemotiv ebenfalls zutage. Die Maler sollten »rassisch« perfekte deutsche Menschen zeigen, damit das Volk die Vorzüge der Eugenik zu schätzen lernte. Außerdem konnten Bilder Erwartungen wecken und Wünsche befördern, etwa Liebe zur Natur, zur »Scholle« und zur Besiedlung des europäischen Ostens. Territoriale Bräuche und nationale Legenden waren ebenfalls angemessene Themen, denn »der Liebhaber der Geschichte und des völkischen Lebens wird dabei auf seine Rechnung kommen«.37 Hauptzweck der mit der Malerei verwandten Architektur sollte die Hervorhebung des Monumentalen in der Staatsidee des Nationalsozialismus sein, eine weitere Variante des Heldenthemas.38
Die Literatur diente vergleichbaren Zwecken: Bücher konnten beispielhafte Darstellungen rassisch erwünschten Verhaltens bieten. An die Stelle des Expressionismus und Naturalismus vergangener Zeiten sollte ein »völkischer« oder »heroischer« Realismus treten, gegründet in »Blut und Boden« und der germanischen Vergangenheit. Vermeintliche Existenzfragen Deutschlands hatten in Roman und Novelle im Zentrum zu stehen: die Liebe zum Land und zum Siedlertum, familiäre Werte, wie sie die Deutsche Frau verkörperte – das ewige Sinnbild für Tugend, Bescheidenheit und Fleiß, die Hüterin des Blutes, immer bereit, den kampfbereiten männlichen Beschützer zu unterstützen.39 Für derlei war der historische Roman das geeignete Genre, der von den prähistorischen Wikingern erzählte, von Hermann dem Cherusker, der die Römer besiegte, und von Widukind, der Karl dem Großen Widerstand leistete. Erzählen ließ sich auch von den Bauernkriegen, von Heinrich dem Löwen, Baron vom Stein, deutschen Erfindern und Gelehrten und natürlich vom Ersten Weltkrieg und dem »Dolchstoß« des Jahres 1918.40
Und wie mochte die Musik zur politischen Kultur der nächsten tausend Jahre beitragen? Musik ist, so der New Yorker-Kritiker Alex Ross, »immer in der Welt, ist weder schuldig noch unschuldig, sondern Gegenstand der ständig sich wandelnden menschlichen Landschaft, in der sie sich bewegt«.41 Folgt daraus politische Neutralität? Ihrer Struktur nach ist Musik – so viel ist klar – am wenigsten zu ideologischer Kommunikation geeignet, es sei denn, es handelt sich um ein Opernlibretto oder einen Liedtext. Nur in dieser Hinsicht konnten Komponisten und Dichter zusammenwirken. So musste Friedrich W. Herzog, ein Gefolgsmann Alfred Rosenbergs, hohl klingen, wenn er eine Musik forderte, »die erfüllt ist von der Ausdrucksgewalt der nationalsozialistischen Idee. Als revolutionäre Musik wird sie dem Fortschritt dienen, als nationale Musik wird sie neu sein, und als sozialistische Musik wird sie in das Herz eines jeden Volksgenossen, ohne Rücksicht auf Alter, Stand und Geschlecht, dringen und verstanden werden.«42 Der vorsichtigere Goebbels war indes nicht bereit, die Musik in die patriotische Pflicht zu nehmen, sondern wollte nur, dass die Welt das Monopol der deutschen Musik anerkannte.43 Aber die Musik konnte Gefühle beeinflussen und hatte damit, etwa bei politischen Veranstaltungen oder im Radio, durchaus emotionalen Wert.44
Rechnet man auch Radio und Presse zu den Kulturgattungen, eröffneten sie den direktesten propagandistischen Zugang zu den Massen. Sofern die NS-Führer sich nach der Machtergreifung als Revolutionäre empfanden, betrachteten sie den Rundfunk als revolutionären Akt par excellence. Und sofern sie sich als modern empfanden, war das Radio die Innovation ihrer Wahl – das Instrument ideologischer Indoktrination und Kontrolle schlechthin, einsetzbar für Ansprachen und andere nicht-musikalische Sendungen wie Hörspiele und Reportagen zu aktuellen Ereignissen. Überdies konnte Musik, wie der Film, Hitlers Untertanen aufmuntern und für künftige Schlachten stählen, dasselbe galt für entsprechend zugeschnittene Wortbeiträge: Quiz, Humor, bunt Gemischtes und natürlich Sportreportagen. Im Unterschied zu Drama und Oper – der Unterhaltung für die Oberschichten – und dem Film – der hauptsächlich die Unterschichten amüsierte – war das Radio ein klassenüberschreitendes Medium.45
Und schließlich die Presse. Angesichts einer weitgehend alphabetisierten deutschen Bevölkerung übertraf die Reichweite der Printmedien die des Radios, zumal sich einzelne gesellschaftliche Gruppierungen damit noch treffsicherer ansprechen ließen und letztlich fast jede Zielgruppe erreicht werden konnte. Die Bandbreite war groß, reichte von Parteizeitungen mit deftigen Slogans bis zu elegant formulierten politischen Herleitungen, deren Logik auch den Hochgebildeten einleuchten sollte. Die Presse konnte Kunst abbilden, Kapitel aus der hohen Literatur oder scheinbar Unverfängliches mit einer verborgenen ideologischen Bedeutung bringen. Zudem zeigte der Nürnberger Gauleiter Julius Streicher mit seinem rüden antisemitischen Kampfblatt Der Stürmer schon früh, wie man mit hämischen Karikaturen von deutschen Juden Hass säte.46