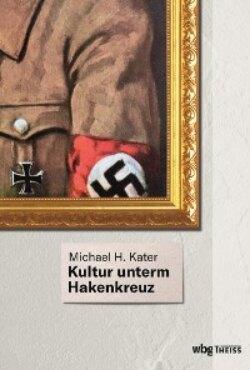Читать книгу Kultur unterm Hakenkreuz - Michael Kater - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Kapitel 2
Nationalsozialistische Vorkriegskultur
ОглавлениеB evor wir das Wesen der NS-Kultur vor dem Krieg bestimmen, müssen einige Fragen hinsichtlich der Natur des Dritten Reiches geklärt werden. Zum einen sollten die Regierungs- und Verwaltungsstrukturen klarer definiert werden, innerhalb derer die Nationalsozialisten in die Kultur eingriffen, indem sie entweder ästhetische Maßstäbe wiederbelebten oder neue einführten. Zum anderen wäre es von Nutzen, mehr über Hitlers eigene Rolle zu wissen: Wie interessiert war er an kulturellen Angelegenheiten, und wie groß war sein Einfluss auf Veränderungen?
Die internationale Debatte um die Struktur des sogenannten Dritten Reichs und Hitlers Rolle darin begann vor gut 50 Jahren und ist als gedankliche Grundierung bis heute von Bedeutung. In den sechziger Jahren kennzeichnete Karl Dietrich Bracher den nationalsozialistischen Staat als autoritäres System; Partei und Staat seien Instrumente der »totalitären Herrschaft« gewesen, die Hitler aus einer Position der »Allmacht« heraus miteinander verbunden habe. »Die nationalsozialistische Doktrin«, schrieb Bracher, »bemächtigte sich der Kultur und der Werte der deutschen Gesellschaft.«1 Diese Theorie der Alleinherrschaft fand Unterstützung durch Eberhard Jäckel, der Hitler als die zentrale, treibende Kraft in der Diktatur ansah, deren Verwirklichung sich logisch aus zwei starken persönlichen Impulsen Hitlers im Gefolge des Jahres 1919 ergeben habe: dem Wunsch nach Eroberung von »Lebensraum« für die »Volksgenossen« (nach der notwendigen Revision des Versailler Vertrags) und nach physischer Vernichtung der Juden.2
Gegen diese monolithischen Ansätze entwickelte Hans Mommsen in den siebziger Jahren eine differenziertere Interpretation, die soziale, wirtschaftliche und psychologische Faktoren, ja, sogar den Zufall für die Entstehung der Diktatur berücksichtigte. Bereits Mitte der sechziger Jahre hatte Mommsen Hitler als »schwachen Diktator« bezeichnet, was er in den frühen achtziger Jahren durch den Aufweis divergierender Strukturen ausführte: Es gab Rivalitäten zwischen Staatsapparat und Partei, bei denen Ämter einander auszustechen suchten und Beamte alle möglichen Anstrengungen unternahmen, um Konkurrenten aus dem Felde zu schlagen.3 Mommsen schilderte miteinander konkurrierende Führungsstrukturen auf unterschiedlichen Ebenen ohne klare hierarchische Abgrenzungen, mangelhafte bis fehlende Koordination und Situationen der Entscheidungslosigkeit, in denen es Hitler nicht gelang, seine Machtbefugnisse als »Führer« durchzusetzen. Es gab, so Mommsen, eine »Polykratie der Ressorts«, die für ein regierungseigenes Chaos sorgte, verschärft noch durch Hitler, der gewöhnlich keine endgültigen Entscheidungen fällte. Dieses System reproduzierte sich, bis es einen Punkt kumulativer Radikalisierung überschritten hatte. Wenn Hitler überhaupt einmal in regierungs- oder verwaltungsbezogene Vorgänge eingriff, schrieb Mommsen, ging es ihm in der Regel darum, Einhalt zu gebieten. Allerdings konnte er auch Initiativen in Gang setzen, um dann zu beobachten, wie das Chaos sich entwickelte. Seine eigene Position indes durfte dadurch nicht gefährdet werden.4 Wie aber konnte, fragte der Bracher-Schüler Manfred Funke, in einem derart selbstzerstörerischen System die »politische Energie« gewonnen und bewahrt werden, die notwendig war, um die Nation voranzubringen?5
In jüngerer Zeit hat Ian Kershaw eine Synthese zwischen dem »intentionalistischen« Ansatz von Bracher und Jäckel und der »funktionalistischen« Schule von Mommsen entwickelt. In seiner früheren Forschung hatte Kershaw sich auf den von ihm so genannten Hitler-Mythos konzentriert und war zu der Auffassung gelangt, dass die führenden Nationalsozialisten im Staats- und Parteiapparat ihre Arbeit so einrichteten, dass dem Anschein nach jeder, gleichgültig welcher Agenda er folgte, »dem Führer entgegen arbeitete«. In einem 1987 erschienenen Buch erklärte Kershaw den Führermythos zu einem funktionalen Herrschaftselement, vergleichbar einer Aura, die Hitler »zu den beschränkten selbstsüchtigen und materiellen Interessen auf Distanz hielt«, die für die Staatsbeamten und Parteifunktionäre typisch waren und von Mommsen bereits geschildert worden waren. Diese Aura, die insbesondere Goebbels im Rahmen seiner Propagandaarbeit fabrizierte, habe mit ihrer radikalisierenden Dynamik bis weit in den Krieg hinein aufrechterhalten werden können. Und so habe Hitler, keineswegs ein »schwacher Diktator«, um 1935 in seinem Reich als starker Mann gegolten, der die Wirtschaft wieder in Schwung und die unbeherrschte SA unter Kontrolle gebracht, die geheiligten Traditionen der beiden christlichen Kirchen geschützt, in der Außenpolitik deutsche Rechte verteidigt, militärische Führungskraft gezeigt und sich nicht zuletzt gegen die vermeintliche Bedrohung durch Juden und Kommunisten behauptet habe. Korruption und Amtsvergehen in der Staats- und Parteibürokratie seien in der Bevölkerung als etwas betrachtet worden, das Hitler, hätte er davon gewusst, unterbunden hätte. Hitlers mutmaßliche Stärke, argumentierte Kershaw, wurde angesichts der relativen Schwäche seiner Untergebenen von den gewöhnlichen Deutschen akzeptiert, da viele noch glaubten, dass rein theoretisch ein persönlicher Appell an den Führer außerhalb der vorgeschriebenen Dienstwege möglich wäre. Eine solche Interpretation der NS-Herrschaft zeichnete also das Bild eines starken Diktators, der zumindest bei jener Mehrheit als stark galt, die Goebbels zum Glauben an den »Hitlermythos« hatte bewegen können. Zusätzliche Stärke gewann Hitler, indem er am Mythenbau mitwirkte. »In dem von ihm gezeichneten öffentlichen Bild konnte sich Hitler im Dritten Reich in einer positiven Rolle darstellen, indem er beschränkte Interessen und Beschwerden durch das alles überwölbende Ideal nationaler Einheit transzendierte. Ermöglicht wurde dies durch die notwendige Distanz zum ›Konfliktbereich‹ der Tagespolitik, so dass er von den unpopuläreren Aspekten des Nationalsozialismus unberührt blieb.«6
In seiner beeindruckenden zweibändigen Hitler-Biographie arbeitete Kershaw Ende der neunziger Jahre den »Führermythos« und seine Funktionen noch weiter aus. Die Choreographie in Hitlers Führerstaat sah vor, dass die Akteure, die schon Mommsen und seine Vorgänger erkannt hatten – Regierungsbeamte, Parteifunktionäre und Hitler selbst – nach einem einmal erprobten und dann beliebig oft wiederholten Muster zusammenwirkten. Kershaw erklärt: »Hitlers personalisierte Herrschaftsform ermutigte seine Anhänger zu radikalen Initiativen von unten und bot solchen Initiativen Rückendeckung, solange sie mit seinen grob definierten Zielen auf einer Linie lagen. Dadurch wurde auf allen Ebenen des Regimes eine scharfe Konkurrenz gefördert – zwischen verschiedenen Ämtern ebenso wie zwischen einzelnen Beamten oder Funktionären innerhalb dieser Ämter. Wer im darwinistischen Dschungel des Dritten Reiches befördert werden und zu einer Machtposition gelangen wollte, mußte den ›Führerwillen‹ erahnen und, ohne auf Anweisungen zu warten, die Initiative ergreifen, um das voranzutreiben, was den Zielen und Wünschen Hitlers dienlich erschien.« In einem derart personalisierten, auf Hitler zugeschnittenen Herrschaftssystem, erreichte derjenige am ehesten sein Ziel, der den sichersten und direktesten Zugang zum »Führer« hatte.7 So ließ sich auch ein privates Vorgehen gewöhnlicher »Volksgenossen«, etwa eine Denunziation bei der Gestapo, ungeachtet der Motive der Denunzianten als vorauseilender Gehorsam verstehen.8 »Sie halfen dadurch, eine unaufhaltbare Radikalisierung voranzutreiben, die zur allmählichen Herausbildung konkreter, in der ›Mission‹ des Führers verkörperter, politischer Ziele führte.«9 (Diese Radikalisierung zeigte sich im Krieg in verschiedenen Extremen: in den frühen Blitzsiegen, der von den Nazis gewollten Grausamkeit des Ostfeldzugs, Hitlers erratischen Entscheidungen als oberster Befehlshaber, der widerwärtigen Brutalität im Umgang mit sowjetischen Kriegsgefangenen, dem zunehmenden Terror im Justiz- und KZ-System und vor allem in der Verfolgung der Juden.) Kershaw gelang die Synthese: Er berücksichtigte das Umfeld und die Akteure unterhalb der Führungsspitze, setzte aber Hitler erneut in den Mittelpunkt des Narrativs über das politische Handeln im Dritten Reich. In letzter Instanz, so bekräftigte auch Volker Ullrich in seiner Hitler-Biographie, beanspruchte der Führer das »alleinige Recht« der Entscheidung bei »grundlegenden Problemen«.10
Anhand von Kershaws Modell kann die Frage nach Hitlers Rolle dort, wo die Kultur betroffen war, neu gestellt werden. Vor ihrer Beantwortung gilt es jedoch zuerst festzulegen, nach welchen Kriterien Hitler als Kulturmensch beurteilt werden soll. Ferner wollen wir uns vergewissern, welche kulturellen Leistungen das NS-Regime wenigstens in der Zeit vor dem Krieg aus eigener Kraft zu vollbringen imstande war. Von getreuen Anhängern, aber auch von einigen Historikern ist Hitler als Genie bezeichnet worden. Wir müssen fragen, ob sich das auf seine frühe Rolle als Künstler und seine spätere Beschäftigung mit Kunst und Kultur, wie sie im Dritten Reich beobachtet werden konnte, beziehen lässt.
Wenn Hitler Genie besaß, dann nur in der Politik. Entscheidend dafür war sein intuitiver Umgang mit den Menschen, deren Gefühle er fast absolut zu beherrschen verstand. »Hitler war mit Instinkt gesegnet, er erschnüffelte die Menschen wie ein Hund.« So hörte ich es von Otto Strasser, dem Kampfgenossen Hitlers aus den späten zwanziger Jahren, im Frühjahr 1978, ein paar Monate vor seinem Tod.11 Goebbels, der damals mit Otto und dessen Bruder Georg eng zusammenarbeitete, ihnen sogar untergeordnet war, hat, wie seine Tagebücher verraten, offensichtlich ebenfalls an die intuitiven Fähigkeiten des Führers geglaubt. Hitlers »große Begabung war allein die Politik«, schreibt Ullrich. »In seiner Fähigkeit, Situationen blitzschnell zu analysieren und auszunutzen, war er nicht nur den Rivalen in der NSDAP, sondern auch den Politikern der deutschen Mainstream-Parteien überlegen. Nur so lässt sich erklären, warum er aus allen innerparteilichen Krisen, die es bis 1933 gab, als Sieger hervorgehen konnte.«12
Abgesehen von diesem außerordentlichen Talent für Politik verfügte Hitler noch über andere Begabungen, wenn auch nicht im selben Ausmaß. Er war überdurchschnittlich intelligent und verfügte über ein beeindruckendes Gedächtnis, allerdings nur auf Gebieten, die er interessehalber pflegte (so wie er nur Gefolgsleute tolerierte, die erkennbar »dem Führer entgegen arbeiteten«). Im Frühsommer 1939 erinnerte sich der Musikliebhaber Hitler beispielsweise daran, wie er »am 29. Juni 1932 im Konzertsaal des Bayrischen Hofes« in München den Bass-Bariton Hans Hotter die beiden Arien des Hans Sachs aus Wagners Die Meistersinger von Nürnberg singen hörte.13 Zahllos sind die Gelegenheiten, bei denen Hitler winzige Details militärischer Ausrüstungsgegenstände oder Automobile memorierte; seit dem Ersten Weltkrieg erweiterte er seine militärischen Kenntnisse ständig. Zudem war er ein fanatischer Liebhaber von Autos, der Mercedes bevorzugte (und später alles, was Ferdinand Porsche vorschlug).14 Ganz so neu war das indes nicht, hatte doch Kaiser Wilhelm II. seine Zeitgenossen auf ähnliche Weise in Erstaunen versetzt, gleichfalls durch militärisches Wissen, insbesondere die Marine betreffend. Aber Hitler war auch mit den Grundlagen von Carl von Clausewitz’ philosophisch inspirierter Militärtheorie vertraut und kannte manches auswendig, wenngleich Clausewitz’ Einsichten für Strategien des 20. Jahrhunderts nicht mehr recht brauchbar waren.15
Tiefere Einsichten in Bildung und Gelehrsamkeit blieben Hitler verschlossen; eingedenk seines fehlgeschlagenen Ausbildungsgangs hasste er Lehrer und Universitätsprofessoren (was erklären mag, weshalb er später, scheinbar paradoxerweise, viele Professoren selbst ernannte, nur um diese Lakaien später mit Verachtung zu strafen). Als Autodidakt konnte er sich seine Wissensgebiete selbst wählen, aber die Wirtschaft gehörte nicht dazu, auch wenn er während seiner gesamten politischen Laufbahn immer wieder Halbwahrheiten von sich gab.16 Der Harvard-Absolvent Ernst Hanfstaengl (seit 1919 mit Hitler befreundet, NSDAP-Mitglied, Geschäftsmann und Hobbypianist) entdeckte in Hitlers erster bescheidener Wohnung in München eine bemerkenswerte Bibliothek mit Büchern über Geschichte, Geographie, auch Philosophie, etwa Werke Schopenhauers. Vieles fand sich später in Form von Zweitexemplaren in Hitlers komfortabler Landsberger Gefängniszelle. Sein historisches Interesse bezog sich, was nicht überrascht, neben der griechischen und römischen Antike vor allem auf die deutsche Geschichte und hier besonders auf den Lebensweg des Preußenkönigs Friedrich II. Seine »rassenkundliche« Bildung fußte auf Houston Stewart Chamberlain, Paul de Lagarde und Hans F. K. Günther. Die Belletristik war in seinem Münchner Schlafzimmer nicht vertreten, aber er war mit einigen modernen Dramen, etwa von Wedekind und Ibsen, vertraut (Letzteres sicherlich, weil sein zeitweiliger Mentor, Dietrich Eckart, Peer Gynt übersetzt hatte). Ansonsten bevorzugte er Detektivgeschichten und leichtere Sachen, populäre und satirische Geschichten à la Ludwig Thoma und – seit seiner Jugend – die Wildwestromane von Karl May.17
Hitler bewunderte Schauspieler und liebte es, sich Filme anzuschauen, vor allem die Höhepunkte aus Produktionen der konservativen Ufa, die zum Konzern des Magnaten Alfred Hugenberg gehörte. Zu seinen Lieblingen unter deutschen Filmstars zählte zum Beispiel Henny Porten; aber auch gewisse amerikanische Filme fanden sein Gefallen, und er war, wie Goebbels, ein großer Fan von Greta Garbo. Bis zum Kriegsbeginn ließ er sich privat regelmäßig Filme vorführen, und zwar, wie im vorigen Kapitel erläutert, häufig mit Blick auf Propagandazwecke. Nach einiger Zeit konnten viele deutsche Filmstars Hitler ihren Freund nennen.18 Im Theater war Hitler zwar seltener zu finden, gleichwohl schätzte er die Bühne. Er verfolgte aufmerksam die schauspielerische Darbietung bei seinen Lieblingsoperetten und sah gern seine Lieblingsschauspieler wie Emil Jannings, wo immer sie gerade auftraten: in München, Berlin oder Weimar. Die Schauspielerei war ihm wichtig, und er selbst beherrschte sie – für politische Zwecke – in durchaus beachtlicher Weise, wenn er zu den Massen sprach. Noch in den ersten Jahren seiner Herrschaft übte er vor einem Spiegel Haltungen und Gesten ein und verfeinerte sein Auftreten als Redner.19
Hitlers Liebe zur Musik konzentrierte sich in erster Linie auf Wagner, dessen Opern er während seiner Jugend in Linz und Wien erstmals gehört hatte. Seine Kenntnisse sollte er später in München und anderswo noch vertiefen. Schon 1919/20 hatte er Ernst Hanfstaengl vorgeführt, dass er Arien summen oder pfeifen konnte: aus den Meistersingern, Lohengrin und (wie Thomas Mann, der aber das Klavierspiel bevorzugte) Tristan und Isolde. Gleichzeitig mochte er, der aus bescheidenen Verhältnissen kam, die leichte Muse wie den Badenweiler Marsch, zudem Operetten, besonders Franz Lehárs Die lustige Witwe und Johann Strauss’ Die Fledermaus. (Er nahm Lehár, trotz dessen jüdischer Frau, bis zum Ende des Regimes in Schutz.)20 In der Titelrolle des Danilo (Tenor) aus der Lustigen Witwe gefiel ihm der beliebte und umschwärmte holländische Sänger Johannes Heesters am besten.
Später scheint Hitler auch die Musik Anton Bruckners geschätzt zu haben (eine Neigung, die er höchstwahrscheinlich überbetonte, weil der Komponist ebenfalls aus Linz stammte), doch nie all jene Komponisten, die ihm Goebbels ans Herz legen wollte: Schubert, Brahms, Mozart, nicht einmal den Heros Beethoven.21 Alles in allem hatte Hitler »kaum wirkliches Interesse an oder Verständnis für Musik«.22
Hitler liebte Wagner nicht zuletzt deshalb, weil dessen Opernkompositionen als »Gesamtkunstwerk« dem Diktator Anknüpfungspunkte für seine Karriere als Demagoge boten: ein handlungsstarkes Drama, das seinem Faible für Pathos und Ideologie entgegenkam, eine Bühne für Gesang und Schauspiel oder Reden an das Volk, und eine Szenerie, die durch Farbigkeit und Form Eindruck schinden konnte. Solche visuellen Effekte passten zu Hitlers eigenen Vorlieben: Malerei und Architektur. Seine oft bekundete Selbsteinschätzung als Künstler leitete sich von den eher anspruchslosen Versuchen als Maler im Wien seiner Jugendjahre und dann in München her, bis er sich mit Beginn des Ersten Weltkriegs der bayerischen Armee anschloss. Seine malerischen Fähigkeiten gingen über Dilettantismus nicht hinaus; zwei Mal wurde seine Bewerbung von der Wiener Kunstakademie abgelehnt. Aus solchen Unterfangen einen Geniekult abzuleiten – wie Hitler es tat –, hieße, die Tatsachen außer Acht zu lassen.23 Das gilt gleichermaßen für die Architektur: Hitlers Interesse daran hing mit Gebäudeskizzen zusammen, die er in Wien und als Soldat an der Westfront in Belgien und Frankreich angefertigt hatte; später kam noch die Beschäftigung mit Innenarchitektur hinzu. Hitlers gelegentlich, vor allem während des Zweiten Weltkriegs geäußerte Bemerkungen, er wünsche sich nichts sehnlicher, als zum Künstlerleben zurückzukehren, waren Selbsttäuschung und zielten darauf, Geniekult-Gläubige zu beeindrucken.24
Auf jeden Fall steht Hitlers künstlerisches Schaffen in keinem Zusammenhang mit den neuen Bewegungen der Moderne, die sich gegen Ende des 19. Jahrhunderts in Deutschland und Österreich entwickelten. Die Wiener und die Berliner Secession ließen ihn kalt; er blieb dem Geschmack der Spätromantik verhaftet, wie er von deutschen und österreichischen Künstlern – Adolph von Menzel, Hans Makart, Anselm Feuerbach, Carl Spitzweg, Arnold Böcklin, Eberhard von Grützner und anderen – praktiziert wurde. In der Architektur bewunderte er den Neoklassizismus eines Karl Friedrich Schinkel und Gottfried Semper, dem er mit immer neuen Skizzen nachzueifern trachtete. Während seiner Herrschaft bevorzugte und unterstützte Hitler Künstler, die im Sinne dieser Meister malten.25 Doch welche Bedeutung hatte Hitlers von kleinbürgerlichem Geschmack geprägte Interesse an bildender Kunst, Musik, Theater und Film für die Kultur als Ganzes im sogenannten Dritten Reich?