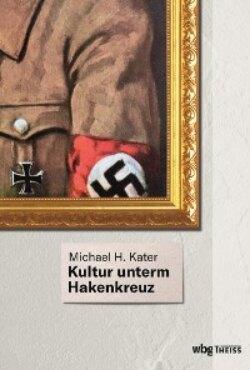Читать книгу Kultur unterm Hakenkreuz - Michael Kater - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
»Entartete« Kunst und Musik werden ausgestellt
ОглавлениеIn der Ausstellung »Entartete Kunst«, die am 19. Juli 1937 in München eröffnet wurde, war Emil Nolde mit mehr als 50 Arbeiten vertreten, Ernst Ludwig Kirchner mit 32, nachdem bereits mehr als 600 seiner Gemälde aus öffentlichen Museen entfernt und beschlagnahmt worden waren. Von Barlach waren die Bronzeplastik Die Wiedervereinigung und das verbotene Buch mit Zeichnungen zu sehen, ausgestellt in einem Glaskasten mit anderen verbotenen Objekten und etikettiert als »Kulturschänder«. Barlach beschwerte sich darüber, dass aus dem Buch einige Seiten herausgeschnitten und separat zur Schau gestellt worden waren – das hielt er für unfair, weil sie nicht das ganze Buch repräsentierten.154
Die treibende Kraft hinter dieser Ausstellung war Joseph Goebbels, der schon seit einiger Zeit hatte erkennen müssen, dass Rosenberg mit seinen erzreaktionären, modernefeindlichen Ideen ihn in Hitlers Anwesenheit ausstach. Was die Kunst anbetraf, stimmte Hitler mit Rosenbergs Vorstellungen überein, auch wenn er dessen pompöses Gehabe verachtet haben mochte. Um nicht ins Hintertreffen zu geraten, musste Goebbels zumindest den Eindruck erwecken, diesen kulturpolitischen Kurs mitzumachen, während er zugleich seine eigenen, viel wirksameren administrativen Instrumente in Stellung brachte. So riss er in der ersten Hälfte des Jahres 1937 die Initiative wieder an sich und ließ sich von Hitler dazu autorisieren, eine Ausstellung mit »entarteter Kunst« auf den Weg zu bringen. Vorbilder waren die früheren Schandschauen in Karlsruhe, Stuttgart und Nürnberg. Goebbels sah in dem Projekt ein geeignetes politisches Manöver, um Rosenberg kaltzustellen. Am 30. Juni gab er Adolf Ziegler, dem Präsidenten der Reichskammer der bildenden Künste in der – sicher beim Propagandaministerium angesiedelten – RKK, den Auftrag, entsprechende Objekte zusammenzustellen.155
In seiner Eröffnungsrede zur Ausstellung bekannte Ziegler, dass das eine Mammutaufgabe gewesen sei, weil er dazu »fast sämtliche deutsche Museen« habe besuchen müssen.156 Zur Unterstützung hatte er eine aus fünf Mitgliedern bestehende Kommission gebildet, der außer ihm selbst unter anderen der ehrgeizige Graf Baudissin vom Essener Folkwang-Museum und der Kunstpolitiker Wolfgang Willrich angehörten. Letzterer hatte mit Säuberung des deutschen Kunsttempels gerade erst eine giftige Hetzschrift verfasst. Angeblich in Hitlers Auftrag wollte die Kommission Werke beschlagnahmen, die nach 1910 entstanden waren – dem Jahr, in welchem Kandinsky das erste abstrakte Gemälde überhaupt ausgestellt und Herwarth Walden die Maßstäbe setzende expressionistische Zeitschrift Der Sturm gegründet hatte.157 Die hauptsächlich betroffenen Museen standen in Frankfurt, Dresden, Düsseldorf und Berlin. (Bernhard Rust, der rechtlich zuständige Minister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung, gab nur zögernd seine Zustimmung.) Die Kommission konfiszierte etwa 5000 Gemälde und 12 000 Drucke; schließlich wurden rund 500 Kunstwerke von insgesamt 112 missliebigen Künstlern für die Ausstellung ausgewählt. Die Werke fielen, grob gesprochen, unter die Stilrichtungen Expressionismus, Verismus und Dadaismus – die Hauptströmungen der Moderne, die sich durchaus überschneiden konnten. Legendäre Kunstbewegungen wie Die Brücke und Der blaue Reiter waren betroffen, führende deutsche Künstler wie Kirchner, Pechstein und Beckmann die unmittelbaren Opfer. Aber Ziegler richtete sein Augenmerk auch auf die Werke ausländischer Maler wie Picasso, Matisse, Munch und Chagall, um deren Renommee ebenfalls in den Schmutz zu ziehen.158
Nachdem Hitler und Goebbels drei Tage zuvor die Objekte begutachtet hatten, wurde die Ausstellung am Montag, dem 19. Juli 1937, im Münchner Archäologischen Institut eröffnet. Die gesamte deutsche Presse, auch die ehemals bürgerlichen Blätter, die nun den Propaganda-Richtlinien vom November 1936 unterlagen, schäumte vor Entsetzen. »Eisenbahnzüge voll Schmutz« hätten sich in die Museumsräume ergossen, schrieb die einst ehrenwerte Deutsche Allgemeine Zeitung; »Magazine und Keller haben sich geöffnet, um ihren Unrat auszuspeien«, ließ der Münsterische Anzeiger in schrillem Ton verlauten.159 Das NS-Organ National-Zeitung aus Essen, Graf Baudissins Hochburg, gab ironischerweise unwillentlich die ursprünglichen Intentionen der Expressionisten wieder, als es konstatierte, dass deren Bilder den Betrachter »durch ihre Farben buchstäblich anschreien und durch die Verzerrung der Linien, durch die Dekadenz des Ausdrucks uns mit Schrecken erfüllen«.160 Die Organisatoren hatten ihr Bestes getan, um die Gemälde auf möglichst unvorteilhafte Weise zu präsentieren, indem sie sie schief und zu dicht, teilweise bis auf den Boden herab hängten, in roh zusammengezimmerten Holzrahmen161 – und »in schlechtem Licht«, wie Nolde festhielt. »Grelle, rote Zettel mit boshaften Sprüchen« hätten überall herumgehangen.162 Perfiderweise war hier und da der Preis angegeben, den eine öffentliche Institution für den Ankauf – aus Steuermitteln – ausgegeben hatte: Abertausende an Mark, was die Betrachter schockieren sollte. Ungesagt blieb dabei, dass es sich um Beträge aus der Inflationszeit handelte, als man mit 10 000 (Papier-)Mark nicht einmal einen Laib Brot kaufen konnte.163
Auf jeden Fall war die Ausstellung populär.164 Bevor sie auf Tour ging, hatten über zwei Millionen Männer und Frauen – Minderjährigen war der Zutritt verboten – überwiegend zustimmend die »Entartete Kunst« besucht. Der Eintritt war frei.165 Eigentlich sollte sie bis Ende September dauern, wurde dann aber bis Ende November verlängert.166 Die Wirkung dieser entwürdigenden Zurschaustellung auf die betroffenen Künstler war natürlich verheerend, auch wenn einige, etwa die Erben des Bildhauers Wilhelm Lehmbruck, die Exponate nach einiger Zeit zurückerhielten.167 Karl Hofer indes trauerte noch Ende 1943 sechzig Gemälden allein aus seinem Berliner Atelier nach.168
Als die Ausstellung auf Deutschlandreise ging, wurde ihr zur Einführung eine vom Propagandamuseum autorisierte Broschüre beigegeben. Ein gewisser Fritz Kaiser aus München169 erläuterte darin die Kriterien, nach denen die Exponate zu »Gruppen« zusammengestellt worden waren. Die erste Gruppe stand unter dem Motto Form und Farbe – zentrale Thematiken der expressionistischen Kunst. Hier monierte Kaiser die »absolute Dummheit der Stoffwahl« und die »bewusste Verachtung aller handwerklichen Grundlagen«.170 In der zweiten Gruppe hielt Kaiser Künstlern wie Nolde und Barlach vor, sie hätten religiöse Gefühle verletzt – angesichts des Umstands, dass der totalitäre Staat im gleichen Zeitraum beide christlichen Kirchen bekämpfte, ein lächerliches Argument.171 Mit der dritten Gruppe unternahm es Kaiser, den »politischen Hintergrund« der Ausstellung zu beleuchten – »künstlerische Anarchie« habe hier das Zepter geschwungen, und das Ziel sei »Klassenkampf im Sinne des Bolschewismus«.172 Als wenn alle Avantgardekünstler in der Weimarer Republik linksextrem gewesen wären! Pazifistische Tendenzen bildeten den Schwerpunkt der vierten Gruppe; hier sah der Betrachter von Otto Dix und George Grosz gemalte Kriegskrüppel.173 Gruppe fünf präsentierte Kunstwerke als Bordellmalereien; von den Künstlern hieß es: »Die Menschheit setzt sich für sie aus Dirnen und Zuhältern zusammen.« Hier waren Überschneidungen mit der dritten Gruppe nicht zu verkennen.174 Die Gruppen sechs und sieben warfen Licht auf die Bedeutung der »Rasse« insbesondere in Verbindung mit Fragen der Eugenik: Das geistige Ideal der modernen Kunst seien »der Idiot, der Kretin und der Paralytiker« gewesen. Gleichermaßen wurden Darstellungen von »Negern und Südseeinsulanern« à la Gauguin verurteilt.175 In der achten Gruppe war der Betrachter mit der sogenannten Judenfrage konfrontiert; beispielhaft dafür standen die Bilder jüdischer Künstler wie Otto Freundlich und Ludwig Meidner (in Kaisers Broschüre auf S. 21 dargestellt).176 (Bei der hastigen Planung der Ausstellung hatten die Organisatoren übersehen, dass es kaum deutsche Juden in den bildenden Künsten gab, weshalb sie Ausländer wie Chagall einbezogen. Ansonsten musste der sprichwörtliche jüdische Kunsthändler als Schreckgespenst herhalten. Max Liebermann, der 1935 gestorben war, blieb verschont, vielleicht wegen seiner allzu großen Berühmtheit.) Die neunte Gruppe schließlich, die letzte, sah ihr Angriffsziel im Begriff der Abstraktion in Form von »Ismen«, demonstriert an Werken des Bauhausnahen Johannes Molzahn und des Dadaisten Kurt Schwitters.177 Die Broschüre brachte dann einen Auszug aus Hitlers Eröffnungsrede im Haus der Deutschen Kunst, die er einige Stunden vor Beginn der Ausstellung »Entartete Kunst« gehalten hatte.178 Zum Ende gab es einen Vergleich zwischen zwei modernen Graphiken mit der Zeichnung eines Psychiatriepatienten; Grundlage hierfür bildeten offensichtlich Schultze-Naumburgs Beispiele von 1932. Welche Graphik von den dreien, lautete die Rätselfrage, ist die Arbeit des Dilettanten? »Die rechte obere! Die beiden anderen dagegen wurden einst als meisterliche Graphiken Kokoschkas bezeichnet.«179
Dass es »Gruppen« gab, in denen Juden und Marxisten angeprangert wurden, war für die Zeitgenossen keine Überraschung. Aber die Fokussierung auf die Kranken, insbesondere die geistig Erkrankten, war eine relativ neue Wendung in dieser »deutschen« Kultur, auch wenn Schultze-Naumburg und Hitler öffentlich bereits häufiger die Verbindung zwischen moderner Kunst und Geisteskrankheit betont hatten. Adolf Ziegler kam in seiner Eröffnungsrede darauf zu sprechen, und die Zeitungen lieferten pflichtschuldigst entsprechende Kommentare ab. Das Hamburger Tageblatt vermerkte voller Abscheu »krankhafte Erscheinungen und Scheußlichkeiten«.180 Schon seit Mitte 1937 war das Regime mit Vorbereitungen für das beschäftigt, was es dann »Euthanasie« nennen sollte: die zwangsweise Tötung von Patienten in psychiatrischen Einrichtungen, an die die Bevölkerung sich gewöhnen sollte. Bereits jetzt wurden die sogenannten Rheinlandbastarde sterilisiert – Kinder unerwünschter Verbindungen zwischen deutschen Frauen und, wie man annahm, farbigen Soldaten aus den französischen Kolonien, die als Angehörige der Besatzungstruppen nach dem Ersten Weltkrieg im Rheinland stationiert waren.181 Ein Gelehrter, dem die Beziehung zwischen moderner Kunst und Geisteskrankheit einleuchtete, war Professor Carl Schneider, der an der Universität Heidelberg die angegliederte psychiatrische Klinik leitete. 1939 – die Ausstellung war noch auf Deutschlandtour – behauptete er in einem Vortrag zum Thema, die verfemte Kunst sei wahrhaft krank. Schneider unterstützte die »Euthanasie«-Politik des Regimes und brachte sich nach dem Krieg in einem amerikanischen Militärgefängnis um.182
Die Ausstellung »Entartete Kunst« wanderte von München nach Berlin, dann weiter nach Leipzig, Düsseldorf, Salzburg, Hamburg und machte sogar in kleineren Orten wie Weimar halt. In Berlin wurden zusätzlich Werke von Heidelberger Psychiatriepatienten gezeigt, um das Publikum mittels Vergleichen zu Hohn und Spott anzuregen. In Düsseldorf sollen Schätzungen zufolge bis Mitte Juli 1938 einige Hunderttausend Besucher die Exponate gesehen haben, und selbst in Kleinstädten wie Stettin hatte man bis Anfang 1939 rund 75 000 Personen gezählt.183 Als die Tour 1941 wegen des Krieges abgebrochen wurde, hatten auch in anderen Gemeinden mehrere Hunderttausend Besucher die Ausstellung gesehen. Abgesehen von der denunziatorischen hatte die Ausstellung auch eine abschreckende Funktion: Niemals mehr sollte entartete Kunst eine »gesunde« deutsche Kultur korrumpieren.184
Zu diesem Zweck wurde die Gesetzgebung kontinuierlich um neue Möglichkeiten für Beschlagnahme und Boykott erweitert. Noch im August 1937 beauftragte Göring in seiner Funktion als Preußischer Ministerpräsident Erziehungsminister Rust damit, alle Museen nach Überbleibseln unerwünschter Kunst abzusuchen; daraufhin habe deren »Ausmerzung« in Preußen zu erfolgen.185 Im Januar 1938 arbeitete Goebbels an einem umfassenderen Gesetz für das ganze Reich, das es den Behörden ermöglichen sollte, alle derartigen Werke ohne Entschädigung zu beschlagnahmen, seien sie in Privat- oder Staatsbesitz. Das Gesetz wurde, mit Rückendeckung Hitlers, am 31. Mai verkündet.186 Drei Jahre später verdoppelte Ziegler seine Bemühungen, gegen jeden vorzugehen, der »Werke der Verfallskunst erzeugt oder solche als Künstler oder Händler verbreitet«.187
Was aber geschah mit all den beschlagnahmten Bildern, Skulpturen und Graphiken? Zumeist wurden sie ins Ausland verkauft, oftmals mit Gewinn für hochrangige Nazis wie Göring oder Hitler, und häufig genug erwarben Schweizer Kunsthändler Werke zu Niedrigpreisen – aus Motiven, die alles andere als altruistisch waren. Jedenfalls brachten sie so die ersehnten Devisen ins Reich. Göring, der aus einer Familie der oberen Mittelschicht mit entsprechendem Kunstgeschmack stammte, soll sich viele Stücke für den privaten Genuss gesichert haben, während er andere, die er nicht schätzte, verkaufte und das Geld in die eigene Tasche steckte. Unveräußerliche Stücke wurden – wie die Bücher ein paar Jahre zuvor – verbrannt. Was die Nationalsozialisten als Gewinn für das Reich ansahen, sollte sich als beklagenswerter Verlust für die zivilisierte Welt erweisen.188
Die Ausstellung »Entartete Kunst« diente als direktes Vorbild für ein weiteres, vergleichbares Ereignis: Im Mai und Juni 1938 wurde in Düsseldorf, der Stadt Robert Schumanns (dessen gelegentliches Misstrauen gegenüber Juden die Nationalsozialisten gern für Propagandazwecke nutzten), eine Ausstellung »Entartete Musik« gezeigt.189 Mit Goebbels’ Zustimmung übernahmen zwei Männer aus seinem engeren Umfeld die Organisation: Hans Severus Ziegler und Heinz Drewes. Ziegler hatte bereits als Intendant des Nationaltheaters Weimar in Thüringen die NS-Kulturpolitik umgesetzt. Geboren 1893 in Eisenach als Sohn eines Bankiers mit internationalen Verbindungen, studierte er in Cambridge und an deutschen Universitäten. Den Doktorgrad erwarb er mit einer literaturwissenschaftlichen Arbeit. (Ironischerweise war Ziegler über seine Mutter mit der New Yorker Musikgesellschaft Schirmer verbunden, die nach Arnold Schönbergs erzwungener Emigration viele seiner Werke publizierte – während Ziegler nicht müde wurde, über den Komponisten und seine Musik herzuziehen.) Für Wilhelm Frick, damals nationalsozialistischer Innenminister in Thüringen, entwarf er den berüchtigten Text »Wider die Negerkultur«, der erahnen ließ, welche Einschränkungen drei Jahre später im ganzen Reich Realität werden sollten. Nach Hitlers Machtergreifung wurde Ziegler zum Staatskommissar für die thüringischen Landestheater ernannt. 1935 folgte eine zeitweilige Suspendierung; man verdächtigte ihn der Homosexualität. Er konnte sich reinwaschen, nur um danach umso eifriger ans Werk zu gehen. Er schloss sich nun eng an Goebbels an und wurde von diesem 1937 in den Reichskultursenat befördert.190
Anfang 1938 tat Ziegler sich mit dem Dirigenten Heinz Drewes zusammen, der ebenfalls von Thüringen aus im NS-Kulturbetrieb Karriere machte. Drewes stammte aus Westdeutschland, war aber Kapellmeister in Altenburg geworden, was er dem zehn Jahre älteren Ziegler verdankte. 1930 hatte er eben dort eine Ortsgruppe des Kampfbunds für deutsche Kultur gegründet. 1937 war Drewes Generalintendant in Altenburg und wurde von Goebbels zum Leiter der neu gegründeten Abteilung für Musik im Propagandaministerium berufen, wo er die Aufgabe hatte, Kompositionen daraufhin zu überprüfen, ob sie »der deutschen Nation schaden könnten«.191
Im Frühjahr 1938 organisierte Drewes im Auftrag des Propagandaministeriums die Reichsmusiktage in Düsseldorf. Es überrascht nicht, dass Ziegler mit seinem Ehrgeiz und ideologischen Eiferertum dieses Ereignis noch mit einer Ausstellung über »entartete Musik« ergänzte. Goebbels hatte nicht darum gebeten, die Veranstaltung aber auch nicht verboten; es solle jedoch kein Aufhebens davon gemacht werden.192 Ziegler hatte eine rigorose ideologische Ausbildung durchlaufen und seine Ansichten über Musik waren so fanatisch wie festgelegt. Der Verfasser verschiedener Traktate zum Thema Kultur hatte sich dem »völkischen« Charakter der Kunst verschrieben, den er im Februar 1937 in einer Rede in Danzig als das Gegengift zur Moderne schlechthin bezeichnete. Deutsche Volkslieder seien der Inbegriff von »Einfachheit und elementarer Größe in der Kunst«. Sie würden »allen intellektuellen Konstruktivismus« besiegen und die Spuren »letzter kulturbolschewistischer Reste, die gerade auf dem Gebiet der Musik und der bildenden Künste noch am deutlichsten spürbar sind«, beseitigen. »Tonal oder atonal bedeutet ›Sein oder Nichtsein‹ deutschen Musikwesens und ist eine Weltanschauungsfrage.« Die Einheit von Melodie, Harmonie und Rhythmus war für Ziegler das archetypische Wesenselement der Musik, wie sie im Volkslied und als »Künder deutscher Seele« erklinge. Die von Hindemith, Strawinsky und dieser ganzen Bewegung aufgeworfenen Probleme müssten ein für alle Mal gelöst werden, und Ziegler wusste, wie: »Eine Parallelausstellung zur Münchener Ausstellung ›Entartete Kunst‹ für alle musikalischen und Opern-Experimente der letzten drei Jahrzehnte, durch Schallplatten aller Art verlebendigt, würde vielen Augen und Ohren für die infernalischen bolschewistischen Versuche öffnen, Gemüt, Gefühl und Sinne des deutschen Menschen zu zerstören.«193
Die Reichsmusiktage, das offizielle Hauptereignis in Düsseldorf, fanden vom 22. bis zum 29. Mai statt. Die Eröffnungsrede hielt mit dem Komponisten Paul Graener einer der stellvertretenden Präsidenten der Reichsmusikkammer. Da auf dem Musikfest die vom Regime nicht nur geduldete, sondern explizit erwünschte Musik präsentiert werden sollte, erlebte Graeners eigenes neues Werk – Feierliche Stunde – unter Leitung des Düsseldorfer Generalmusikdirektors Hugo Balzer seine Premiere als erstrangiges Beispiel für diese Musik. Erstrangig waren weder Komponist noch Dirigent, ihr Wirken allerdings brachte die spezifischen Qualitäten der zeitgenössischen Musik im NS-Staat zum Ausdruck. Objektiv gesehen war das Programm, abgesehen von Größen wie Beethoven, Richard Strauss und Hans Pfitzner, reines Mittelmaß, umrahmt und nahezu dominiert von randständigen Aufführungen: Militärmärsche wurden gespielt, der Reichsarbeitsdienst (RAD) brachte Marschmusik zu Gehör, das Reichssinfonieorchester gab Kostproben seines Könnens. Der NSDStB unterhielt ein Musikzeltlager, und die Hitlerjugend (HJ) sorgte für Frühstücksmusik. Offene Chöre wechselten sich ab mit Kammermusik und der Premiere der Ostmark-Ouverture von Otto Blesch, einem bis dato unbekannten Komponisten. (Seltsamerweise feierte auch das Stück Violinmusik des Dresdner Chorleiters Boris Blacher Premiere. Beeinflusst von Milhaud, Satie und Strawinsky, hatte Blacher Musik mit unkonventionellen Rhythmen und jazzigem Stil komponiert. Obwohl nach den Nürnberger Rassegesetzen von 1935 »Vierteljude«, durfte er noch komponieren und aufgeführt werden.) Politische Aktivitäten gab es auch: Am 26. Mai veranstaltete man um halb vier in der Früh einen Ehrenmarsch zum Schlageter-Denkmal – Schlageter war von den Franzosen in der nahe gelegenen Golzheimer Heide erschossen worden.194 Goebbels höchstselbst schloss die Veranstaltung mit einer weiteren politischen Erklärung: Die Musik, die »deutscheste« aller Künste, sei vom internationalen Judentum fast ausgerottet worden. Erst der Nationalsozialismus habe dies in den letzten Jahren grundlegend verändert, denn er »fegte die pathologischen Erscheinungen des musikalischen jüdischen Intellektualismus weg«.195
Abgesehen von einer eher nebensächlichen musikologischen Tagung zum »Problem Musik und Rasse« bot die von Ziegler gestaltete Exposition, die den Besuchern am 24. Mai zugänglich gemacht wurde, eine willkommene Abwechslung von den langweiligen Darbietungen im Hauptprogramm.196 Viele dürften die von Ziegler aufgestellten Hörkabinen als Hauptattraktion betrachtet haben. Im Inneren der Kabinen konnte man einen Knopf drücken, um die Musik eines verfemten Komponisten – Weill, Schönberg, Krenek usw. – zu hören. Drückte man mehrere Knöpfe (bis zu acht waren möglich) gleichzeitig, erklang jene Kakophonie, die die Nationalsozialisten für typisch atonal hielten. Hätte man allerdings Mozart, Beethoven und Wagner simultan gespielt, wäre der Effekt kaum anders gewesen.197
Der Nachkriegserinnerung des NS-Musikkritikers Karl Laux zufolge wurden überdies »Portraits, theoretische Schriften, Notenbeispiele und Libretti, Plakate und Bühnenbilder zu musikdramatischen Werken« ausgestellt.198 Auf Wandplakaten seien »grundsätzliche Anschauungen der neuen deutschen Musikpolitik« verkündet worden,199 von Postern hätten die Porträts verfemter Komponisten herabgeblickt, zumeist mit einer herabwürdigenden Legende versehen. Unter einem Gemälde, das den russischen Edelmann Igor Strawinsky zeigte, sei beispielsweise die »Rassereinheit« seines Stammbaums bezweifelt worden. Die Köpfe der jüdischen Operettenkomponisten Leo Fall und Oscar Straus wurden dem Publikum nur als Karikatur präsentiert.200 Zu einer Fotografie des Zwölfton-Komponisten Anton Webern hieß es, mit seiner Art, Noten aufs Papier zu setzen, habe er sogar seinen »Dresseur« Arnold Schönberg übertroffen. Webern war vertreten, obwohl er nach dem sogenannten Anschluss Österreichs seine Tochter zur Hitlerjugend geschickt hatte, wo sie einen österreichischen SA-Mann kennenlernte, den sie dann heiratete.201 Auch den Schriften von Komponisten spielte Ziegler übel mit. Schönbergs 1910 erschienene Harmonielehre wurde als Grundlage der Zwölftonmusik verurteilt, obwohl er diese erst danach entwickelte.202 Und Hindemiths erst kurz zuvor (1937) erschienener Unterweisung im Tonsatz wurde eine gleichermaßen schädliche Funktion zugeschrieben.203 Unter einer Porträtfotografie von Schönberg aus dem Jahre 1924 las man einen angeblich von einem jüdischen Musikkritiker stammenden Slogan, dem zufolge Schönberg ein Meister der Hysterie und Schöpfer eines »Heers der Krämpfe« sei. Hindemith war auf einem Foto mit seiner Frau zu sehen, »einer Tochter des jüdischen Frankfurter Opernkapellmeisters Ludwig Rottenberg«; dass ihre Mutter nicht jüdisch war, blieb unerwähnt. Überzeugender wurde der Eindruck vermittelt, durch den Ziegler überhaupt erst motiviert worden war, dass nämlich »entartete Musik« und »entartete Kunst« zwei Seiten einer Medaille seien: Paul Klees Bild Musikalische Komödie war ebenso zu sehen wie, noch plausibler für den behaupteten Zusammenhang, Karl Hofers Jazzband.204
Der Erfolg der Musik-Ausstellung, die vorzeitig bereits am 14. Juni schloss, blieb weit hinter dem der Münchner Kunst-Ausstellung vom Vorjahr zurück, obwohl Ziegler einen sorgfältig gestalteten Führer herausgegeben hatte.205 Darin waren seine Eröffnungsrede abgedruckt, außerdem einige der prominenteren Exponate wie etwa Schönbergs Porträt, aber auch Bilder von Kurt Weill, Ernst Toch und Franz Schreker – sämtlich bekannte, zumeist jüdische moderne Komponisten. In seinem Artikel wiederholte Ziegler die Hauptthemen früherer Arbeiten und bläute seiner Leserschaft erneut ein, dass die Juden aus der deutschen Kultur entfernt werden müssten und »Kunstbolschewismus« die beispielhafte Verkörperung musikalischer Geistesgestörtheit sei. Ziegler hatte sich bei seinen Weimarer Musikerkumpeln Rat geholt und gab sich nun als beschlagener Musikologe, wenn er behauptete, die Qualität einer Opernmusik lasse sich anhand des Librettos beurteilen – ein offensichtlicher Angriff auf die Dreigroschenoper von Brecht und Weill, die ebenfalls in der Ausstellung verunglimpft wurde. Dann gab Ziegler eine Definition von Musik mittels eines organischen Gesetzes, das angeblich dem Dreiklang zugrunde liege: »Das Geheimnis aller Erkenntnis liegt ja schließlich in der Einfachheit: wenn die größten Meister der Musik und aus dem ganz offenbar germanischen Element des Dreiklangs empfunden und geschaffen haben, dann haben wir ein Recht, diejenigen als Dilettanten und Scharlatane zu brandmarken, die diese Klanggrundsätze über den Haufen schmeißen und durch irgendwelche Klangkombinationen verbessern oder erweitern, in Wirklichkeit entwerten wollen.« Er ereiferte sich über Schönbergs »Atonalität« im Gegensatz zur »Reinheit des deutschen Genies Beethoven« und monierte »die Entartung nach dem Einbruch des brutalen Jazz-Rhythmus und Jazz-Klanges in die germanische Musikwelt«. Man könne nicht, schloss er, die große tonale Entwicklung von eintausend Jahren für einen Irrtum halten, sondern müsse die Meisterwerke dieser wunderbaren Epoche einschließlich der letzten Jahrzehnte als Krönung des abendländischen Geistes betrachten. Wer also »die Grenzen in der Klangkombination dauernd verschieben will, löst unsere arische Tonordnung auf«.206
Da die Ausstellung in Düsseldorf nur wenig Begeisterung ausgelöst hatte, wurde sie zunächst auf Eis gelegt. Erst im Frühjahr 1939 ging sie nach Weimar, für Ziegler eine Art Heimspiel, und wurde dort im Landesmuseum mit der »Entarteten Kunst« zusammen gezeigt. Ziegler sorgte auch für eine Aufführung von Franz Lehárs Das Land des Lächelns, um die »Entartung« dieser Operette im Besonderen und des Genres im Allgemeinen zu demonstrieren. (Zu ebenjener Zeit vegetierte der jüdische Librettist Fritz Löhner-Beda im nahe gelegenen KZ Buchenwald dahin, wo er bald darauf ermordet wurde.) Ziegler war allerdings entgangen, dass Hitler Léhars Werke mochte – alle. Derartiger Dilettantismus trug vielleicht dazu bei, dass Ziegler aus der Ausstellung keine Dauereinrichtung machen konnte. Immerhin wurde sie im Mai noch in Wien gezeigt. Weitere Präsentationen verhinderte der Krieg.207
Goebbels’ Reichsmusiktage sollten indes noch nicht in der Versenkung verschwinden. Mochte die Qualität des ersten Versuchs auch bedenklich sein, so fühlten sich 1938 Musiker aller Couleur doch inspiriert genug, um für das Folgejahr Vorschläge einzusenden. 1121 Partituren gingen bei den Organisatoren ein, darunter 36 Opern, 431 Sinfonien, Werke für Chor und instrumentelle Begleitung, außerdem eine erkleckliche Anzahl von Kammermusikstücken.208 Waren die Bewerber alle mittelmäßig? Natürlich gab es unter ihnen keine Juden, und niemand hatte Werke im Zwölfton- oder Jazz-Stil vorgeschlagen. So gesehen, dürfte die Ausstellung »Entartete Musik« Früchte getragen haben. Aber abgesehen von derart begrenzten Zwecken ist sie deshalb in die Geschichte eingegangen, weil sie jeglicher Debatte über Moderne in der Kunst im Reich ein Ende bereitete.
Die Kunst- wie die Musik-Ausstellung stehen für Versuche der NS-Institutionen, die Moderne auszuradieren, sofern es ihren Vertretern nicht gelungen war, sich in das Dritte Reich zu integrieren. Mit Hitlers Rede, in der er im Juli 1937, dem Eröffnungsmonat der Ausstellung »Entartete Kunst«, allen seiner Ansicht nach ästhetischen Verirrungen endgültig eine Absage erteilt hatte, war die Moderne ganz offiziell beendet. Die Musik-Ausstellung diente der Bestätigung dieser Entscheidung, auch wenn die Bewegung in bestimmten Ausprägungen isoliert und häufig unter der Hand trotzdem weitergehen sollte – denn kein von menschlicher Regung motivierter Trend lässt sich einfach auslöschen, nicht einmal in einer höchst repressiven Diktatur.209
Die Beseitigung jener ästhetischen Wertesysteme, die als Kennzeichen der Weimarer Republik galten, betraf Formen und Gestalten, Farben und Klänge, Experimente, Freiheit und Toleranz – alles Merkmale einer offenen, auf Inklusion bedachten Gesellschaft im Gegensatz zu den Beschränkungen der auf Ausschluss gerichteten faschistischen Gemeinschaft mit ihren kleinkarierten, vorurteilsbeladenen Vorstellungen. Es gibt eindeutige Parallelen zwischen dem politischen Aufstieg der Nationalsozialisten und der Zunahme ihrer modernefeindlichen Gesinnung: Mit ihrem Stimmenzuwachs bei den Reichstagswahlen vom September 1930 nahm ihre Kampagne gegen republikanische moderne Künstler an Fahrt auf – zu deren Schaden. Nach der Machtergreifung fielen alle Schranken. Die Gewalt, die die SA auf der Straße entfachte, wurde mit fragwürdigen Gesetzeswerken verschränkt, was die zerstörerische Dynamik beschleunigte. Und so wurde das Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums vom 7. April 1933 schon früh auch gegen Künstler der Moderne in Anschlag gebracht, sei es, um sie mundtot zu machen, sei es, um sie und ihre Werke gänzlich aus Meisterklassen und Kunstakademien zu verbannen. Ergänzend sorgten neue Statuten für die Einführung von Zensur (mit Selbstzensur im Gefolge), etwa Goebbels’ Verbot der Kunstkritik im November 1936. Zwei Jahre später ließ er das Gesetz zur entschädigungslosen Beschlagnahmung von Kunstwerken aus privatem wie staatlichem Besitz folgen. In eben diesem Jahr starb Barlach an gebrochenem Herzen. Zu dieser Zeit hatte das sogenannte Dritte Reich als politisches Konstrukt den Zenit seines Erfolgs erreicht. Es verfügte über die uneingeschränkte Macht, jedes Hindernis auf dem Weg zu »rassischer« Konsolidierung und kriegerischer Aggression zu beseitigen. In diesem Jahr – 1938 – zeigte das Regime, wozu es fähig war, als es, genau zwei Wochen nach Barlachs Tod, Synagogen niederbrannte, jüdische Männer und Frauen gnadenlos verfolgte und zu Tausenden in die KZs schickte, Hunderte von ihnen tötete. Saßen 1933 etwa 4000 Personen – Juden und Nicht-Juden – in deutschen Lagern, waren es Ende 1938 bereits 54 000.210 Es dürfte kein Zufall sein, dass Juden in der Zeit vor der Machtergreifung großen Anteil am Aufstieg der Moderne gehabt hatten.
Bei der Zerschlagung des Bestehenden und der folgenden Einführung von Ersatzkonstruktionen sind die nationalsozialistischen Führer häufig scheinbar widersprüchlichen Impulsen gefolgt, die heute Fragen aufwerfen. Wie lässt sich beispielsweise die Sympathie verstehen, die 1933 Ernst Barlach von NSDStB-Studenten entgegengebracht wurde, wenn im selben Jahr Studenten einer anderen Gruppierung die landesweite Bücherverbrennung organisierten?211 Beide Gruppen waren durch und durch nazifiziert, und doch begegnete die eine der Moderne mit Wohlwollen, die andere mit Feindschaft. Und in beiden Gruppen gab es Mitglieder, die zu einer Zeit Verständnis für die Moderne zeigten und sie zu einer anderen verdammten. Rätsel geben auch die Beziehungen zwischen NS-Größen in ihrer Einstellung zur Moderne – pro oder contra – auf, wobei eine Fraktion den Sieg davontrug: die Rosenberg’sche über die Goebbels’sche. Obwohl ursprünglich ein Sympathisant des Expressionismus, musste Goebbels im Streit um Hindemith und schließlich 1937 bei der Entscheidung über die Zukunft der Moderne im Dritten Reich zurückstecken. Hatte sich der geistreiche Propagandaminister im alltäglichen Umgang mit dem geistlosen Parteiphilosophen Rosenberg zwischen 1925 und 1938 nicht immer als deutlich überlegen erwiesen? Bei näherer Betrachtung entdeckt man, dass in beiden Fällen Hitler selbst den Ausschlag gab – zugunsten Rosenbergs. Das verweist auf Besonderheiten in den Führungsmustern des Regimes, die der genaueren Untersuchung bedürfen.