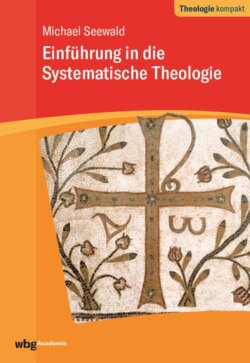Читать книгу Einführung in die Systematische Theologie - Michael Seewald - Страница 24
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Das spekulative Moment der Theologie
ОглавлениеBezugnahmen auf Sachverhalte
Neben dem positiven Moment kennt die Theologie jedoch auch eine spekulative Dimension, die wissenschaftstheoretisch deutlich prekärer ist. Denn Theologie beschäftigt sich nicht nur mit der Reflexion auf religiöse Überzeugungen, wie das andere religionsbezogene Studien auch tun, sondern sie ist ebenso Selbstreflexion einer Gemeinschaft auf ihre religiösen Überzeugungen. Um das zweite sein zu können, muss sie zunächst einmal das erste leisten. Als Selbstreflexion ist ihr aber auch eine Positionierung gegenüber den Sachverhalten, auf deren Bezugnahmen sie sich bezieht, erlaubt, ja sogar geboten. Wenn sie also von dem Satz ausgeht, „die katholische Kirche bekennt, dass Jesus Christus Gottes Sohn sei“, bezieht sie (die Theologie) sich auf die Art, in der auf einen Sachverhalt (die Gottessohnschaft Jesu Christi) Bezug genommen wird (durch das Bekenntnis der Kirche). Während die Religionswissenschaft es bei einer solchen Feststellung belassen würde, kann die Theologie aber auch fragen, ob die von ihr positiv festgestellte Art der Bezugnahme spekulativ sinnvoll und berechtigt ist. Konkret: Ein Theologe könnte fragen, ob Gott überhaupt existiert, ob die Rede von einem „Sohn Gottes“ angesichts neuerer Gendersensibilitäten noch sinnvoll ist oder ob Gott, so wäre aus islamisch-theologischer Perspektive einzuwenden, überhaupt derart relational gedacht werden kann, dass ihm ein Sohn zuzuschreiben wäre. Wenn der Theologe sich nun zu der Behauptung versteigt, es sei besser, von Jesus als „Gottes Kind“ denn als „Gottes Sohn“ zu sprechen, oder die These aufstellt, dass Gott in seiner Totalität gar keinen Sohn habe, rückt die Theologie nahe an religiöse Aussagen heran und macht sich daher genauso angreifbar wie religiöse Aussagen es selbst auch sind. Die Theologie wird dadurch zu einer spekulativen Disziplin, die bisweilen, denkt man etwa an die Geschichte der christlichen Trinitätslehre, hoch komplex und in ihren Unterscheidungen auch für andere Wissenschaften relevant werden kann (vgl. Schmidt 2016), aber dennoch einen wissenschaftstheoretisch prekären Status innehat. Denn dort, wo die Theologie spekulativ tätig wird und Theorien zur Deutung von Gottes Wesen entwickelt, sind diese Theorien nicht nur noch nicht überprüfbar, sondern unter den Bedingungen, unter denen Menschen hier und jetzt leben, grundsätzlich nicht überprüfbar. Dieses Problem ist alt und findet sich bereits bei Thomas von Aquin (1225–1274), dem wohl einflussreichsten Theologen des Mittelalters, angesprochen.
Quelle
Thomas von Aquin, Summa Theologiae I, q. 1, a. 2, corpus.
Deutsche Übersetzung: Thomas von Aquin (1933), Gottes Dasein und Wesen (Deutsche Thomas-Ausgabe 1), Salzburg, 8 (im Folgenden leicht modifiziert).
„Die heilige Lehre ist eine Wissenschaft [scientia]. Aber es gibt eine doppelte Art von Wissenschaft. Die eine stützt sich auf Prinzipien, die durch das natürliche Licht des Verstandes einsichtig sind, wie die Arithmetik, die Geometrie und andere. Die zweite Art stützt sich auf Prinzipien, die durch das Licht einer höheren, übergeordneten Wissenschaft einsichtig werden. So gründet die Lehre von der Perspektive in Prinzipien, die durch die Geometrie, die Musik in solchen, die durch die Arithmetik einsichtig sind. Und zu dieser zweiten Art von Wissenschaft zählt die heilige Lehre, weil sie sich auf Prinzipien stützt, die durch das Licht eines höheren Wissens [scientia] erkannt werden, nämlich des Wissens Gottes und der Seligen. Wie sich also die Musik auf die Prinzipien verlässt, die ihr von der Arithmetik vermittelt werden, so nimmt die heilige Lehre die Prinzipien gläubig an, die ihr von Gott geoffenbart sind.“
Subalterne Wissenschaften
Thomas spielt hier mit der doppelten Bedeutung des lateinischen Wortes „scientia“, das sowohl Wissen als auch Wissenschaft bedeuten kann. Mit Blick auf die Wissenschaften entwickelt der Aquinate unter Rückgriff auf aristotelische Motive einen später als „Subalternationsmodell“ (Frank 2017, 135) bezeichneten Ansatz, demzufolge es über- und untergeordnete Formen der Wissenschaft gebe. Manche Wissenschaften beziehen ihre Prinzipien unmittelbar aus dem Licht der natürlichen Vernunft. Die Arithmetik, für Thomas die allgemeinste der Zahlwissenschaften, ist mit ihren Gesetzen – etwa dem Assoziativ-, Kommutativ- oder Distributivgesetz – nur den Regeln des korrekten Denkens unterstellt, das Abweichungen von diesen Gesetzen sofort als Fehler entlarven würde. Die Musik, die Thomas im Sinne der „harmonia“ aus dem Quadrivium der sieben freien Künste ebenfalls als Zahlangelegenheit konzipiert, da sie es mit dem durch Intervalle anzugebenen Verhältnis von Tönen zu tun hat, kann in der Harmonielehre für den Aquinaten hingegen nur dann reflektiert werden, wenn die Harmonielehre sich bei der Arithmetik bedient, indem sie sich von dort jene Zahlgesetze aneignet, die sie braucht. Der Harmonietheoretiker übernimmt dieser Vorstellung gemäß also arithmetisches Wissen und empfängt damit die Prinzipien einer aus seiner Sicht höherrangigen Disziplin, ohne deren Prinzipien er seine eigene Disziplin nicht betreiben könnte. Ähnlich gehe es, so Thomas, auch der Theologie. Ein Theologe arbeite mit Prinzipien, in die er selbst keine letzte Einsicht habe und die er nicht überprüfen könne, sondern die er hinnehmend von Gott im Akt der Offenbarung empfangen müsse und die erst dann für ihn selbst zur Evidenz gelangen, wenn er einst zu den Seligen gehöre, also zu denen, die Gott schauen und daher erkennen, wer er wahrhaft sei.
Spekulation: ein schmaler Grat
Die These des Aquinaten war bereits im Mittelalter, etwa bei seinem etwas jüngeren Zeitgenossen Johannes Duns Scotus (1266–1308), umstritten. Sie wirkt aus Sicht der modernen Wissenschaftstheorie natürlich konstruiert und für jemanden, der nicht daran glaubt, dass Gott sich offenbart und Selige vor seinem Angesicht stehen, geradezu absurd. Dieses Unbehagen macht zweierlei deutlich: Während der positive Teil theologischer Forschung, der untersucht, wie auf religiöse Sachverhalte Bezug genommen wird, sich nahtlos in die Reihe der Wissenschaften einfügt, erscheint das spekulative Moment theologischen Denkens vor der Wissenschaftstheorie der Gegenwart als ein Fremdkörper. Die Theologie darf diesen Körper aber, bei allem Bemühen um eine zeitgemäße Wissenschaftlichkeit, nicht gänzlich abstoßen, weil sie ansonsten ihrem genuin religiösen Auftrag, der die Theologie erst zur Theologie macht, nicht mehr gerecht würde. Dieser Auftrag besteht allerdings nicht nur in der Affirmation, sondern auch, und vielleicht sogar vor allem, in der Kritik an religiösen Institutionen und Akteuren. Denn Kritik an der Art, wie zum Beispiel die Kirche auf religiöse Sachverhalte Bezug nimmt, impliziert, dass ein Theologe – freilich in spekulativer, nicht in positiver Hinsicht – ebenfalls auf religiöse Sachverhalte Bezug nimmt. Die Theologie darf sich darin aber nicht erschöpfen und sollte deshalb mit Spekulationen über Gott und das Göttliche zurückhaltend sein. Denn, das macht Thomas ebenfalls deutlich, auch die spekulative Theologie hat mit Prinzipien zu arbeiten, anhand derer ihre Behauptungen überprüft werden müssen und kritisiert werden können – nur sind diese Prinzipien selbst aufgrund mangelnder Evidenz im Hier und Jetzt umstritten und daher selbst wiederum Gegenstand der theologischen Auseinandersetzung.