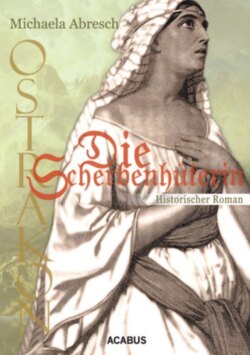Читать книгу Ostrakon. Die Scherbenhüterin - Michaela Abresch - Страница 10
Оглавление- Kapitel 3 -
Zipporij
Sie wusste nicht, in welches Haus man sie brachte, wer auf seinem Lager zur Seite rückte, um seinen Schlafplatz mit ihr zu teilen oder wer sie sanft in den Armen wiegte, wenn sie weinend aus dem Schlaf schreckte. Die Nacht schien kein Ende zu nehmen und als der Morgen graute, waren Dayas Augen rot, stumpf und tränenleer. Verstört blickte sie Tante Adah an, die früh am nächsten Tag kam, sie in die Arme schloss und lange an sich drückte. Als sie hinausgingen, umfing sie der Geruch von verkohltem Holz und warmer Asche. Sie hörte Tante Adah mit erstickter Stimme von Dingen sprechen, die sie ängstigten. Dünne, weiße Rauchfäden stiegen über dem empor, was einmal ihr Haus gewesen war, vereinzelt glommen Funken in den zusammengestürzten Überresten. Die westliche Seite des Hauses gab es nicht mehr, sodass die entstandene Lücke den Blick auf den dahinter gelegenen Garten öffnete. Dort, wo der Olivenbaum gestanden hatte, streckte ein Gerippe seine verkohlten Arme in den Himmel.
Daya blinzelte, schloss die Augen, öffnete sie wieder. Die Rauchschwaden blieben. Und auch der Geruch. Der Geruch ihrer toten Mutter. Wie ein Leichentuch umhüllte er die Trümmer des Hauses, legte sich über die Straße, senkte sich schwer auf Gärten, Nachbarhäuser und Viehpferche. Den Kopf in den Nacken gelegt, blickte sie nach oben. Zwei Vögel kreisten zwischen weißen Wolkenfetzen; mit unsichtbaren Flügelschlägen zogen sie ihre Bahn, weit über ihr. Kleiner Vogel Daya, sagte Nathan manchmal. Nichts sehnlicher wünschte sie sich, als die Arme auszubreiten und aufzusteigen; mit sanften Vogelschwingen über den Schrecken der letzten Nacht hinwegzugleiten, wie die beiden dort oben, die nun mit dem Abwind die Richtung änderten.
„Ima…“ Mit winzigen, flinken Schritten begann Daya, sich um sich selbst zu drehen. Nie wieder würde sie die geliebte Stimme hören, nie wieder von ihr getröstet werden, nie wieder neben ihr einschlafen. Die Endgültigkeit hinter den dunklen Grübeleien senkte sich auf Dayas Herz, wo sie drückte und ihr die Luft zum Atmen nahm. Doch sie drehte sich weiter, immer schneller, als könne sie dem Unabänderlichen damit entkommen. Sie hielt die Augen geschlossen und den Blick nach innen gerichtet, wo sich das Bild des Tores formte, hinter dem das Reich der anderen Welt begann. Schattenwelt nannten die jüdischen Priester den Ort, an den die Menschen nach dem Sterben gingen, ein bedrohliches Wort, voll Düsternis, Einsamkeit und Kälte.
Nimm doch meine Stimme, Ima! Nimm sie mit, damit wir dort, wo du jetzt bist, miteinander lachen und singen können.
Auf bloßen Füßen, mit ausgebreiteten Armen und fliegendem Haar wirbelte sie umher. Sie schrie sich ihren Schmerz von der Seele, schrie, so laut sie es vermochte und so lange, bis Tränen über ihr Gesicht rannen und sie verstummte erst, als eine Hand nach der ihren griff und sie fortzog.
Wie es die Riten der Ahnen vorschrieben, wusch und salbte man Yeshas toten Körper und hüllte ihn in saubere Leintücher. Daya beobachtete schweigend, was Tante Adah und die Frauen aus der Nachbarschaft taten. Das Klagen der Weiber in den sackartigen Gewändern verfolgte sie bis in den Schlaf. Und als man den leblosen Körper, verborgen unter hellen Tüchern, in einen Garten außerhalb der Stadt brachte, begleitete sie gehorsam den Trauerzug an der Hand Tante Adahs. In dem neben einem knorrigen Baum gelegenen Felsengrab hatte man im vergangenen Winter Onkel Chaim beigesetzt. Es beruhigte Daya, ihre Mutter nicht allein in der kalten, steinernen Höhle zu wissen.
In jener unglückseligen Nacht hatte Adah ihre gesamte Habe verloren. Das Haus war niedergebrannt bis auf die Grundmauern und damit unbewohnbar geworden. Mit bloßen Händen suchten sie nach brauchbaren Gegenständen, dabei fanden sie die verkohlten Überreste der jungen Ziege im Garten, nah beim Haus. Die alte, magere hatte den Brand überlebt. Adah brach in lautes Wehklagen aus, band dem verängstigten Tier einen Strick um den Hals und zerrte es über die noch warmen Trümmer auf die Straße. Abgesehen von zwei bauchigen, verschließbaren Tonkrügen, die Adah unter den Zitronenbäumen entdeckte und dem Korb, in dem Yesha die Schriftrollen nach draußen gebracht hatte, fanden sie nichts, was ihnen noch von Nutzen sein konnte.
So hockte Daya kurz darauf stumm neben Adah im Schatten des alten Feigenbaumes, in ihrer Mitte die Tonkrüge und den Korb mit den Papyrusschriften. Gleichmütig beobachtete sie, wie Tante Adah sorgsam jede einzelne der Schriftrollen in die Hand nahm, sie auseinanderrollte und dann nah vor ihr Gesicht führte, um das Geschriebene zu entziffern. Tiefe Falten furchten ihre Stirn, zuweilen kniff sie die Augen zusammen und murmelte halblaut vor sich hin. Danach schlang sie die jeweilige Rolle in das dazugehörige Leintuch, das die Schrift auf dem Papyrus vor Staub und Licht schützte.
Irgendwann hob Adah den Kopf und seufzte laut: „Wir müssen Sorge dafür tragen, dass sie nicht verloren gehen. Das sind wir deiner Mutter schuldig, Daya.“ Ihre Stimme klang hohl.
Daya senkte den Blick, schwieg und sehnte sich nach der Tonscherbe, die sie in der letzten Nacht auf die Stirn ihrer Mutter gelegt hatte, um sie zu trösten. Niemand hatte darauf geachtet, als man sie fortbrachte.
„Sie gab ihr Leben dafür.“ Adahs Augen schimmerten, rasch fuhr sie sich mit dem schmutzigen Ärmelsaum übers Gesicht. Lange sagte sie nichts. Die letzte Papyrusrolle ruhte in ihrem Schoß, Yeshas Gedanken und Erinnerungen. Mehr war nicht von ihr geblieben, eine Hinterlassenschaft aus Schriftzeichen in der Obhut einer erblindenden alten Frau. Zu dem Lächeln, das sie Daya schenkte, musste sie sich zwingen und sie hoffte, die Kleine möge es nicht bemerken. Ihre Hand, zittrig vor Schwäche und Trauer, tastete nach Dayas Wange.
„Sie hat mehr als Worte hinterlassen“, sagte Adah leise. „Du warst der Stern ihrer Nächte. Versprich, dass du es nie vergisst. Bewahre es in deinem Herzen, für immer.“
Bei ihren Worten schluckte Daya hart an den aufsteigenden Tränen. Sie bemühte sich, sie fortzublinzeln, was ihr nicht gelang.
„Sie wird es dir nie wieder sagen können“, fügte Adah hinzu, „aber du wirst es immer bleiben.“
Adah zog sie in ihre Umarmung. Lange saßen sie eng aneinandergeschmiegt, sie schaukelte das Kind in den Armen, strich besänftigend über die bebenden Schultern und schwieg, weil sie keine Worte fand, die den Schmerz betäuben könnten.
„Du hast aufgehört zu sprechen“, bemerkte sie nach einer Weile. Dayas Körper zitterte unter den letzten Schluchzern.
Ich kann dir nicht antworten, dachte sie, da ist keine Stimme mehr in mir, ich habe sie in die Wolken geschickt, zu Ima.
Sie wünschte sich, Tante Adah wäre imstande, ihre Gedanken zu lesen, damit sie verstünde, was auszusprechen Daya nicht möglich war.
Es waren eine Menge Schriftrollen, mehr als Daya zählen konnte. Adah steckte sie aufrecht in die beiden Tonkrüge. Daya wunderte sich, dass sie alle hinein passten; fast schien es ihr, als seien die Krüge allein zu dem Zweck angefertigt worden, eines Tages die Schriften ihrer Mutter aufzunehmen.
Am frühen Abend borgte jemand aus der Nachbarschaft ihnen eine klapprige, zweirädrige Holzkarre, auf die Adah die Krüge lud.
„Wir werden die Schriften deiner Mutter an einen Ort bringen, an dem sie sicher sind“, hörte Daya sie sagen, „ich gehe vorn und ziehe den Karren, du gehst an der Seite und passt auf, dass die Krüge nicht herunterfallen. Hast du verstanden, meine Kleine?“
Daya nickte und tat, wie ihr geheißen. Sie ahnte nichts von der Angst, an der Adah beinahe erstickte. In der Hoffnung, das Stadttor passieren zu können, ohne dass einer der Torwächter auf den Gedanken käme, sich nach dem Inhalt der Krüge zu erkundigen, zog Adah den Karren in Richtung der östlichen Stadtmauer. Niemand kümmerte sich um die Frau mit dem schwarzen Kopfschleier, die allem Anschein nach zum Wasserschöpfen unterwegs war und erst recht nicht um das kleine schweigsame Mädchen, das sie bei sich hatte.
„So spät noch aus der Stadt, Frau?“ Der kleinere der beiden Torwächter, ein rotgesichtiger Mann mit ungepflegten Zähnen, musterte die beiden Krüge auf dem Karren mit kritischen Augen.
Adahs Herz pochte wild, doch sie bemühte sich um einen gleichmütig klingenden Tonfall. „Unsere Wasservorräte reichen nicht, wir haben unerwarteten Besuch bekommen. Ich will draußen an der Quelle welches schöpfen. Du weißt selbst, wie groß der Andrang an den Zisternen um diese Zeit ist.“
Gelangweilt nickte der Rotgesichtige ihnen zu und wandte sich dann ab. Unhörbar atmete Adah auf. Mit einer angedeuteten Kopfbewegung hieß sie Daya, ihr zu folgen. Die Kleine mühte sich, Schritt zu halten, was ihr auf bloßen Füßen schwer fiel. Ihre ledernen Sandalen waren in der unglückseligen Nacht im Haus zurückgeblieben und verbrannt. Winzige Steinchen bohrten sich in ihre Fußsohlen. Warum beeilte Tante Adah sich so? Geh doch langsamer!, hätte Daya ihr am liebsten zugerufen, doch der selbstauferlegte Zwang zu schweigen war stärker und so biss sie die Zähne aufeinander und verschluckte die Worte.
Zielsicher zog Adah den Wagen über den staubigen Pfad aus der Stadt heraus, vorbei an Kornfeldern, die gesäumt waren von Klatschmohn und duftenden Wildkräutern. Die Krüge verursachten auf der Ladefläche ein gleichförmiges Scheppern.
Hinter der ersten Wegbiegung trafen sie auf einen hochgewachsenen Mann mittleren Alters mit schütterem weißem Haar und ebensolchem Bart, der ihm bis auf die Brust reichte. Daya kannte ihn nicht; unverhohlen musterte sie seine Erscheinung. Seine Kleidung, ein schlichter Leibrock, ein Überwurf aus grober Wolle und einfache Sandalen, deuteten auf seine Zugehörigkeit zur Unterschicht hin. Er schien auf sie gewartet zu haben, denn mit langen Schritten kam er ihnen nun entgegen.
Der Weißhaarige wechselte ein paar Worte mit Adah. Allem Anschein nach kannten sie sich, denn Adah sprach ihn mit dem Namen Zadok an. Mit ausgestrecktem Arm deutete er auf einen von vielen Bäumen bewachsenen Hügel in der Talsenke. Daya begriff nicht, warum sie ihre Stimmen dämpften, wo doch niemand in der Nähe war, der sie hätte hören können. Sie verstand nichts von dem, was hier geschah, wusste nicht, wohin sie die Krüge mit den Schriftrollen brachten und auch die Bedeutung des mitfühlenden Blickes, mit dem der Mann namens Zadok sie bedachte, ahnte sie mehr, als dass sie sie verstand. Gemeinsam setzten sie ihren Weg fort, schneller, als es Dayas wundgelaufenen Füßen lieb war. Zadok griff nach dem Knauf der Wagendeichsel, schritt zügig aus und vergaß dabei das kleine, barfüßige Mädchen. Adah warf ihr einen besorgten Blick zu. Als der Weg uneben wurde und sich einen abschüssigen Hang hinunterschlängelte, gerieten die Krüge bedrohlich ins Schwanken. Zadok blieb stehen, wandte sich um und hob Daya mit festem Griff auf den Wagen.
„So ist es besser, nicht wahr?“ Etwas Freundliches lag in seiner Stimme. Artig nickte Daya und umschlang mit jeweils einem Arm die Tongefäße. Kurz darauf erreichten sie die felsige Erhebung inmitten eines dichten Strauchwaldes. Ächzend zogen Zadok und Adah den Karren ins Dickicht, wobei sich der Saum von Adahs Kopfschleier im dornigen Gestrüpp verfing und zerriss. Daya beobachtete, wie Zadok den einen und Tante Adah den anderen Krug herunterstemmte.
„Folgt mir!“, hörte sie Zadok sagen. Der Waldboden unter ihren Füßen war weich, aber bedeckt von herumliegenden Ästen, die Daya das Weiterkommen erschwerten. Hier und da hielt Zadok mit der freien Hand herabragendes Geäst zurück, das ihnen den Weg versperrte. Er schien sich auszukennen in dem unwegsamen Gehölz, zielstrebig durchquerte er das Dickicht und bald standen sie vor dem hinter belaubten Ästen und Gestrüpp verborgenen Eingang einer Felsenhöhle. Dayas kleines Herz klopfte wild, als sie sich hinter Zadok und Tante Adah in das Innere der Grotte zwängte. Stockfinster war es. In der Hoffnung, inmitten der Schwärze etwas zu entdecken, an dem sich ihr Blick festhalten konnte, riss sie die Augen weit auf. Nur schwach drang das Tageslicht von draußen durch den Höhleneingang. Eine Weile verharrten sie still, bis ihre Augen sich an die Dunkelheit gewöhnten. Daya spähte um sich. Ein paar Armlängen von ihr entfernt gewahrte sie einen verschwommenen hellen Fleck, nicht größer als ihre Fingerspitze. Sie sah ihn näherkommen, er erschien ihr wie das Leuchten eines einzelnen Sternes am Nachthimmel.
Stern meiner Nächte. Wie oft hatte sie dies aus dem Mund ihrer Mutter gehört und wie hatte sie es geliebt; eine Liebkosung wie ein Mantel, der einen in kalten Nächten wärmt. Hatte Tante Adah wirklich geglaubt, die Worte könnten in Vergessenheit geraten? Selbst in ferner Zukunft würde Daya sich an sie erinnern, denn längst hatte sie ihnen einen unverrückbaren Platz in ihrem Herzen gegeben. Der Gedanke, nie mehr die geliebte Stimme zu hören, keinen Trost mehr in Imas Umarmung zu finden, entrang Daya ein tonloses Seufzen. Sie presste beide Hände auf die Brust, als ließe sich der Schmerz damit leichter ertragen. Das Leuchten bewegte sich weiter auf sie zu. Erst jetzt erkannte sie, dass es ein Öllicht war, welches Zadok in den Händen hielt. Sein milchiger Lichtkegel erhellte die Umgebung nur schwach, doch er genügte, dem hageren Mann sicheren Schrittes folgen zu können. Am Ende eines niedrigen Ganges gelangten sie durch eine Öffnung in eine Art Grotte. Im Inneren war es warm und trocken und das Öllicht in Zadoks Händen warf zitternde Schatten an die Felswände. Durch eine kleine, ovale Öffnung weit über ihnen fiel Licht herein.
„Hier drüben gibt es eine Felsnische“, sagte Zadok, „darin bewahren wir die Worte des Herrn auf. Auch die Briefschriften der Sendboten haben dort ihren Platz. Bei den Zusammenkünften lesen wir daraus vor.“ Er ging voran, stellte sein Öllicht auf dem Boden ab und schob geräuschvoll mehrere Steinbrocken beiseite, die jemand vor der Nische aufgetürmt hatte. Das dabei entstehende Geräusch kroch die zerklüfteten Felswände hinauf und hallte in doppelter Lautstärke als Echo wider. Erschrocken tastete Daya nach Tante Adah. Sie bekam einen Zipfel ihres Leibrockes zu fassen, an den sie sich klammerte.
„Seid ihr hier in Sicherheit?“, fragte Adah, während sie mit gefurchter Stirn beobachtete, wie Zadok die Krüge nacheinander weit in die Nische hinein schob.
„Sicher sind wir nirgendwo“, erwiderte Zadok. Es klang, als könne er sich nicht zwischen Ernüchterung und Mutlosigkeit entscheiden. „Aber bis jetzt hat Jephta unser Versteck nicht aufgespürt, wir beten täglich dafür, dass es ihm nicht gelingen möge.“ Mit beiden Händen scharrte er die Steine vor der Öffnung zusammen. Adah nickte zufrieden.
„Niemand vermutet, dass sich hier ein Geheimnis verbirgt.“ Zadok griff nach dem Öllicht und erhob sich. „Das Wort unseres Herrn sollte kein Geheimnis sein“, sagte er, „dass die Juden sich mit ihrer halsstarrigen Haltung gegen uns stellen, erschwert die Verbreitung der Schriften sehr. Jeschua wollte dem ganzen Volk sein Wort zugänglich machen, bis an die Enden der Erde. Ich frage mich oft, wie es jemals gelingen soll, wenn die jüdischen Priester nicht aufhören, uns daran zu hindern.“
Gedankenverloren strich Adah dem Kind, das sich ängstlich an ihre Beine schmiegte, übers Haar. „Das, was du sagst, klingt nach großen Zweifeln.“
Zadok senkte den Kopf. Das Halblicht verlieh dem hageren Gesicht mit dem weißen strähnigen Bart beinahe unheimliche Züge.
„Yesha hat nie aufgegeben“, setzte Adah hinzu, als wolle sie damit an Yeshas stärksten Wesenszug erinnern, an ihre Beharrlichkeit, an die zähe Hartnäckigkeit, mit der sie selbst Jephta die Stirn geboten hatte.
„Nein, das hat sie nicht“, bekräftigte Zadok, „sie schien immerfort voller Entschlusskraft und Sicherheit. Nie hegte sie auch nur den leisesten Zweifel daran, dass Jeschua sie und uns alle mit der inneren, göttlichen Kraft versorgt, die wir für unser Tun benötigen.“
Als habe dieses Bewusstsein ihn mit einem Mal gestärkt, sah er auf und hob die Schultern. „Sei unbesorgt, Adah. Du hast mein Wort, dass Yeshas Schriften bei uns in den besten Händen sind. Sie wurde von uns allen hoch geschätzt, eine Jüngerin des Herrn! Wie gebannt hörten wir ihr zu, wenn sie von ihm sprach und uns erzählte, was er direkt an sie weitergegeben hat. Sie erfüllte ihre Aufgabe als Dienerin seines Wortes auf ganz wunderbare Weise. Niemand von uns wird sie je vergessen, das verspreche ich dir. Und wenn du Hilfe brauchst, für dich oder für das Kind …“ Er wandte sich an Daya, die sich noch immer schutzsuchend hinter Adah verbarg und nun unsicher in das bärtige Gesicht des Mannes schaute, von dem plötzlich alles Fremde und Unheimliche abfiel, weil so viel Gutes über seine Lippen gekommen war. „Lass es uns wissen, wenn du Hilfe brauchst“, fuhr Zadok fort, „wir werden euch mit allem unterstützen, was wir haben.“
Adah seufzte und lächelte ihm zu, dankbar für seine Worte, die ihre kummervollen Gedanken besänftigten, wenigstens für ein paar Augenblicke. Dann beugte sie sich vor und hob Daya auf ihre Arme.
„Sie spricht nicht mehr“, sagte sie bedrückt, „seit jener Nacht ist kein einziges Wort über ihre Lippen gekommen.“ Daya schmiegte ihre Wange an Adahs Schulter. Der Weg hierher hatte sie erschöpft, müde schloss sie die Augen. Bald vernahm sie Tante Adahs Stimme nur noch gedämpft. Wie aus weiter Ferne drang sie an ihr Ohr, bis die einzelnen Wörter undeutlich miteinander verschmolzen und schließlich im Nirgendwo verschwanden.
„Lass ihr Zeit.“
„Zeit…“, Adah seufzte auf, „die Zeit ist gegen uns, Zadok. Ich habe die Verantwortung für das kleine Geschöpf. Sie ist nun mein Kind, ich allein trage Sorge für sie. Aber ich bin eine alte Frau, meine Augen versagen mir ihren Dienst. Doch da ist noch so vieles, das ich an Daya weitergeben muss, bevor ich mein Augenlicht völlig verliere. Du weißt ebenso gut wie ich, dass es für Blinde keine Hoffnung gibt. Wenn es mein Los sein soll, als Bettlerin im Armenviertel zu enden, so bleibt mir nichts weiter, als es anzunehmen. Aber Daya …“
Ein erstickter Laut entstieg ihrer Kehle. Das Kind in ihren Armen wurde schwer, gleichmäßig hob und senkte sich der kleine Körper im Schlaf. Adah fasste sich. „Yesha wollte ihre Tochter ebenfalls zu einer Dienerin des Wortes ausbilden. Wir haben oft darüber gesprochen. An Dayas viertem Geburtstag begann sie damit, sie mit den Schriftzeichen vertraut zu machen. Es ist meine Aufgabe, Daya in der Kunst des Schreibens weiter zu unterrichten, aber wie soll ich das tun, Zadok, wenn das Kind nicht mit mir spricht und die Welt vor meinen Augen mit jedem Tag dunkler wird?“
Tapfer schluckte sie die aufsteigenden Tränen. „Ich kann ihr nicht einmal das Wort des Herrn weitergeben, so wie Yesha es tat, mit dieser … Selbstverständlichkeit. Ich weiß, dass Yesha den Nazarener liebte, ihm rückhaltlos vertraute, auch noch, als es sonst niemand mehr tat, weil er sich mit seinen Geschichten vom Gottessohn und der Erlösungsmission selbst ans Kreuz geliefert hat. Sie liebte ihn auf eine Weise, die mir wohl für immer verschlossen bleiben wird.“
Eine Träne rollte über ihre Wange und hinterließ dort eine feine, glänzende Spur. Während sie weiter sprach, umschlang sie Daya mit festem Griff.
„Wir sind völlig mittellos, ich weiß nicht einmal, wo wir wohnen werden. Ich will niemandem zur Last fallen.“
Nachdenklich zupfte Zadok an seinen spärlichen Barthaaren.
„Bei all deinen berechtigten Bedenken“, entgegnete er, „darfst du nicht verzweifeln. Hör mir zu, Adah!“ Eindringlich richtete er seinen Blick auf die vor Gram gebeugte Gestalt vor ihm. „Ich verspreche dir, für euch zu tun, was in meiner Macht steht. Ihr könnt in meinem Haus wohnen, bis sich eine andere Lösung für euch findet. Wenn meine Frau und meine Kinder ein wenig zusammenrücken, wird es schon gehen. Außerdem gebe ich dir mein Wort, dass ich Daya in der Kunst des Schreibens unterweisen werde. Sie wird lesen und schreiben lernen, und wenn sie alt genug ist, um das Wort unseres Herrn zu verstehen, werde ich sie auch das lehren. Es wird mir eine Freude sein, dies für Yeshas Tochter tun zu dürfen.“
Es waren die Träume, schwer und düster, die Daya Angst vor dem Einschlafen bereiteten, Nacht für Nacht. Lodernde Flammen, keine Möglichkeit, ihnen zu entrinnen, gierige Feuerkrallen, die nach einem reglosen, verkohlten Körper griffen, sich in schwelende Haut fraßen und die rot glühende Hitze über die Grenzen des Traums hinaus spürbar machten. Und dann wie durch einen Zauber ein anderer Ort, eine Grotte, tiefe Dunkelheit, ein Tonkrug mit Schriftrollen darin, zerberstend in ungezählte winzige Scherben, auf jeder einzelnen sorgfältig eingeritzte Schriftzeichen, und doch unleserlich. So sehr Daya sich auch anstrengte, es gelang ihr nicht, auch nur eines zu entziffern. Die Träume rissen das Kind aus dem Schlaf und hinterließen ein beklemmendes Gefühl in seiner Brust, welches auf schmerzhafte Weise die Sehnsucht nach der Mutter nährte.
Die Tage vergingen. Es kam der Winter und mit ihm der Regen. In dichten, silbernen Fäden fiel er beinah lotrecht auf das Land, überflutete die Straßen, machte enge Gassen unpassierbar und schwemmte die gelblehmigen Äcker vor den Toren der Stadt auf. Bald blieben die Kaufleute aus und das gewohnte Markttreiben kam zum Erliegen. Einzelne Händler versorgten die Leute mit dem Nötigsten. An den meisten Tagen des Monats Kislew fehlte es den Mahlzeiten an der nötigen Abwechslung. Auch im Haus von Zadok und seiner Frau Judit lagen an nahezu jedem Tag die gleichen Speisen auf den Tellern: Brot in Dickmilch und getrockneter Barsch aus dem Kinneret.
Judit war eine kleine, schweigsame Frau mit hellen Augen, die von morgens bis abends mit flinken Bewegungen ihre Arbeit verrichtete. Adah gegenüber gab sie sich freundlich, aber nicht gesprächig, was Adah bedauerte. Sie vermisste Yesha. Die Erinnerung an gemeinsame Stunden in der Schreibkammer, an hitzige Diskussionen und unbeschwerte Plaudereien hinterließ eine grausame Leere. Zwei von Judits und Zadoks fünf Kindern waren etwa in Dayas Alter. Anfangs gefiel ihnen die neue Spielgefährtin, bereitwillig teilten sie ihr Schlaflager mit Daya. Bald jedoch stellten sie fest, dass dem Mädchen die Stimme und das Lachen fehlten und sie verloren die Freude an ihr. Adah traten Tränen in die Augen, als sie es bemerkte.
Ein wolkenverhangener Tag ähnelte dem nächsten und Adahs Augen litten unter derlei lichtarmen Stunden noch mehr. Immer häufiger stolperte sie, weil sie einen Treppenabsatz nicht rechtzeitig sah und stieß sich Schulter oder Schienbein an Mauervorsprüngen und Türstöcken an. Erst am Morgen hatte sie beim Umgießen der frisch gemolkenen Milch mehr als die Hälfte neben den Krug gegossen, wo sie im lehmgestampften Fußboden im Nu versickert war. Bei Judit hatte sie sich mit verlegener Miene entschuldigt, ihr etwas von Unaufmerksamkeit erzählt und dabei Dayas Gesicht nicht bemerkt, hinter dem sich der Eindruck verhärtet hatte, dass mit Tante Adahs Augen irgendetwas nicht stimmte.
Zadok hielt Wort. Als sich das Wetter besserte und der milde Wind die durchnässte Natur allmählich trocknete, nahm er Daya mit in den kleinen Garten, der an die Westseite des Hauses grenzte, und den ein reich verzweigter Mandelbaum nahezu vollständig ausfüllte. Sie setzten sich in seinen Schatten und Zadok reichte Daya eine braune Tonscherbe sowie einen scharfkantigen Stein, den er an der Schmalseite spitz zu geschliffen hatte.
„Ein Schreibstein“, erklärte er ihr feierlich und Daya wog den Stein in ihrer Hand, die zu klein war, um ihn ganz zu umfassen.
Obwohl sie nicht einmal fünf Sommer alt war, entpuppte sie sich als folgsame und willige Schülerin und lernte erstaunlich rasch. Zadok hatte seine helle Freude an dem Kind und Daya wiederum freute sich, der Eintönigkeit der letzten Wochen entkommen zu können.
„Du bist ein kluges Mädchen“, lobte Zadok seine Schülerin eines Tages. Sie saßen im Schutz des Mandelbaumes, der inzwischen unzählige weiße Blüten trug, und Daya hatte soeben eine Art Prüfung absolviert. „Nun bist du in der Lage, alle Zeichen, die unsere Schrift kennt, wiederzugeben. Du kannst sie unterscheiden und aufschreiben, das ist wichtig. Aber ebenso wichtig ist es, dass du sie aneinanderreihen kannst, hintereinander aufsagen, verstehst du? Damit Worte daraus werden. Man nennt es Lesen. Es ist wichtig, lesen zu können. Auch für Mädchen wie dich. Vielleicht weißt du, dass die jüdischen Gesetze es Mädchen verbieten, schreiben und lesen zu lernen. Wenn du es deiner Mutter aber gleichtun und einmal eine Dienerin des Wortes werden willst, musst du lesen können.“
Er machte eine Pause, offenbar wartete er auf eine Antwort. Doch Daya blickte ihn nur stumm aus ihren klaren, braunen Augen an. Lesen konnte sie doch längst; sie hatte es sich beim Erlernen der Schriftzeichen selbst beigebracht. Um die Muster der Zeichen zu lesen, brauchte man keine Stimme. Man konnte es leise tun, nur für sich allein, mit dem Kopf und dem Herzen. Ein Lächeln umspielte Dayas Lippen, als sie Zadok anblickte.
„Es wäre für dich und auch für mich einfacher, wenn du sprechen würdest“, fuhr Zadok behutsam fort. So schnell schien er nicht aufgeben zu wollen. „Willst du es nicht wenigstens versuchen? Du würdest mir eine Freude machen, wenn du mir zeigst, wie deine Stimme klingt. Versteck sie nicht länger.“
Ich verstecke sie doch gar nicht, dachte Daya und griff nach einer unbeschriebenen Tonscherbe und dem Schreibstein. Zadok wartete geduldig. Lange war nichts zu hören als das eigentümliche Kratzen auf dem Ton, begleitet vom Gurren einer Taube auf einem der Nachbardächer. Schließlich legte Daya den Stein aus der Hand. Prüfend glitt ihr Blick über das Geschriebene, dann reichte sie Zadok die Scherbe und lief ins Haus.
Ich schenkte ihr meine Stimme,
damit sie mich nicht vergisst
und wir miteinander singen und lachen können,
an dem Ort, an dem sie jetzt ist.
Deutlich. Fehlerfrei. Makellos. Lange wog der hagere Mann die Scherbe in den Händen. Immer wieder las er den darin eingeritzten Satz, aus dem die unbedarfte Haltung eines Kindes sprach und der eine so kraftvolle Zuversicht in sich barg, wie Zadok sie nur von Yesha kannte.