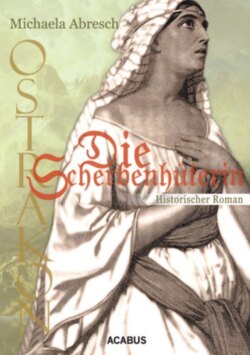Читать книгу Ostrakon. Die Scherbenhüterin - Michaela Abresch - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Оглавление- Kapitel 6 -
Bergland von Gilboa
„HaShem ist mein Herr! HaShem ist mein König, kein anderer neben ihm! Tod den Unterdrückern meines Volkes. Mann gegen Mann. Blut gegen Blut. Der Herr allein führt meine Hand im Krieg gegen Knechtschaft und Unterdrückung!“
Hervorgebracht aus zwei Dutzend Männerkehlen donnerte der Schwur bis unter die Höhlendecke, von wo aus er als vielstimmiges Echo an die Felswände geworfen wurde. In einer Reihe hatten sich die Anwärter, junge, eifernde Männer, beseelt vom Freiheitsdrang und der Vision, den römischen Ausbeutern Jahwes Land zu entreißen, vor Menahem aufgebaut. Mit der rechten Hand auf der Brust leisteten sie den Eid, der sie zu Männern Menahems, zu furchtlosen Streitern Jahwes machte. Aufständische Gedanken im Herzen und hetzerische Worte auf den Lippen zu haben, war die eine Sache – seinen Besitz aufzugeben, die Familie zu verlassen und den geordneten Strukturen des Lebens Unbequemlichkeit, Hunger und Tod als tägliche Gefährten vorzuziehen, eine andere. Ein wahrhaftiger Zelot zu sein erfüllte die Männer, die sich zu diesem Schritt entschlossen, mit innerer Genugtuung und Stolz. Nahezu täglich erschienen wagemutige, junge Männer in den Höhlen, und es schien, als legten sie Moral und Gewissen am Fuß des Gilboagebirges ab wie einen verschlissenen Mantel. Während er sprach, schritt Menahem langsam die Reihe seiner neuen Krieger ab. Dann und wann hielt er inne, um seinen Blick für einen kurzen Moment wie einen wortlosen Appell in eins der vor Ehrfurcht erstarrten Gesichter zu brennen. Keiner wich ihm aus.
„Ihr habt den Schwur geleistet, weil ihr wisst, dass der Allmächtige nur zum Gelingen unseres Vorhabens beiträgt, wenn wir selbst dabei mitwirken. Jeder von euch heiligt unseren Herrn, indem er sich ihm vollkommen zur Verfügung stellt, seine ganze Kraft gibt, seine Gedanken an nichts anderes verschwendet, das Ziel nie aus den Augen verliert. Vergesst niemals, dass das ganze Volk mit Stolz auf euch sieht, denn es leidet unter den römischen Blutsaugern. Aber nur einzelne setzen sich gegen sie zur Wehr – Männer wie ihr! Zeigt Rom, dass dieses Land nur einen Herrn hat, den Wahren, Einzigen, den Allmächtigen!“ Auf den Wink Menahems trat Eleazar hinzu, der einen Beutel aus gegerbter Ziegenhaut in den Armen trug. „In einigen Dörfern gibt es Menschen, die uns unterstützen“, erklärte Menahem, schlug dabei die Ziegenhäute auseinander und griff hinein. „In Saa’qua lebt ein Schmied, ein Verwandter von einem unserer Männer, ein Freund. Er selbst ist zu alt zum Kämpfen, aber er fertigt hervorragende Waffen.“ Mit einer beinahe liebevollen Bewegung legte er sich den Dolch auf die Handfläche. Seine Fingerkuppen strichen über die geschliffene, sichelförmig gebogene Klinge. Nach einem langen Schweigen, das niemand zu unterbrechen wagte, nickte er Eleazar abermals zu, woraufhin dieser zu den Männern trat und jedem von ihnen einen Dolch übergab. Sie wussten alle, wie man eine Stichwaffe führte, doch für die meisten war es ein berauschendes Gefühl, endlich eine eigene am Gürtel tragen zu können. „Morgen vor Sonnenaufgang verlasst ihr die Höhlen“, teilte Menahem ihnen mit ruhigen Worten mit. Er legte die sica zurück zu den anderen, während er weiter sprach. „Durchquert das Tal in nördlicher Richtung und nutzt den Schutz der Wälder. Sucht die Handelsstraße, die von Gischala nach Kfar Nahum führt. Beobachtet die Gegend und schlagt zu, wenn das Pack von Steuereintreibern dort vorbeikommt. Schneidet ihnen die Kehlen durch, wenn sie die Münzen nicht herausrücken wollen und sagt ihnen, dass das jüdische Volk diesem römischen Volksaufhetzer den Bau seiner Paläste nicht länger bezahlen wird! Mein Neffe Eleazar wird euch anführen. Vertraut ihm …“, er wandte sich Eleazar zu, „… so, wie ich ihm vertraue!“
Ein kurzes Nicken, dann verließ Menahem die Höhle ohne ein weiteres Wort.
Bet Shen
Ihr Name war Hannah und der schwarz gelockte Junge ihr Erstgeborener, Mattaji. „Nach dem Jungen blieb mein Schoß viele Sommer leer. Darum sind Menahem und ich so dankbar für unsere kleine Tochter, die uns vor zwei Sommern geschenkt wurde. Ihr Name ist Myra, es bedeutet Die Wunderbare.“ Hannah sprach hastig, mit gleichförmiger Stimme, während sie ihren Gästen nach jüdischem Brauch eine Schüssel mit sauberem Wasser brachte, in der Adah und Daya sich den Staub von Händen und Füßen wuschen. Adahs schleppender Gang und ihre müde wirkenden Züge verrieten, dass die Anstrengung des Fußmarsches ihrem Körper alle Reserven geraubt hatte. Dankbar nahm sie den Becher mit verdünntem Wein, den Hannah ihr reichte und eine Schale Dickmilch, in die sie die abgebrochenen Stücke eines Weizenfladens tunkte und sie dann mit Daya teilte.
Nach dem Essen rollte Hannah zwei große Schlafmatten auf dem lehmgestampften Fußboden aus, breitete Schafwolldecken darüber und wies Adah und Daya einen Schlafplatz an der Wandseite zu. Dann löschte sie, bis auf eine kleine Öllampe neben der Tür, alle Lichter und rückte mit Mattaji und der kleinen Myra eng zusammen.
Lange lag Daya wach. Ihr Zeigefinger malte die Muster der hebräischen Schriftzeichen in die Luft, ganze Worte entstanden auf diese Weise, zuerst ihr eigener Name und gleich darauf der ihrer Mutter, eine Angewohnheit, mit der sie hoffte, dem Vergessen entgegenzuwirken. Sie lauschte auf die ungewohnten Geräusche der fremden Umgebung, hörte Myra im Schlaf leise schmatzen und Hannah, die sich unruhig hin und her wälzte. Aus Mattajis Richtung drangen gleichmäßige Atemgeräusche zu ihr herüber. Daya rollte sich auf den Bauch und hob den Kopf. Im Schein der brennenden Öllampe erkannte sie die Umrisse des Jungen auf seinem Lager. Mattaji. Er hatte seinen Vorrat an Honigdatteln mit ihr geteilt. Ohne Anstrengung beschwor sie die Erinnerung herauf und fast meinte sie, die klebrige Süße noch einmal auf der Zunge schmecken zu können. Anders als bei den Kindern Zadoks und Judits schien es Mattaji nichts auszumachen, dass sie ihre Stimme nicht gebrauchte. Wenn sie es recht bedachte, hatten sie sogar beide Freude daran gehabt, sich wortlos miteinander zu verständigen. Und auch, wenn sie keine Worte dafür fand, so spürte sie doch deutlich, dass etwas an diesem Jungen war, das ihn von anderen Kindern unterschied. Daya reckte sich ein Stück empor. Auf Händen und Knien kroch sie zu ihm heran. Nur schwach flutete der Lichtschein von der Tür herüber, doch er genügte, Mattajis Gesicht für einen langen Augenblick betrachten zu können. Seine Locken ringelten sich auf der hellen Schilfmatte. Vorsichtig tastete sich Dayas Hand vor, um gleich darauf eine seiner Haarsträhnen behutsam durch Daumen und Zeigefinger gleiten zu lassen. Sie fühlte sich weich an, so wie ihr eigenes Haar. Ihre Fingerspitze folgte den Bögen seiner Augenbrauen, fuhr den Nasenrücken herab. Daya hörte ihn atmen. Als sie bemerkte, dass seine Nasenflügel anfingen, plötzlich unkontrolliert im Schlaf zu zucken, wich sie erschrocken zurück. Rasch kroch sie auf ihren Schlafplatz und schlüpfte unter die Decke.
Nördlicher Galil
Das dämmrige Grau des nahenden Morgens verbarg die Gestalten, die sich lautlos wie Raubkatzen auf den verschlungenen Pfaden der Hügel Gischalas bewegten. Zwei Dutzend Männer, ein zusammen gewürfelter Haufen und so verschieden wie die Orte, aus denen sie stammten, brannten darauf, Seite an Seite ihren ersten zelotischen Auftrag zu erfüllen. Zum ersten Mal trugen sie eine jener gefürchteten Stichwaffen im Gürtel, jederzeit bereit, sie zu ziehen. Wortlos folgten sie dem Mann, den Menahem zum Anführer der Mission bestimmt hatte und der ihnen entschlossenen Schrittes voranging: Eleazar ben Yair, der Neffe Menahems. Sie stellten nichts in Frage und taten, was der Auftrag von ihnen verlangte. Am Fuß des Hügels blieb Eleazar stehen, hob den rechten Arm und durchbohrte die Dämmerung mit glühenden Blicken. Nur wenige Schritte von ihnen entfernt verlief die Straße, die in östlicher Richtung nach Gischala und westwärts hinunter zum Yam Kinneret und nach Kfar Nahum führte. Es war der kürzeste und schnellste Weg zum See, weshalb auch die Steuereinnehmer ihn vorzogen. Die Angst vor gewalttätigen Überfällen, von denen man in der vergangenen Zeit fortwährend hörte, versetzte Bewohner und Reisende dieser Gegend in Angst, und wer sein Leben liebte, wählte daher den unbequemen, längeren Weg über die holprigen Ziegenpfade der Hügel.
Eleazar maß den Verlauf der Straße mit seinen Blicken. Einzelne Bäume am Wegrand boten ihm und seinen Männern kaum genügend Deckung, vielleicht aber der mannshohe Strauchwald hinter der langgezogenen Wegbiegung. Für die Dauer eines Herzschlages erinnerte sich Eleazar an eine vergangene Zeit. Auch er hatte an dieser Stelle seinen ersten zelotischen Auftrag erfüllt, zum ersten Mal die sica durch die Kehle eines Menschen gezogen, der in jenem Augenblick alles Menschliche verloren hatte. Noch immer konnte er sich den Blick des hageren Männchens ins Gedächtnis rufen, das vor Angst mit den Zähnen geklappert hatte, als er, Eleazar, ihm ohne einen Wimpernschlag mit einem glatten Schnitt zuerst den Beutel mit den jüdischen Steuermünzen vom Gürtel getrennt und gleich darauf den Hals aufgeschlitzt hatte. Er hatte keine Gegenwehr geboten, nur wie ein getretener Hund um Gnade gewinselt, auch noch, als Eleazar ihm die Spitze der sica bereits ins Fleisch gebohrt hatte. Eleazar wandte sich um. Auf einen stummen Wink lösten sich die Schatten aus der grauen Umgebung, so, als hätten sie nur auf dieses Zeichen gewartet.
Bet Shen
Am nächsten Morgen, kaum dass das erste Tageslicht über die Hügelkuppen gekrochen war, brachen sie auf. Gewissenhaft überprüften Amoz und die anderen die Befestigung der Ladung. Adah litt weiter unter Schmerzen. Die hölzernen Bewegungen und verkniffenen Gesichtszüge ihrer Tante blieben Daya nicht verborgen.
Während die Esel, eingespannt in die verschlissenen Zuggurte, die ersten ungelenken Schritte setzten und der Krugmacherkarren den anderen voran rumpelnd aus dem Dorf rollte, blickte Daya noch einmal zurück. Sie sah Hannah und Mattaji vor dem Haus stehen, das im Zwielicht des neuen Morgens noch erbärmlicher wirkte. Nabor hatte sein Wort gehalten und Mattaji einen Krug Wein für die gewonnene Wette in die Arme gedrückt, den der Junge nun stolz vor sich her trug. Die Karren der Kaufleute entfernten sich und Hannah und Mattaji verwandelten sich allmählich zu kleinen, fernen Punkten. Mit einem warmen Gefühl im Bauch dachte Daya an die Honigdatteln in Mattajis schmutziger Hand und an seine Nasenflügel, die im Schlaf wie die eines Feldhasen gezuckt hatten.
Sie wandte sich erst um, als der Weg eine Biegung beschrieb und die Häuser Bet Shens hinter dem Wall aus Olivenbäumen verschwanden. Drei Stunden waren seit ihrem Aufbruch vergangen. Daya, eingelullt vom Rumpeln der Wagenräder auf dem unebenen Weg, hockte geduldig zwischen Amoz’ Krügen und hätte Tante Adah liebend gern ihren Platz angeboten, wenigstens für eine Weile. Sie beobachtete, wie die Tante mit schleppenden Schritten dem Wagen folgte, stumm und mit gequälter Miene. Doch wie sollte eine erwachsene Frau in die sparsam bemessene Lücke zwischen Henkeltöpfen und Schöpfkrügen passen, wenn sich dort kaum für ein Kind genügend Platz bot? Die Kaufleute indes schienen weitaus besserer Laune zu sein. Nabor und Levi scherzten und lachten miteinander, der Nabatäer summte eine fremdländisch klingende Melodie – vielleicht ein Lied aus seiner Heimat –, das in Daya auf seltsame Weise die Erinnerung an ihre Mutter weckte und Amoz, ehrlich bemüht, Adah von ihrem Kummer abzulenken, gab kleine Geschichten aus seinem Leben zum Besten. Dabei zwinkerte er Daya ein paar Mal aufmunternd zu, merkte jedoch bald, dass er ihr nicht mehr als ein scheues Zucken der Mundwinkel entlocken konnte.
Auf einer Anhöhe brachten sie die Zugtiere zum Stehen. Von hier aus öffnete sich der Blick in das tiefer gelegene Tal mit Laubwäldern, kleinen Ansiedlungen, ockerfarbenen Feldern und der breiten Handelsstraße, die Gischala mit Kfar Nahum verband und das Tal wie eine schlangenförmige Kerbe durchschnitt.
„Von hier aus ist es nicht mehr weit“, rief Amoz mit einer Kopfbewegung zu Adah und dem kleinen Mädchen. Daya war von der Ladefläche geklettert. Ihr wacher Blick folgte Amoz’ ausgestrecktem Arm, der hinunter ins Tal wies. „Seht ihr diese Straße dort unten? Sie führt uns direkt nach Kfar Nahum, zum Ziel eurer Reise.“
Ihren Rücken an die Seitenwand des Wagens gelehnt, seufzte Adah auf. Dann schlug sie beide Hände vors Gesicht, um die Tränen dahinter zu verbergen. Daya wunderte sich, warum Tante Adah sich nicht freute, nun bald das Ziel und damit das Ende aller Strapazen erreicht zu haben. Schon bald würden sie beide bei Imas Familie ein neues Zuhause finden, das war doch Tante Adahs Wunsch.
„Eins muss man den römischen Bastarden lassen“, sagte Levi, „der Bau dieser Straßen ist eine der wenigen guten Errungenschaften, die sie unserem Volk bringen.“ Er wandte sich zu den anderen um. „Stellt euch vor, wir müssten unsere Esel auf all unseren Handelsreisen über die engen Pfade der Hügel treiben. Wir bräuchten für jeden Weg ein Vielfaches an Zeit.“
Nabor und der Nabatäer stimmten ihm zu und während sie ihren Weg fortsetzten, erinnerten sie sich an vergangene Reisen über die unwegsamen Ziegenpfade des Galil, der Nabatäer nahm seinen monotonen Gesang auf und binnen kurzem erreichten sie den Saum des Hügels. Die Sonne stand beinah senkrecht über ihnen, als sie auf die Handelsstraße stießen. Rechts und links wucherte Gestrüpp, einzelne Bäume spendeten spärlichen Schatten. Niemand war zu sehen. Für Daya war es eine Gegend wie unzählige andere und doch schien irgendetwas anders zu sein. Eine unerklärliche Lautlosigkeit hüllte die Umgebung ein, nicht einmal einen Vogel hörte sie in den Bäumen singen. Auch Amoz schien die beunruhigende Stille um sie herum zu bemerken, denn kaum hatten seine Esel die nächste langgezogene Biegung erreicht, zwang er die Tiere mit einem scharfen Ruck zum Stehen. Wie versteinert verharrte er, den Blick in die Ferne gerichtet.
Dann brüllte er seine beiden Esel an und brachte sie gleich darauf in größter Eile mitsamt dem Wagen zum Wenden. Dabei drosch er mit einer Weidengerte auf ihre Hinterbacken ein, dass Daya voller Angst die Augen schloss. Mit eingezogenen Schultern kauerte sie hinter einem bauchigen Tongefäß, umklammerte ihre angewinkelten Beine und wagte erst aufzublicken, als sich das Schütteln und Rumpeln des Krugmacherwagens legte. Sie begriff nicht, was die Männer taten, warum Nabor und Levi keine Scherze mehr machten und das Lied des Nabatäers verstummte, oder weshalb Amoz sie grob unter den Achseln packte und vom Karren riss.
Sie fand sich in den Armen Tante Adahs wieder, die, geleitet vom Weinhändler Nabor, Schutz im Gebüsch gefunden hatte. Verängstigt kauerte Daya sich in die vertraute Umarmung, spürte Tante Adahs zitternde Hände auf ihrem Rücken und ihren keuchenden Atem an ihrer Wange. Sie hob den Kopf. Ihre Augen suchten in Tante Adahs Gesicht nach einer Antwort, doch Adah, die weder die Angst noch die stumme Frage im Gesicht des Kindes wahrnahm, starrte wie gelähmt ins Leere. Die Zeit verstrich. Abwartend verharrten sie im Gestrüpp. Erst als sich Amoz’ Hände durch das wuchernde Strauchwerk schoben und seine Stimme beruhigend auf die beiden einredete, krochen sie heraus.
„Sie sind fort, über die Hügel. Ich habe sie beobachtet“, hörte Daya ihn sagen.
„Zeloten?“, fragte Adah mit tonloser Stimme. Sie klopfte sich den Staub vom Leibrock. Dayas Hände krallten sich in den Stoff ihres Obergewandes, als sie Amoz schwerfällig nicken sah. Zeloten. Da war es wieder. Das Wort, welches, war es erst ausgesprochen, eine unselige Verbindung aus Angst, Beklemmung und stummer Verzweiflung schuf.
„Baruch HaShem!“, rief Levi. Er fiel auf die Knie, hob die Arme empor und begann, seinen Gott anzurufen: „Adonaji, mein Fels, meine Burg, mein Retter, du meine sichere Zuflucht, mein Beschützer, meine Festung auf steiler Höhe! Wenn ich zu dir um Hilfe rufe, rettest du mich vor den Feinden. Auf ewig soll Lobpreis auf meinen Lippen sein, gütiger, unaussprechlich gnädiger Herr.“
Neugierig reckte Daya sich auf die Zehenspitzen, um ihr Sichtfeld zu erweitern. Etwa zwei Steinwürfe entfernt, bemerkte sie ein umgestoßenes Fuhrwerk mit zerborstener Achse am Straßenrand, eines der beiden Räder hatte sich gelöst und war auf die gegenüberliegende Straßenseite gerollt.
„Jüdische Steuereintreiber“, vermutete Amoz, „auf sie haben es die Aufständischen besonders abgesehen. Wir sollten uns hüten, jemals für die Römer zu arbeiten.“ Er wandte sich an seine Gefährten. „Los! Das Herumstehen und Gaffen bringt uns nicht weiter. Lasst uns sehen, dass wir fortkommen.“
Sie passierten die Stelle zügig und wortlos. Sie wagten kaum zu atmen, aus Angst, die grausame Aufmerksamkeit der möglicherweise irgendwo in der Nähe verborgenen Zeloten auf sich zu lenken und sie mit einem falschen Atemzug zurückzuholen. Daya sah den Leib des struppigen Zugesels, bebend und aus zahlreichen kleinen Wunden blutend, und gleich daneben einen menschlichen Körper, seine verdrehten Gliedmaßen, das riesige Weiß seiner Augäpfel, den klaffenden Schnitt in seiner Kehle, die Pfütze aus schmutzigem, geronnenem Blut. Ein stummer Schrei setzte sich in Dayas Kehle, ihr Magen krampfte sich zusammen und nur mühsam unterdrückte sie die aufsteigende Übelkeit.
*
Neunzehn Sommer lang hatte ich mein Heimatdorf Kfar Nahum kaum verlassen. Als ich ein kleines Mädchen war, ließ Ziehvater Zabdiel mich manchmal in seinem Boot sitzen, wenn er mit meinen Brüdern nach Migdal fuhr. Ich liebte die kleinen Reisen auf dem Kinneret. War der Fang üppig, lag das Boot tief im Wasser. Dann saß ich mit Jochanan auf dem Holzbrett an der Heckseite, wir hielten die Gesichter in den Wind und lachten und schrien, wenn die Gischt bis zu uns heraufspritzte. Doch außer Migdal hatte ich nie einen anderen Ort im Galil gesehen. Ich kannte ihre Namen nur aus den Erzählungen meiner Brüder; die großen Städte Zipporij, Caesarea oder die Heilige Stadt in Yehuda, zu der die Männer im Nisan pilgerten, um Pessach zu feiern. Doch seit ich eine Gefährtin des Nazareners geworden war, hatte sich vieles geändert. Die Männer, die er auswählte, ihm zu folgen, ließen mich anfangs ihre Ablehnung spüren. Es waren allesamt fromme Juden und ich wusste, dass sie untereinander ihren Unmut über meine Anwesenheit äußerten. „Sie ist nur ein Weib“, hörte ich sie manchmal zueinander sagen, „was gibt der Rabbi sich mit ihr ab?“ Oder: „Sie ist von heidnischem Blut, wie kann er sie zu unserem Mahl zulassen?“
Solches Gerede machte mich traurig. Hätte ich nicht meinen Ziehbruder Jochanan gehabt, der mich gut genug kannte, um mich immer wieder aufzumuntern oder Jeschua, der mir mit einer Selbstverständlichkeit begegnete, als sei kein einziger Makel an mir, hätte ich den Kreis der Gefährten längst verlassen. So aber zog ich mit ihnen, von Ort zu Ort. Es war kein bequemes Leben. Nicht überall gab man uns eine Herberge, oft schliefen wir auf den Feldern oder in Höhlen. Hunger, Durst und Heimweh lernten wir geduldig zu ertragen. Hin und wieder versorgten uns die Leute mit Nahrungsmitteln. Andere, wohlhabendere, die an Jeschuas Mission glaubten, sich ihm aber aus Angst vor den Römern nicht anschließen konnten, unterstützten uns mit Geld. Am Tage gingen wir in die Synagogen, in denen die Menschen zusammenströmten. Sie alle kamen, um Jeschua zu hören, wenn er vom neuen gerechten Reich Gottes sprach, von der Freiheit des Volkes und der Errettung aus der römischen Unterdrückung. Sie stellten ihm Fragen, berührten seine Kleider, drückten ihm ihre Kinder in die Arme und brachten ihre Kranken, damit er sie heile. Die Begeisterung für den Wanderprediger aus Nazeret schwappte wie eine Welle durch die Dörfer des Galil. Man betrachtete ihn als den von HaShem gesandten Retter des Volkes Ysrael, der mit seiner Armee von göttlichen Streitern unerschrocken gegen Rom in den Krieg ziehen würde. Mit Misstrauen beobachtete ich all dies und irgendwann begann ich mich zu fragen, wie das Bild des kämpfenden Kriegsherrn zu dem sanften, friedfertigen Jeschua passte, den ich kannte.
*