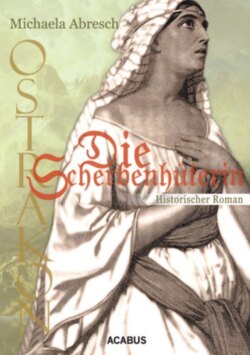Читать книгу Ostrakon. Die Scherbenhüterin - Michaela Abresch - Страница 11
Оглавление- Kapitel 4 -
Bet Shen
Die Bergkuppen waren in Dunkelheit gehüllt, als Eleazar sich lautlos von seinem Schlaflager erhob. Es bestand aus nacktem Fels, einen erbärmlichen Hauch Wärme bot ihm lediglich sein Obergewand. Doch derlei Entbehrungen kümmerten ihn längst nicht mehr. Zimperlichkeit steht Rebellen nicht gut zu Gesicht, hatte sein Vater früher zu ihm gesagt, ihn dabei auf die starken Arme gehoben und seine glühenden Augen auf ihn gerichtet. Nie hatte Eleazar daran gezweifelt, seinem Vater irgendwann nachzueifern. Dem Ruf der Aufständischen zu folgen, war ihm schon als kleiner Junge als die einzig wahre Bestimmung erschienen.
Eleazar tastete nach den beiden faustgroßen Lederbeuteln, die Menahem ihm am vergangenen Abend anvertraut und die er sich vor dem Einschlafen an einem Riemen um den Oberkörper gebunden hatte. Einen Augenblick hielt er inne, um sich dann mit vorsichtigen Schritten und ausgestreckten Armen einen Weg zwischen den schlafenden Männern hindurchzubahnen. Menahem hatte beschlossen, jedes unnötige Risiko auszuschließen, daher ließen sie in den Nächten keine Öllampen und auch kein Feuer mehr brennen. Wortlos nickte Eleazar den beiden Wachposten zu, die vor dem Höhleneingang hockten und seinen Gruß einsilbig erwiderten. Bald darauf fand er den steinigen Gebirgspfad ins Tal. Es war ein steiler Abstieg mit vielen schmalen Windungen, voller Geröll und tiefer Furchen. Es brauchte Übung, sich im Dunkeln zu orientieren, eine Fähigkeit, über die Eleazar verfügte wie kaum ein anderer. Er kannte jede aufragende Steilwand, jede Gebirgsspalte, wusste, an welcher Stelle die Pfade unwegsam wurden und wo steiniger Schutt das Durchkommen erschwerte.
Er setzte seine Schritte mit Bedacht, lauschte wachsam auf die Geräusche der Dunkelheit und erreichte auf diese Weise im Morgengrauen den Fuß des Gebirges. Ins erste Tageslicht getaucht dehnten sich die grünen Ebenen des Yesreel-Tales vor ihm aus, durchzogen von Bachläufen, die sich in zahllosen Kehren durch die Ebene wanden. Er kniff die Augen zusammen. Sein Blick wanderte über die allmählich sichtbar werdenden Konturen seiner Heimat und heftete sich auf den silbrig-grünen Olivenhain, der ihm einst ein wunderbarer Spielplatz gewesen war und der nun sein Ziel markierte. Er schien zum Greifen nah, doch auch wenn Eleazar sich beeilte, würde er viele Stunden unterwegs sein.
Bet Shen war ein winziges Dorf am Saum eines sanft ansteigenden Hügels, eine Ansammlung armseliger Hütten. Die Dächer waren mit Blättern oder Stroh gedeckt und notdürftig mit Lehm abgedichtet. Von Norden her schützte der Hügel das Dorf und zahlreiche, uralte Olivenbäume verbargen es vor den Blicken der wenigen Reisenden, die sich ihm von Westen näherten. Kaum ein Fremder kannte Bet Shen und so blieben die wenigen Einwohner zumeist unter sich. Als er es am frühen Abend erreichte, erschien Eleazar das Dorf verloren und wie von der übrigen Welt vergessen. Obwohl er hier geboren und aufgewachsen war, beschlich ihn mit einem Mal der Eindruck, als sei er ein Fremder, einer, der ungefragt in den geordneten Alltag unbekannter Menschen eindringt. Er gehörte nicht mehr hierher. Er hatte seinem Dorf den Rücken gekehrt, Mutter und Schwester zurückgelassen und war ohne einen weiteren Gedanken seiner Bestimmung gefolgt. So wie sein Vater und sein Großvater vor ihm.
Im Gehen löste er den Trinkschlauch von seinem Gürtel und setzte ihn an die Lippen. Dann ließ er sich mit gekreuzten Beinen am Rande des Olivenhains zu Boden sinken. Er fragte sich, in welcher Verfassung er seine Mutter antreffen würde und ob die Nachricht von der Hinrichtung ihres Mannes sie inzwischen erreicht hatte. Für einen Moment schloss er die Augen. War dem nicht so, oblag es ihm, ihr davon zu berichten. Zum ersten Mal seit dem Tod seines Vaters drang die unabänderbare Tatsache in sein Bewusstsein, künftig die alleinige Verantwortung für seine Mutter zu tragen, wie es das jüdische Gesetz vom ältesten Sohn einer Familie verlangte. Mit der Rechten griff er in den Halsausschnitt seines Leibrockes. Menahem hatte sich überaus großzügig gezeigt. Die beiden Lederbeutel waren prall gefüllt mit Silbermünzen, genug, um viele Monde davon zu leben.
„Du bist zurück, Eleazar!“
Eine Kinderstimme riss ihn aus seinen Gedanken. Eleazar blinzelte gegen die tief stehende Sonne und konnte das Gesicht des Jungen, der mit schmutzigen Füßen und löchrigem Hemd vor ihm stand, nicht erkennen. „Wer bist du?“
„Erkennst du mich denn nicht?“ Der Kleine ging in die Knie und erst, als sie sich auf gleicher Augenhöhe befanden, dämmerte es Eleazar: „Mattaji!“
Die Mundwinkel des Jungen hoben sich zu einem Lächeln. Er nickte heftig, dabei wippten seine schwarzen Locken auf und ab.
„Du warst zu lange nicht hier!“, rief Mattaji mit einer Spur Entrüstung. „Fast hättest du vergessen, wie ich aussehe.“ In gespieltem Trotz verschränkte er die Arme vor der Brust und schob die Unterlippe vor.
Eleazar lachte und kniff ihn freundschaftlich in die Schulter. „Keine Angst, Kleiner. Wie könnte ich dich vergessen? Wir haben doch eine Abmachung, weißt du nicht mehr?“
Ein breites Grinsen überzog Mattajis Gesicht, dabei entblößte er zwei Reihen blitzender, weißer Zähne. „Wie könnte ich sie vergessen haben? Ich kann es kaum noch aushalten. Wie lange dauert es noch, bis du mich endlich mitnimmst?“
Eleazar legte die Stirn in Falten. „Wie alt bist du inzwischen?“
„Im zwölften Sommer.“ Mattaji straffte die schmalen Schultern.
„Nun, dann brauchst du noch ein wenig Geduld. Um ein Zelot zu sein, musst du noch ein gewaltiges Stück wachsen, breite Schultern haben und kräftige Arme. Du musst schnell laufen können und genug Atem in der Brust haben. Außerdem …“ Eleazar stockte, als überlege er, mit welchen Worten er den Satz zu Ende bringen solle. „Außerdem sollte dein Vater darüber Bescheid wissen, Mattaji. Wir ziehen uns seinen Zorn zu, indem wir etwas so Wichtiges tun, ohne ihn vorher um seine Erlaubnis zu fragen.“
Mattaji nickte. Er schien Eleazars berechtigten Einwand zu verstehen. „Mein Vater wird es gutheißen“, rief er voller Überzeugung, „er lehrte mich, dass Söhne ihren Vätern nacheifern sollen und es wird ihm gefallen, wenn auch ich das Unrecht in unserem Land nicht tatenlos hinnehme.“ Seine Augen glühten.
„In deinem Herzen scheinst du schon ein Rebell zu sein“, entgegnete Eleazar anerkennend, „du sprichst wie einer von uns. Und doch bin ich der Meinung, dass dein Vater das letzte Wort darüber haben sollte.“ Mattaji senkte den Kopf. „Dein Vater ist jetzt ein mächtiger Mann dort oben“, erklärte Eleazar mit einer Kopfbewegung hinüber zu den Bergen, deren gezackte Gipfel in diesem Augenblick von der Sonne mit einer Flut aus Gold und Orange übergossen wurden. „Die Männer vertrauen ihm, sie haben ihn zu ihrem neuen Anführer gemacht, nachdem …“
Wieder geriet er ins Stocken und wieder fragte er sich, ob sich im Dorf die Kunde über den Tod des Rebellenführers, der einmal einer ihrer Nachbarn gewesen war, schon herumgesprochen hatte. Abwartend suchte er Mattajis Blick, der noch immer seinen Kopf gesenkt hielt und mit zwei Fingern im Staub scharrte. Als der Junge Eleazars Zögern bemerkte, blickte er ihm fest ins Gesicht.
„Ich weiß Bescheid, Eleazar. Alle im Dorf wissen es. Die römischen Bastarde haben deinen Vater ermordet, nicht wahr?“
Eleazar schwieg.
„Ich bin stolz auf Onkel Yair“, rief Mattaji und die alte Erregung kehrte zurück, „er ist als Held gestorben!“
Einen Augenblick blickten sie sich schweigend an. Eleazar überlegte fieberhaft. Mattaji war noch ein Kind. Mit ihm über die Ermordung seines Vaters zu sprechen, erschien ihm widersinnig.
„Die Römer …“, begann Eleazar, doch Mattaji fiel ihm ungefragt ins Wort.
„Sie sind gemeine Hunde, Eleazar!“, rief er und sprang auf, „sie nehmen sich, was ihnen gefällt, sie fordern Abgaben, die niemand bezahlen kann, für ein Land, das ihnen nicht einmal gehört. Sie dienen einem Herrn, der sich selbst Gott nennt und beleidigen damit den Glauben unseres Volkes.“
Mit wilden Gebärden und funkelnden Augen schritt er auf und ab und in seinen rachsüchtigen Worten und Gesten erkannte Eleazar die glühende Besessenheit eines Zeloten. Mattaji blieb stehen, hob die Schultern und schlug die rechte Hand auf die Herzgegend. Seine helle Jungenstimme zog hinauf in die belaubten Äste der Ölbäume und sie klang entschlossen und vollkommen furchtlos.
„HaShem ist mein Herr! HaShem ist mein König, kein anderer neben ihm! Tod den Unterdrückern meines Volkes. Mann gegen Mann. Blut gegen Blut. Der Herr allein führt meine Hand im Krieg gegen Knechtschaft und Unterdrückung!“
Eleazar erhob sich. Er legte beide Hände auf die Schultern seines Vetters. „Hab Geduld, Mattaji. Deine Zeit wird kommen, ich verspreche es dir. Dann werden wir Seite an Seite für die Freiheit kämpfen.“
Ernst presste Mattaji die Lippen aufeinander und nickte. Eleazar fischte einen der beiden Lederbeutel hervor, wog ihn kurz in der Hand und reichte ihn weiter. „Dies schickt dein Vater. Ihr werdet eine ganze Weile davon leben können. Jetzt geh und grüß deine Mutter und Myra von ihm.“
Mattaji bewegte sich nicht von der Stelle. „Du sagst, mein Vater hat die Stelle des Anführers eingenommen?“
„Ja, die Männer haben ihn als Nachfolger seines Bruders gewählt. Die Führung der Zeloten bleibt damit in unserer Familie.“ Mattaji nickte, erfüllt von Stolz darüber, dass sein Vater nun derjenige war, dem die Aufständischen in den Bergen gehorchten und dem sie den Eid schworen.
„Wohin gehst du, Eleazar?“
„Nun, zuerst werde ich meine Mutter besuchen und auch ihr einen solchen Beutel bringen. Aber ich werde nicht lange bleiben, schon morgen bei Sonnenaufgang …“
Er wandte sich zum Gehen. Sein Blick heftete sich kurz auf die Gilboa-Berge, die den Horizont markierten. Bevor er den Weg ins Dorf einschlug, wandte er sich noch einmal um. „Pass auf deine Mutter und auf deine Schwester auf, Mattaji.“
Als Eleazar am nächsten Morgen Bet Shen verließ, hockte Mattaji unerkannt im Olivenhain. Eine Flamme glomm in seiner Brust, er hatte ihre Hitze immer gefühlt, doch jetzt, nach dem Zusammentreffen mit Eleazar, loderte sie stärker denn je. Sehnsüchtig blickte er seinem Vetter hinterher, bis dieser zu einem winzigen Punkt in der Ferne geworden und schließlich hinter der letzten Wegbiegung verschwunden war.
*
In jenem Jahr feierten wir Sukkot in einer geräumigen, von Shimon und meinen Ziehbrüdern Jaquob und Jochanan errichteten Laubhütte auf einem Hügel im Umland Kfar Nahums. Die Hütte war groß genug, um allen Platz zu bieten, nicht nur Jeschuas besten Freunden, sondern auch deren Frauen und Kindern und einem Dutzend Heimatloser auf der Suche nach einer Bleibe. Wir Frauen schmückten die Hütte nach altem Brauch mit Feststräußen aus Palmzweigen, Myrte, Weiden und Blättern von Zitrusbäumen. In Gebeten und Liedern erinnerten wir uns an die Zeit der Wüstenwanderung, in der unser Volk in Notbehausungen lebte. Es war eine fröhliche Woche. Jeschua war jeden Tag in unserer Mitte, erzählte Geschichten, betete, sang und aß mit uns. Wir Frauen kochten das Essen auf einem Rost über einem großen Feuer vor der Hütte und auch wenn wir uns an manchen Tagen sorgten, es könne zu wenig sein für die vielen Leute, reichte es auf unerklärliche Weise doch. Ich bemühte mich, mir meine zunehmende Traurigkeit nicht anmerken zu lassen, denn ich vermisste Jeschua, auch wenn ich ihn täglich sah. Seit Tagen gab es keinen Augenblick der Zweisamkeit; dabei sehnte ich mich nach diesen stillen Stunden, die nur uns gehörten und in denen er mir das Gefühl verlieh, trotz meiner heidnischen Abstammung ein ebenso vollwertiger Mensch zu sein wie alle anderen und von ihm geachtet und geliebt zu werden. Ich hungerte regelrecht danach.
Dann, am Abend des letzten Festtages, verließ er die Runde der Männer und kam zu uns Frauen vor den Eingang der Hütte. Er bat mich, ihn ein Stück zu begleiten, nannte aber kein Ziel. Schweigend stiegen wir den Hügel hinunter. Wohltuende Stille umgab uns, für die ich, nach den letzten Tagen inmitten der vielen Menschen, dankbar war. Bald erreichten wir das Ufer des Kinneret und fanden einen flachen Felsen, auf den wir uns setzten. Dicht aneinander geschmiegt lauschten wir dem Lied des Nachtwindes in den Schilfrohren und nur unser stummer Begleiter, der Mond, hörte, was wir miteinander sprachen.
„Warum teilst du deine Sorgen nicht mit mir?“, fragte Jeschua.
Ich erschrak, weil es mir offensichtlich nicht gelungen war, meine innere Traurigkeit vor ihm zu verbergen. „Weil sie klein sind“, antwortete ich, „du hast genug damit zu tun, dich um die großen Sorgen der Menschen zu kümmern, um ihre Krankheiten und die vielen Fragen, die sie dir stellen. Ich will dich nicht mit meinen Unwichtigkeiten belasten.“ Da spürte ich, wie sich sein Arm um meine Schultern legte. Ich hob den Kopf und sah ihn an. „Ach, Yesha!“
Er schloss mich fester in den Arm. „Hast du denn noch immer nicht verstanden? Das, was ich tue, ist keine Belastung für mich. Und du bist es auch nicht. Wann begreifst du, dass ich gekommen bin, deine Sorgen und Nöte und alle Verzweiflung mit dir zu teilen?“
Mein Kopf schwirrte. Im Gegensatz zu vielen anderen Gelegenheiten, bei denen er Dinge gesagt hatte, deren Sinn sich mir auch nach langem Überlegen nicht erschloss, klang diese Antwort einfach, fassbar und auf wunderbare Weise ehrlich. Ich wünschte mir, für immer mit ihm an diesem verschwiegenen Ufer bleiben zu können, nur wir beide, niemand sonst. Das ebenso beklemmende wie verhasste Gefühl der Wertlosigkeit löste sich in seiner Gegenwart auf und es war, als habe es nie existiert.
„Sag mir, wie du es machst“, bat ich ihn leise, um den Augenblick nicht zu zerstören. Lächelnd zog Jeschua mich wieder in seine Arme. „Du vertraust mir, das ist alles.“
*