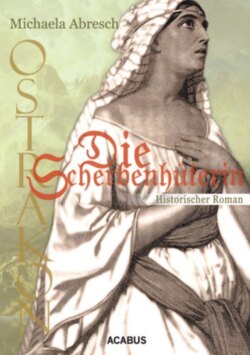Читать книгу Ostrakon. Die Scherbenhüterin - Michaela Abresch - Страница 6
ОглавлениеProlog
Um die Mittagszeit erreichte er die Hügelkuppe. Der Anstieg war unwegsam gewesen und hatte an seinen Kräften gezehrt, mehr als er es sich eingestehen wollte. Das Alter forderte seinen Tribut, eine Erkenntnis, vor der er sich nicht verschloss. „Geliebter Galil“, murmelte er mit einem langen Blick ins Tal. Mit zusammengekniffenen Augen suchte er den türkisblauen Streifen am Horizont, der den weiten galiläischen See markierte, den sein Volk Yam Kinneret nannte und auf dem er einst zuhause gewesen war. Als er ihn fand, wurde es ruhig in seinem Herzen, nur seine Lider zitterten unmerklich für einen kurzen Augenblick. Seine Rechte fuhr durch den zu lang gewordenen Bart, der früher die Farbe von reifen Walnüssen gehabt hatte, inzwischen aber von schlohweißen Strähnen durchzogen war.
Unter den ausladenden Ästen einer Sykomore fand er einen Flecken Schatten für die längst überfällige Rast. Erleichtert sank er auf die Erde. Er hatte gelernt, seine Trinkvorräte einzuteilen, dennoch leerte sich die Ziegenhautflasche stetig. Es wurde Zeit, ein Dorf zu finden, einen Brunnen mit frischem Wasser. Er setzte die Flasche an die Lippen, dankbar für die Erfrischung. Den Kopf zur Seite geneigt, ließ er seinen Blick über die Talsenke wandern. Dies war die Gegend, in der er geboren und aufgewachsen, in der er seine Kindheit zurückgelassen und zu einem Mann geworden war. Er liebte dieses Land, hatte es immer getan. Zahllose Sommer waren vergangen, seit es ihn das letzte Mal hierher verschlagen hatte. Irgendwann hatte er aufgehört, sie zu zählen. Er lenkte seinen Blick nach Westen, über die Weinberge und die üppigen Blumenteppiche aus Klatschmohn und Feldanemonen im Tal. Kornfelder, schattige Olivenhaine und Bauerndörfer schmiegten sich in die grüne Ebene. Wind kam auf, streifte seine Wange, brachte Erinnerungen an vergangene Tage. Heimat. Das sonnengegerbte Gesicht des Vaters.
Beseelt von der Kraft seiner Gedanken, nahm er den vertrauten Geruch der zappelnden silbrigen Leiber im Schleppnetz wahr, sah die feuchten Zedernplanken des Bootes in der Sonne glänzen. Wie aus weiter Ferne drang das Schreien der über den Gischtkronen kreisenden Seevögel an sein Ohr. In Gedanken sah er das Mädchen am Ende der Hafenbucht stehen, kaum jünger als er selbst und er las die unausgesprochene Bitte in ihrem Gesicht. Nehmt mich mit! Er hatte sie geliebt, mehr als er sein Land liebte. In ihren Adern floss die unheilvolle Mischung aus römischem und edomitischem Blut. Eine Ungläubige war sie, unrein bis in die kleinste Faser. Keine Frau, mit der sich ein frommer Jude vermählen, die er als Mutter für seine Söhne auswählen würde. Ein flüchtiger Stich zog durch seine Brust, wie immer, sobald die Erinnerungen ihn einholten. Er erhob sich. Müde, doch mit dem entschlossenen Schritt eines Mannes, der sich ein festes Ziel gesetzt hat, folgte er dem Pfad, der sich in weiten Kehren den Hang hinunterwand.
Wenig später erreichte er Zipporij, das wie ein Vogelnest auf einer Anhöhe thronte. Zu lange war er nicht hier gewesen. Staunend durchquerte er die Stadt, die er kaum wieder erkannte, weil sich so vieles verändert hatte. Die rechtwinklig und sorgfältig angelegten Straßen und prächtige, mit farbigen Mosaiken oder schlanken Marmorsäulen geschmückte Bauten ließen keinen Zweifel aufkommen, dass Zipporij sich unter hellenistischem Einfluss in eine wohlhabende Stadt verwandelt hatte. Auf dem Marktplatz, in dessen Mitte er eine Zisterne fand, wimmelte es von Händlern, die mit fliegenden Handgriffen ihre übriggebliebenen Waren auf die Ladeflächen der Fuhrkarren packten und die Zugtiere anspannten. Mit einer geübten Bewegung zog er den Schöpfeimer aus dem Schacht nach oben und tauchte dann beide Hände ins Wasser, um sich den Staub der Ziegenpfade aus dem Bart zu waschen.
Nach einigem Umherirren fand er das Haus, nach dem er suchte. Es stand nicht mehr am Ende der Straße wie einst. Dort, wo früher das Korn schwer und golden unter dem Sommerhimmel geleuchtet hatte, hatte man die Straße verlängert und zu beiden Seiten neue, prachtvolle Häuser errichtet. Es mussten wohlhabende Bürger sein, die hier lebten. Das Haus aber, vor dem er jetzt stand, sah noch immer so aus, wie er es in Erinnerung hatte. Er klopfte. Während er wartete, zählte er im Stillen die Jahre zurück. Waren wirklich fünfzehn Sommer vergangen, seit er sie zum letzten Mal gesehen hatte?
Dumpf hallten die Klopfgeräusche durch das Innere des Hauses. Adah eilte zur Tür. Seit Chaim im vergangenen Winter an einem qualvollen Husten gestorben war, führte sie das Haus allein; es erfüllte sie mit Unbehagen, wenn zu später Stunde noch jemand um Einlass bat. Ihr Leben lang hatte sie an der Seite ihres Mannes die jüdische Pflicht der Gastfreundschaft gepflegt, ohne zu ahnen, dass sie ihr einmal zur Last werden könnte. Sie schob den Riegel zurück. Durch einen schmalen Spalt musterte Adah den Fremden auf der Schwelle. Er wäre nicht der erste Bettler, der vor Einbruch der Nacht um eine letzte Stärkung bat. Adah warf einen Blick in das Gesicht des Fremden. Er wirkte müde und ungepflegt. Doch körperlich betrachtet schien er im Gegensatz zu jenen erbarmungswürdigen Geschöpfen, die sich sonst auf ihrer Türschwelle einfanden, in recht kräftiger Verfassung zu sein. Bevor er ein Wort über die Lippen bringen konnte, hieß Adah ihn mit einer Handbewegung zu warten und schlug die Tür wieder zu.
Kurz darauf kehrte sie mit einem handtellergroßen Gerstenfladen zurück, öffnete die Tür spaltbreit und reichte ihr Almosen heraus. Doch der Fremde machte keinerlei Anstalten, nach dem Brot zu greifen.
„Nun nimm schon!“ Warum bedankte er sich nicht für die erhaltene Spende, um daraufhin mit einem Segenswunsch auf den Lippen das Weite zu suchen? Beinahe meinte sie, stattdessen ein angedeutetes Lächeln über sein Gesicht huschen zu sehen.
„Der Friede des Ewigen sei mit dir, Adah! Erinnerst du dich nicht an mich?“ Er trat einen Schritt näher, was Adah dazu veranlasste, mit einer raschen Bewegung den Türspalt zu verschmälern, gerade genug, um den Fremden noch mit einem Auge taxieren zu können.
„Ich suche Yesha“, versuchte er es erneut. „In ihrer Heimat Kfar Nahum wurde mir gesagt, dass sie seit vielen Jahren hier in Zipporij in deinem Haus lebt.“
Adahs Gesichtszüge verhärteten sich. „Was willst du von ihr?“ Unwillig musterte sie seine Gestalt. Staubige Füße in ausgetretenen Ledersandalen, die rechte mit einem Strick notdürftig geflickt. Das von der Sonne verblichene Obergewand. Die ausgefransten Risse im Saum des Leibrockes. Ein wild wuchernder Bart. Mit den jüdischen Reinigungsvorschriften schien er es nicht allzu genau zu nehmen.
„Und solltest du einen Namen besitzen“, fuhr sie ihn an, „und auch nur einen Funken Anstand, dann sag mir, mit wem ich es zu tun habe!“ Sie bemerkte die Verlegenheitsgeste, mit der er sich bemühte, die Schäden im fadenscheinigen Stoff seines Leibrockes zu verdecken. Nein, dieser Mann erweckte weder den Eindruck eines Dahergelaufenen, noch den eines Spitzels, die die jüdischen Priester regelmäßig auf sie und Yesha ansetzten.
Er neigte den Kopf und hob die Augenbrauen. Als er seinen Namen nannte, furchte Adah die Stirn. Nach einem langen Augenblick kehrte die Erinnerung mit einer Wucht, die Adah nicht für möglich gehalten hatte, zurück. Sie riss die Tür auf, ließ ihn herein und bat mit vielen Worten um Vergebung. Durch den überdachten Innenhof eilte sie ihm voran zur rückwärtigen Seite, wo ein Durchlass in den Garten führte. Mit einer Handbewegung bot sie ihm Platz auf einer steinernen Bank. „Ich werde sie rufen!“ Sie nickte ihm zu und verschwand im Haus.
Er blickte sich um. Der Garten blühte in leuchtenden Farben. Schwach verströmten die Zitronenbäume ihren Duft in der Abendluft. Er ließ sich auf die Bank sinken, die noch warm von der Hitze des zurückliegenden Tages war. Aus halbgeschlossenen Lidern blinzelte er durch die lichten Zweige eines Ölbaumes.
Ausruhen. Schweigen. Kräfte sammeln. Gerüstet sein für den nächsten Marsch, die nächsten Begegnungen, die nächsten Worte, die immer die gleichen waren und doch in jedem Ohr anders klingen würden. Doch zuvor galt nur die Gegenwart. Yesha. Die nie ganz zu ihm gehört hatte, weil das Gesetz der Juden eine solche Verbindung entschieden verbot. Früher war es auch sein Gesetz gewesen, sein Maßstab. Damals. In der Heimat. Die Zeit hatte sich gewandelt. Inzwischen galten für ihn andere Gebote. Gleichwertigkeit. Brüderlichkeit. Versöhnung. Es gab keine reinen und unreinen Menschen mehr. Nicht in seinem Leben. Nicht in der Neuen Lehre.
Er blickte auf, als er ihre Schritte auf dem Kies hörte, flink und leicht, wie einst, als sie ein junges Mädchen gewesen war. Sie hatte sich kaum verändert. Mit derselben scheuen Anmut, dem gleichen Liebreiz, der sie einst so anziehend für ihn gemacht hatte, bewegte sie sich auf ihn zu. Er erhob sich, streckte wortlos seine Hände nach ihr aus. Sie ergriff sie mit sanftem Druck. Dabei lächelten sie einander an, konnten nicht aufhören damit. Sie achteten nicht auf die Dauer des Augenblicks; er schien zu vergänglich, zu kostbar, ihn voreilig zu verkürzen. Die Zeit anhalten – ein kindischer Wunsch, unerfüllbar. Niemand war imstande, die Zeit festzuhalten. Yesha hob den Kopf, betrachtete sein Gesicht. Älter war er geworden. Jahre und Entbehrungen hatten ihre Spuren wie ein feines Netz in sein Gesicht gezeichnet.
„Es ist lange her.“ Zögernd glitt seine Rechte über ihr Haar und sie schmiegte ihre Wange an den groben Stoff seines Obergewandes. Vertraute Berührungen, die sich richtig anfühlten, so, als sei kein Tag vergangen. „Ich folge meiner Sendung, Yesha. Sie führt mich an Orte, deren Namen ich vorher nie hörte und in Gegenden, viele Tagesmärsche von den Grenzen unseres Landes entfernt.“
Yesha nickte. „Du folgst deinem, ich folge meinem Weg, so wie wir es versprachen.“ Sie spürte seinen Herzschlag unter ihrer flachen Hand. Nie würden sie miteinander leben können wie andere, die sich liebten. Ihre Wiedersehen würden immer zu unvorhergesehener Zeit geschehen, von unbestimmter Dauer sein und jeder Abschied würde überschattet sein von der Ungewissheit darüber, ob sie sich jemals wieder begegnen würden.
Nach Sonnenuntergang nahm Yesha ihn mit zu der wöchentlichen Zusammenkunft in eine Scheune vor der Stadt. Er sprach zu den Menschen, die mit angehaltenem Atem lauschten. Auch Yesha sog den Klang seiner Stimme auf wie ausgedörrte Sommererde den ersehnten Regen. Die Nacht war mondhell und sie ließen sich Zeit mit dem nach Hause kommen. Yeshas Hände lagen in seinen, als er sie unvermittelt anblickte. Sie standen im Schutz eines windschiefen Verschlages aus grob zusammengehauenen Brettern, in dem die Bauern Heu für ihre Ziegen lagerten.
„Ich kann nicht bleiben, Yesha.“
In der Ferne schrie ein Nachtvogel. Sie schluckte schwer.
„Ich weiß.“
Ihre Stimme klang gepresst, nach unterdrückten Tränen. Seine Nähe zu spüren und gleichzeitig zu wissen, ihn schon bald wieder gehen lassen zu müssen, zerriss ihr das Herz. Er zog sie in seine Arme. All das Ungesagte stieg in ihm auf. Worte, die auszusprechen er jedoch nicht wagte, weil seine Vernunft es verbot. Sie standen dicht aneinandergeschmiegt in der Finsternis und mit einem Mal war es anders zwischen ihnen. Im Halbdunkel suchte er ihren Blick. Sie wirkte verletzlich, als sie ihm offen ins Gesicht sah. Ein brennendes Verlangen durchströmte ihre Körper, Hunger, den sie nicht kannten, der sie aufwühlte und ihnen Angst machte. Ineinander verschlungen sanken sie zu Boden. In jener Nacht vergaßen sie alles, was sie jemals voneinander getrennt hatte.