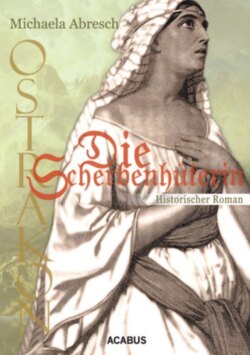Читать книгу Ostrakon. Die Scherbenhüterin - Michaela Abresch - Страница 8
Оглавление- Kapitel 1 -
Zipporij
„Daya.“
Nur ein Flüstern. Und doch klang ihr Name auf die Art, wie sie ihn aussprach, feierlich, beinahe ein wenig stolz. Er bestand aus nur zwei unterschiedlichen Schriftzeichen. Für den zweiten und den letzten Laut sah ihre Sprache kein Zeichen vor; man sprach sie, doch geschrieben wurden sie nicht. Unermüdlich zeichnete Dayas Fingerspitze ihren Namen in den Staub, wieder und wieder. So lange, bis ein zufriedenes Lächeln über ihr Gesichtchen zog, weil sie die Tonscherbe nicht mehr benötigte, die die Mutter ihr gegeben hatte, um von dort abzuschreiben.
„Meine kleine, kluge Daya“, hatte die Mutter an jenem Tag mit einem Lächeln gesagt, die Scherbe behutsam in die Kinderhand gelegt und ihre Tochter auf die Stirn geküsst. „Ima …“ Mehr Worte waren nicht nötig gewesen. Daya wusste, wie sehr ihre Mutter den Kosenamen der hebräischen Kinder für ihre Mütter mochte. „Niemand außer dir darf mich so nennen“, hörte sie Ima manchmal sagen, in stillen, zärtlichen Augenblicken, die nur ihnen beiden gehörten und denen entgegen all ihrer innigen Verbundenheit dennoch etwas Unvollständiges anhaftete, als sei ihnen etwas verloren gegangen, das einmal zu ihnen gehört hatte.
Daya. Der Name, bei dem Tante Adah und Ima sie riefen und der fortan nicht mehr nur einen Klang besaß, sondern auch ein Muster. Noch dazu ein außerordentlich hübsches, wie Daya jetzt feststellte. Aufmerksam betrachtete sie die Schriftzeichen ihres Namens, stieß ihn zweimal, dreimal flüsternd über die Lippen und rief sich dabei die Geschichte in Erinnerung, die ihre Mutter ihr manchmal abends vor dem Einschlafen erzählte. Es war die Geschichte eines hölzernen Bootes, das ihren Namen trug und das einst auf dem großen galiläischen See in ein Unwetter geriet. Sie liebte diese Geschichte, auch wenn ihr Kinderverstand verschiedene Einzelheiten darin nicht begriff. Sie hatte ein gutes, ein befreiendes Ende genommen. Alle hatten das Unwetter überlebt, auch die Daya selbst war später ohne Schäden in den Hafen eingelaufen.
Sie erhob sich, wischte den Staub von ihren Knien, trat einen Schritt zurück und bestaunte ihr Werk. Eine ganze Menge Dayas schnörkelten sich im Staub, so viele, dass es bestimmt keine Zahl dafür gab. Dinge zu zählen, interessierte Daya ohnehin nicht. Stattdessen liebte sie es, Schriftzeichen sinnvoll anzuordnen, den Schwung zu üben, mit dem sie niedergeschrieben wurden und ein Bild daraus entstehen zu lassen, das man lesen konnte. Nicht jeder konnte es. Ima schon. Und Tante Adah. Und sie selbst, ein wenig jedenfalls. Ima betonte oft, es sei für ein jüdisches Mädchen etwas Besonderes, die Schriftzeichen deuten zu können. Nur die wenigsten wurden darin unterrichtet. Schreiben und Lesen war Männersache. Sie lernten es in den Synagogenschulen, deren Besuch den Mädchen verwehrt blieb. „Es wundert mich nicht, dass sie in ihrem Alter schon schreiben kann“, sagte Tante Adah manchmal und dabei zwinkerten ihre Augen. „Wie könnte es anders sein bei der Tochter einer Schreiberin, die zwischen Papyrus und Tinte aufwächst?“ Daraufhin zog jedes Mal ein stilles Lächeln über das Gesicht der Mutter, was Daya nicht verborgen blieb.
„Daya, komm ins Haus! Es ist spät.“ Daya wirbelte herum.
„Ja, Tante Adah. Ich komme gleich.“ Rasch verwischte sie mit bloßen Füßen ihre Schreibübungen, bis aus den vielen Linien und Strichen nichts weiter als gewöhnlicher Straßenstaub geworden war. Morgen würde sie weiter üben.
„Ist Ima noch nicht zurück?“ Auf dem Boden neben der tönernen Wasserschüssel kniend, rieb Daya sich unter den kritischen Blicken der Tante ihre Hände, Knie und Füße so lange, bis sich ihre Haut rötete. „Du weißt, dass die Zusammenkünfte manchmal länger dauern“, antwortete Adah. Sie reichte Daya ein sauberes Leintuch zum Abtrocknen. „Wann nimmt sie mich endlich einmal mit, Tante Adah?“ Adah stieß einen tiefen Seufzer aus. Immerfort die gleiche Frage. Und stets die gleiche ausweichende Antwort: „Du bist noch zu klein.“ Yesha wollte es so; es war eine Absprache zwischen ihnen, an die Adah sich hielt. Es war eine unruhige Zeit, in der sie lebten. Juden und Nichtjuden gerieten häufig aneinander, weil die obersten Priester und Schriftgelehrten um den Bestand der alten mosaischen Gesetze fürchteten und mit Nachdruck gegen die Neue Lehre vorgingen, die die Anhänger des Nazareners verbreiteten. Neulich erst hatte es wieder eine Auseinandersetzung mit Jephta gegeben, dem obersten Sadduzäerpriester des Ältestenrates, einem Hitzkopf mit dem Gesicht eines Greifvogels. Er gab keine Ruhe und seine Anschuldigungen richteten sich vor allem gegen Yesha als Leiterin der kleinen Gemeinde in Zipporij.
Anfangs, als Yesha und die anderen Anhänger der Neuen Lehre die wöchentlichen Zusammenkünfte noch in Wohnhäusern abgehalten hatten, hatte Jephta bezahlte Spitzel zu ihnen geschickt, harmlos aussehende Bürger der Stadt, die geübt darin waren, Interesse zu heucheln.
Seither fanden die Zusammenkünfte an einem geheimen Ort vor den Stadtmauern statt, der dem greisen, starrköpfigen Jephta bisher verborgen geblieben war. Adah nahm die Schüssel und trug sie in den Hof, wo sie das gebrauchte Waschwasser auskippte.
Die Neue Lehre. Sie gründete auf der Botschaft des Nazareners, den sie Jeschua nannten und den man seinerzeit vor den Toren Jerushalajims wegen seiner gotteslästerlichen Reden ans Holz genagelt hatte. Adah erinnerte sich daran, dass Yesha, die viele Monde lang mit ihm und einer Gruppe von Anhängern durch das Land gezogen war, immer an seine Unschuld geglaubt hatte und sein Tod einen Schmerz in ihr ausgelöst hatte, an dem sie beinahe zugrunde gegangen wäre. Einige Zeit nach der Hinrichtung des Rabbis war Yesha überraschend in Zipporij aufgetaucht und hatte Adah und Chaim eine unglaubliche Geschichte erzählt.
Von einer leeren Grabhöhle hatte sie gesprochen – als könnten Tote aus ihrem eigenen Grab spazieren! – und von einer Begegnung mit einem Fremden, der ihrem Jeschua erschreckend ähnlich gewesen sei. Er habe ihr aufgetragen, ihre Erlebnisse mit ihm niederzuschreiben, um sie für nachkommende Generationen zu bewahren. Eine Dienerin seines Wortes solle sie sein. Chaim hatte damals verständnislos den Kopf geschüttelt und Adah war ernsthaft um Yesha besorgt gewesen. Sie hatte die Zuneigung, die Yesha und dieser merkwürdige Nazarener geteilt hatten, zu keiner Zeit verstanden und noch heute fürchtete sie manchmal, dass Yesha nie endgültig über seinen Tod hinwegkommen würde. Adah selbst glaubte seit der Vollstreckung des Todesurteils nicht länger an die Geschichte von Jeschua als dem verheißenen Erlöser. Ein Gott in Menschengestalt – in Adahs Ohren klang das nach den faszinierenden Geschichten, wie sie sich um die Gottheiten der Hellenen oder Römer rankten. Manchmal bewunderte sie Yesha für ihre Unbeirrbarkeit und für den Mut, sich immer wieder in Gefahr zu begeben, wenngleich sie selbst befürchtete, dass die jüdische Obrigkeit ihre Zusammenkünfte auf lange Sicht keinesfalls dulden würde. Regelmäßig gab es bösartige Übergriffe und Yesha ging Woche für Woche ein unkalkulierbares Wagnis ein.
Doch es verging kein Tag, an dem Yesha ihrem Kind nicht etwas über Rabbi Jeschua erzählte, dem Mann, mit dem sie einst durch den Galil gezogen war und der die Angst aus ihrem Leben vertrieben hatte. „Wenn du ihn im Herzen bei dir trägst, haben Angst und Tod und das Böse keine Macht mehr über dich“, hörte Adah sie oft sagen, wenn Yesha am Schlaflager ihres Kindes kniete. Daya war ein kluges kleines Mädchen, und doch schien es Adah zu früh, sie mit derlei Unbegreiflichkeiten zu füttern. Doch es war Yeshas Tochter, nicht die ihre und so schwieg sie.
„Wann bin ich denn nicht mehr zu klein, Tante Adah? Wie lange muss ich warten, bis Ima mich mitnimmt?“
Dayas Stimme riss Adah aus ihren Gedanken. Lächelnd beugte sie sich zu dem Mädchen hinunter und drückte es an sich. „Vielleicht im nächsten Sommer, meine Kleine, wir werden sehen.“ Sie ahnte nicht, dass im nächsten Sommer nichts mehr sein würde wie zuvor.
Bei Einbruch der Dämmerung stellte Adah Öllichter in den Räumen auf. Nach dem Mahl, einem gekochten Brei aus Zwiebeln und Kichererbsen, den sie gemeinsam aus einer großen Schüssel aßen, brachte Adah das Kind zu seinem Schlaflager. Daya tastete nach der kleinen, an den Rändern glattgeschliffenen Tonscherbe. Einst hatte ihre Mutter den Namen Jeschuas mit einem angespitzten Stein hineingeritzt und Daya hatte sie dabei beobachtet. Es war ihr leicht gefallen, sich das Muster der verschiedenen Schriftzeichen zu merken; mit der Fingerspitze hatte sie jedes einzelne in den Straßenstaub gemalt, so oft, bis ihr kein Fehler mehr unterlief. Sie trug die kleine Scherbe stets bei sich. Schlug sie sich beim Herumtollen das Knie blutig, betupfte Ima die Wunde mit einem heilenden Öl, drückte Daya anschließend die Tonscherbe in die Hand und betete zu Jeschua um eine rasche Heilung. Es war ein wunderbares Heilmittel bei Traurigkeit, half gegen Fieber und Bauchschmerzen.
Adah neigte ihren Kopf zu ihr nieder: „Der Herr unseres Volkes möge dich segnen, kleine Daya. Er schenke dir eine friedliche Nacht.“ Sanft küsste sie das Mädchen auf die Stirn. Dann stellte sie ein Talglicht auf den lehmgestampften Fußboden nahe bei der Tür und verließ leise die Kammer.
Es war spät, als Yesha heimkehrte. Sie fand Adah in der Schreibkammer, die sich unter den Wohnräumen in einem unterirdischen Gewölbe befand und zu der man über eine schmale Steintreppe gelangte. Obwohl die wuchtige Holztür beim Öffnen einen langgezogenen, knarrenden Laut von sich gab, schien Adah Yeshas Hereinkommen nicht zu bemerken. Zu sehr war sie in ihre Arbeit vertieft. Yesha vernahm das kratzende Geräusch des Schreibrohres auf Papyrus. Mit einem Öllicht in der Hand trat sie näher. Erst als der zusätzliche Lichtschein die Schatten auf ihrem Arbeitsplatz veränderte, hob Adah den Kopf. Ein flüchtiger Blick auf Adahs Arbeit genügte, um Yesha innerlich aufseufzen zu lassen. Adahs Sehkraft ließ nach. Sie schrieb nicht mehr in der gewohnten, gleichmäßigen Weise, wie sie dies zuvor getan hatte und die Fehler häuften sich. Yesha hatte es längst bemerkt, doch bisher geschwiegen.
„Die Zusammenkunft hat lange gedauert“, stellte Adah fest, ohne in ihrer Arbeit innezuhalten. Sie hatte sich weit vornübergebeugt und erweckte so den Eindruck, mit ihrer Nasenspitze den Papyrus zu streifen. Yesha trat an den zweiten Arbeitstisch, der aus mehreren übereinander gestapelten Steinquadern bestand und stellte ihr Öllicht neben den zur Hälfte beschriebenen Papyrusbogen, auf dem sie gestern einen Brief begonnen hatte. Sie griff nach einem bauchigen Tongefäß, in dem Adah frischen Akaziensaft und Ruß angerührt hatte, eine Mischung, die sie zum Schreiben verwendeten. Sie nahm ein Schreibrohr und tauchte die Spitze in die dunkle Flüssigkeit. Dabei warf sie einen unauffälligen Blick hinüber zu Adah, die soeben ihren schmerzenden Rücken streckte und mit den Fingern der freien Hand nacheinander heftig beide Augen rieb.
Yesha legte ihr Schreibrohr nieder und wandte sich Adah zu. „Es ist etwas mit deinen Augen, nicht wahr?“, fragte sie, „sie sind schlechter geworden.“ Adah sah erschöpft und blass aus.
„Ja“, antwortete sie einsilbig. Sie schwieg einen Moment, vielleicht um nach den richtigen Worten zu suchen. „Manchmal scheint es, als seien sie … ja, als seien sie schrecklich müde. Alles was ich sehe, verschmilzt miteinander.“ Ihre Stimme klang brüchig.
Sie wussten beide, was es für einen Schreiber bedeutete, sein Augenlicht zu verlieren. Seit Chaims Tod erhielten sie ohnehin nur noch wenige Aufträge. Wer einen männlichen Schreiber kannte, der gute Arbeit ablieferte, brauchte keine Frauen, die er für diesen Dienst bezahlen musste. Frauen gehörten ins Haus, an die Kochfeuer und in die Gärten. Sie hatten möglichst viele Söhne zu gebären und ihre Töchter in den Eigenschaften tüchtiger Ehefrauen zu unterweisen. Wozu sollten Frauen lesen und schreiben können? Nur weil Chaim in seiner Tätigkeit als Kopist einen ausgezeichneten Ruf in der griechischen Oberschicht Zipporijs genossen hatte, beauftragten die Großherzigen unter ihnen seine Witwe dann und wann mit kleineren Aufträgen, damit sie und die galiläische Frau, die mit ihrem Kind bei ihr wohnte, das Notwendigste zum Leben hatten. Es waren Almosen, das wussten Adah und Yesha, doch sie sprachen nie darüber.
„Warum hast du nichts gesagt?“, fragte Yesha. Mitfühlend berührte sie Adahs Schulter.
„Ich hoffte, es würde vergehen“, antwortete Adah. Die Verzweiflung in ihrer Stimme war unüberhörbar. Yesha verstärkte den Druck ihrer Hand. Sie bemerkte die aufsteigenden Tränen in Adahs Augen. „Was sollen wir tun, wenn ich nicht mehr schreiben kann? Wovon sollen wir leben, Yesha? Die wenigen Aufträge, die man uns gibt, reichen ohnehin nur für das Nötigste.“
Yesha zog sie an sich. „Ich bin sicher, es wird eine Lösung geben. Die Arbeiten, die wir für gewöhnlich zu zweit anfertigen, kann ich notfalls auch allein bewältigen. Ich werde meine persönlichen Abschriften für eine Weile zurückstellen. Es hätte sogar den Vorteil, dass du dich dann in aller Ruhe um das Haus und unser Essen kümmern kannst.“ Wie einem Kind strich sie Adah, die zehn Sommer älter war, über die bebenden Schultern. Gedankenverloren heftete sich ihr Blick auf die zitternden Schatten, welche die Flammen der Öllichter auf die weiß gekalkten Wände warfen.
In Wahrheit sorgte sie sich nicht nur um die Abschriften und die ausbleibenden Aufträge. Die größere Erschwernis stellte die Papyruslieferung dar, die seit Chaims Tod in zähes Stocken geraten war. Als er noch gesund gewesen war, hatte er regelmäßig mit seinem Handelspartner, dem Salbenmacher Nathan, einem Halbgriechen aus Gadara, Reisen durch das Land unternommen, um neuen Papyrus zu kaufen. Nathan hatte den Papyrus für ihn beschafft und Chaim hatte dafür im Gegenzug Nathans Heilöle und Mixturen katalogisiert.
„Nathan müsste bald wieder nach Zipporij kommen.“ Yesha bemühte sich, ihre Stimme zuversichtlicher klingen zu lassen, als ihr zumute war.
Mit dem Ärmel ihres Leibrockes trocknete Adah ihr Gesicht. „Er war lange nicht hier“, erwiderte sie, „vielleicht lässt er uns den Papyrus noch einmal für die Hälfte.“
Yesha seufzte. Erst beim letzten Mal hatte er ihnen dreißig Bögen für den lächerlichen Preis von drei Silberdenaren überlassen. Yesha hatte sich bei diesem Geschäftsabschluss miserabel gefühlt, doch Nathan schien sich bei dem entstandenen Verlustgeschäft eher um das Wohlergehen der beiden Frauen zu sorgen. Wie kam es, dass Nathan immer auftauchte, wenn die Not am größten war? Damals, als sie in den Bergen von Betsajda dem Tod näher gewesen war als dem Leben. Später in Jerushalajim, als sie nach Jeschuas Hinrichtung, gelähmt vor Schmerz und Angst, ziellos durch die Gassen getaumelt war. Immer war es Nathan gewesen, der sich verantwortlich gefühlt hatte für ihr Leben.
Adah löste sich aus Yeshas Umarmung. „Ich jammere wie ein Klageweib“, schalt sie sich unwillig, „auf diese Weise werden wir unser Problem niemals lösen.“
Yesha lächelte.
Entschlossen legte Adah ihr Schreibrohr in einen ausgehöhlten Stein. „Es ist spät“, sagte sie und griff nach dem Öllicht. „Ich werde schlafen gehen.“
Yesha nickte. Stumm blickte sie der Freundin nach, als diese die Schreibkammer verließ. Dann beugte sie sich über den begonnen Brief und konzentrierte sich auf das Setzen der Schriftzeichen.
*
Yesha, Jüngerin unseres geliebten Rabbi Jeschua, Dienerin seines Wortes, grüßt Mariam, Freundin in Migdal, Nathan und alle, die in der Neuen Lehre und Wahrheit Jeschuas leben.
Meine Aufgabe als Leiterin der Zusammenkünfte lässt mir kaum Zeit, dir Mariam, häufiger zu schreiben, oder dich zu besuchen, was ich sehr bedauere. In Zipporij ist die Lage zwischen Juden und Nichtjuden weiterhin schwierig. Die jüdischen Priester glauben nicht, dass unser Tun und Denken gottgefällig ist. Sie verlangen, dass die Männer sich beschneiden lassen und die jüdischen Vorschriften achten, damit sie zum alten Glauben gehören. Neulich gab es sogar beinahe Handgreiflichkeiten deswegen. Als Frau habe ich es nicht leicht, mich durchzusetzen. Doch Jeschuas Mahnungen von der Gleichheit aller Menschen geben mir Kraft zum Durchhalten und Geduld, treu für Jeschua einzustehen. Und ich folge seiner Sendung. Ich schreibe, wie er es mir aufgetragen hat, damit sein göttliches Wort über alle Grenzen verbreitet wird. Jephta nimmt auch daran großen Anstoß. Er forderte Adah und mich mehrfach auf, unsere Schreibkammer zu schließen, er nennt sie „einen Ort, an dem Frevel und Lügen verbreitet werden.“ Doch ich trage Jeschua in meinem Herzen und spüre die Richtigkeit meines Tuns.
Liebe Mariam, grüße deinen Gemahl, den guten Nathan ganz innig von mir, und sag ihm, wir warten sehnlichst auf ihn, da sich unser Vorrat an Papyrus neigt. Es grüßen dich auch Adah und meine kleine Daya, der Stern meiner Nächte.
In Freundschaft und Verbundenheit mit Jeschua, dem unsere Liebe gehört, Yesha aus Zipporij
*
Entweder lag es an ihren Gedanken oder an dem Inhalt der flehenden Gebete, die sie täglich sprach, dass am folgenden Tag Nathan in Zipporij erschien. Yesha und Daya trafen ihn auf dem Markt, wo er seinen Karren aufgebockt hatte, auf dessen Ladefläche Salben und Öle in flachen, geflochtenen Weidenkörben lagerten. Nathan hatte es nicht nötig, seine Waren mit lauter Stimme und vielen Worten anzupreisen, wie es andere Händler taten. Sein Ruf eilte ihm voraus; jeder, der ihn kannte, wusste um die vortreffliche Beschaffenheit seiner Salben, schätzte die Reinheit seiner Öle und war deshalb bereit, einen angemessenen Preis zu zahlen. Die meisten Salbenmacher verstanden nicht viel von ihrem Handwerk, benutzten bei der Herstellung unreine Gefäße, verwendeten altes Fett, reduzierten die vorgeschriebene Menge an Harzen, Blättern oder Wurzeln und verfälschten damit die Rezepturen.
Als Yesha den Halbgriechen entdeckte, huschte ein Lächeln über ihr Gesicht. Sie kannte Nathan seit vielen Sommern, aber es schien, als verändere er sich nie. Noch immer trug er seine dunklen Haare zusammengebunden als Zopf im Nacken, noch immer blitzte es in seinen Augen und auch das jungenhafte Lachen hatte er sich bewahrt.
„Nathan, wie schön dich zu sehen!“
Sie begrüßten sich mit der erforderlichen Sittsamkeit. Dann hockte Nathan sich nieder, sodass er sich mit Daya auf der gleichen Augenhöhe befand. „Ich grüße dich, kleines Vögelchen.“ Daya kicherte. „Wenn du so weitermachst, wirst du einmal ein ebenso entzückendes Geschöpf wie deine Mutter.“
Nathan strich ihr liebevoll über das dichte, schwarze Haar. Das mitschwingende Bedauern darüber, dass ihm der Segen eigener Kinder verwehrt geblieben war, entging Yesha nicht. Lange war er den Dirnen in den Schänken nachgestiegen, nichts wissend von dem Glück, das Liebende miteinander teilen. Vielleicht hatte er nicht einmal danach gesucht. Und nun, da er in seinem fünften Lebensjahrzehnt in Mariam endlich die Frau gefunden hatte, mit der er den Rest seines Lebens verbringen wollte, blieb ihm der Segen eigener Nachkommen verwehrt.
„Nenn mich nicht so!“, rief Daya ihm zu. Dabei legte sie den Kopf zur Seite und funkelte ihn aus ihren dunklen Augen herausfordernd an. Sie mochte Nathan und fand großen Gefallen an den Neckereien, mit denen er sie zum Lachen brachte. „Nein? Bist du denn kein Vögelchen?“
„Nein, bin ich nicht!“, rief sie in gespielter Empörung. Leise kichernd griff sie nach der Hand ihrer Mutter. „Und warum gab deine Mutter dir dann diesen Namen?“
„Mein Name ist nicht Vögelchen. Mein Name ist Daya, wie das Boot auf dem Kinneret!“
Nathan erhob sich, schürzte die Lippen und trat einen Schritt zurück. „Oho“, rief er mit einer angedeuteten Verneigung, „das Vögelchen mausert sich zu einem eigenwilligen Vogel. Um Vergebung, vielmals! Dann lassen wir uns doch überraschen, wann du deine Flügel entdeckst und in die Lüfte aufsteigt.“
Yesha schmunzelte. „Seit wann bist du in der Stadt?“ Sie wichen einer alten Frau aus, die mit einem Stock drei schmutzige, unwillige Schafe vor sich hertrieb.
„Seit gestern“, erwiderte Nathan. Er hob Daya auf den hinteren Teil der Wagenfläche, wo sie sich neugierig umblickte, aber nichts anrührte. „Ich erreichte Zipporij gerade noch, bevor die Wächter die Stadttore schlossen. In der Herberge am Osttor gab man mir Quartier für die Nacht und einen Platz für meine Maultiere.“
„Aber Nathan“, protestierte Yesha, „du weißt doch, dass Adahs Haus für dich immer …“
„Ich weiß“, fiel Nathan ihr mit einer beschwichtigenden Handbewegung ins Wort, „aber ich kenne doch die gute Adah und ihre Angst, Fremden die Tür zu öffnen, noch dazu so spät. Ich wollte es vermeiden, euch zu erschrecken, wenn ich mitten in der Nacht an eure Tür klopfe.“
Yesha zog die Briefrolle aus dem Gürtel und reichte sie Nathan. „Es ist beinahe ein Wunder, dass ich dich heute hier treffe“, sagte sie, „ich bin zum Markt gekommen, weil ich einen Händler suche, der so gut ist, einen Brief für Mariam mitzunehmen. Die Laufboten sind inzwischen unbezahlbar für uns kleinen Leute geworden.“
Nathan nahm die Rolle entgegen und verstaute sie in einem Lederbeutel, den er bei sich trug. „Mariam wird sich freuen“, sagte er, „sie spricht oft von dir. Und von Daya. Sie würde deine Tochter gerne kennenlernen.“ Yesha senkte den Kopf. Wie oft hatte sie sich vorgenommen, eine Reise nach Migdal zu unternehmen? Längst hatte sie die Freundin in das Geheimnis um Dayas Vater einweihen wollen. Zu niemandem außer zu Adah hatte sie je offen darüber gesprochen und bei Mariam wäre ihr Geheimnis ebenso gut aufgehoben wie bei Adah. Sie sollte mit der Freundin darüber sprechen. Bald.
Daya zupfte Nathan am Ärmel seines Obergewandes. „Hast du Honigdatteln? Ich habe schon so lange keine mehr bekommen.“
„Nicht!“, murmelte Yesha, zu leise, als dass Daya es hätte verstehen können. „Vergib ihr, Nathan. Ich mag es nicht, wenn sie bettelt.“
Nathan suchte Yeshas Blick, doch sie wich ihm aus. „Sieh mich an, Yesha.“ Widerwillig hob Yesha ihr Kinn. „Seid ihr weiterhin in Geldsorgen?“ Sie hatte nie vorgehabt, ihre Bedürftigkeit Nathan gegenüber zu verheimlichen, doch sie nun offen eingestehen zu müssen, lastete ihr wie ein Stein auf der Brust. Es tat ihr weh, Daya auf dem Markt nicht einmal eine Honigdattel kaufen zu können und sie selbst aß seit Wochen bei den Mahlzeiten nur das Notwendigste, damit wenigstens Adah und Daya satt wurden.
Weitaus bedrückender jedoch war die Sorge um das Schreibmaterial. Mit wenig Nahrung würde sie eine Weile auskommen, nicht aber ohne Papyrus. Wie sollte sie Jeschuas Lehre verbreiten, wenn sie keine Mittel mehr hatte, seine Worte niederzuschreiben? Schreiben, lesen, Schriften sammeln, sie Wort für Wort kopieren und weitergeben, damit jedem die Neue Lehre zugänglich gemacht werden konnte. All dies war von unschätzbarem Wert für die Anhänger des Nazareners geworden. Und war es nicht ihr Auftrag? Hatte Jeschua sie nicht als Dienerin seines Wortes nach Zipporij geschickt? Auch die Sendboten wie Shimon und Jochanan, die das Land durchwanderten, um das Wort ihres Rabbis in die entlegensten Provinzen und über die Grenzen Erez Ysraels zu tragen, nutzten seit langem die schriftliche Art der Vermittlung. Erst neulich hatte ein Bote Yesha einen Brief von Shimon gebracht, der weit herumkam und sich oft außer Landes aufhielt. Sein letztes Schreiben hatte er in der Stadt des römischen Kaisers aufgesetzt, dem Zentrum der politischen Macht, wo man die Anhänger des Nazareners mit übelsten Mitteln verfolgte.
„Woran fehlt es euch am meisten?“ Erschreckt fuhr Yesha zusammen. Nathans Stimme hatte sie aus dem Strom ihrer Gedanken zurück in die Gegenwart geholt. Nach Worten suchend hob sie langsam den Kopf. Sie wünschte sich, ihre Scham überwinden und ihm ehrlich antworten zu können. Er meinte es gut mit ihr, hatte es immer getan. „Ich möchte euch helfen, Yesha. Sag mir, wie.“
Die Art, wie er sie ansah, ohne jeden Argwohn, ermutigte sie. „Nun, am meisten fehlt es …“ Sie brach ab und seufzte, bevor sie weitersprach. Wo sollte sie anfangen, welches von den zahllosen Dingen, an denen es mangelte, übertraf die anderen an Wichtigkeit?
„An allem, Nathan. Papyrus natürlich und die Materialien zur Herstellung der Tinte, und endlich einmal wieder einen Fisch im Topf, wir hatten ewig keinen. Adahs letzte Ziege ist uralt und gibt kaum noch Milch, eine neue wäre dringend vonnöten, und, nun ja … für Daya vielleicht ein oder zwei Honigdatteln, die mag sie so gern.“ In ihren Augen schimmerten Tränen, als sie Nathans Blick auffing. Stumm nickte er ihr zu. Sein ernstes und zugleich entschlossenes Gesicht erleichterte sie, die drückenden Sorgen wogen für einen flüchtigen Moment nur noch halb so schwer.
Am Abend stand Nathan vor der Tür. In der Rechten hielt er einen Strick, an dem er eine junge, kräftige Ziege hinter sich her zog. „Der Viehhändler hat nicht übertrieben, sie ist in der Tat mehr als widerspenstig“, presste er hervor, während er das Tier in den überdachten Hof zerrte. „Aber immerhin konnte ich einen Sonderpreis mit ihm aushandeln.“
Daya klatschte vor Freude in die Hände und trieb die neue Ziege zur Hinterseite des Hofes, wo ein offener Durchlass in den Garten führte. Adah begann zu schluchzen.
„Ach Nathan, selbst einen Sonderpreis können wir nicht bezahlen, so nötig wir das Tier auch brauchen können.“
Mit energischem Kopfschütteln wischte Nathan Adahs Besorgnis beiseite. „Lass gut sein, Adah. Du hast mich unzählige Male in deinem Haus bewirtet, deine Tür steht mir jederzeit offen, es gibt immer einen Schlafplatz für mich. Nun bin ich an der Reihe. Nimm die Ziege als Geschenk!“
Ein weiterer Schluchzer entrang sich Adahs Kehle. Besänftigend schlang Yesha einen Arm um sie.
„Ach, da fällt mir ein …“, Nathan fuhr sich durch den dichten Bart. Mit drei langen Schritten stand er in dem Durchlass, durch welchen Daya mit der Ziege verschwunden war. Er blickte in den verwilderten Garten. Dort, wo Adah einst akkurate Beete mit Rosen, Malven und Schwarzkümmel angelegt hatte, war der Boden klumpig, die Strauchrosen verkümmert, und Disteln und Dornen überwucherten die Beete.
„Vögelchen!“ Er spitzte die Lippen. Das Trillern ähnelte dem eines Sperlings und verfehlte seine Wirkung nicht. Sogleich ertönte Dayas Stimme in der Nähe. „Ich heiße Daya!“ Geduckt kam sie hinter dem Stamm des Ölbaumes hervor, sauste lachend an Nathan vorbei und rief: „Hör nur, was er sagt, Ima!“
Nathan bekam ein Stück ihres Leibrockes zu fassen und wirbelte sie zu sich herum. Mit dem lachenden Kind auf dem Arm durchquerte er den Innenhof und verließ das Haus. Kurz darauf stürmte Daya wieder herein. Sie hüpfte zu ihrer Mutter, blickte sie mit leuchtenden Augen an und hielt ihre Hände in die Höhe. Honigdatteln. Süß, klebrig und glänzend. Yesha schluckte, suchte Nathans Blick, nickte und lächelte ihm zu, schweigend, verlegen, voller Dankbarkeit.
Bevor er sich am nächsten Tag verabschiedete, um Zipporij in nördlicher Richtung zu verlassen, brachte Nathan den Frauen zwei Dutzend Bögen Papyrus. „Bezahlt ihn beim nächsten Mal.“ Dass es nicht nach einem Almosen klang, sondern nach einem legalen Geschäftsabschluss, bei dem einer dem anderen einen Vorschuss gewährt, milderte den Aufruhr in Yeshas Gewissen.