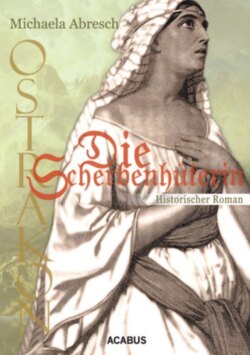Читать книгу Ostrakon. Die Scherbenhüterin - Michaela Abresch - Страница 14
Оглавление- Kapitel 7 -
Kfar Nahum
Kfar Nahum war eine kleine Fischerstadt am Nordufer des Yam Kinneret. Seine Bewohner lebten vom Fischfang und von der Ziegenzucht, die kastenförmigen Häuser aus dunklem Basaltstein wirkten auf den ersten Blick nur wenig einladend auf Besucher. Und doch boten sie bei näherem Betrachten einen gefälligen Kontrast zum wolkenlosen Blau des Himmels und den grünen Hügeln und Wiesen ringsumher.
Der Anblick, die Gerüche und Geräusche der fremden Stadt weckten Dayas Neugierde. Wie durcheinandergeratene Schriftzeichen auf einer Tonscherbe boten sich ihr die neuen Eindrücke dar und sie hatte viel damit zu tun, sie im Stillen zu sortieren, damit sie eine gewisse Ordnung ergaben. Der Wagen rumpelte an der Kaimauer entlang. Dahinter schaukelten im brackigen Hafenbecken die Holzboote der Fischer. Ein Stück weiter erhoben sich die Mauern der Synagoge, von der Sonne in helles Licht getaucht. Der angrenzende Marktplatz schien vor Menschen schier zu bersten.
In der Hoffnung auf ein paar schnelle Geschäfte hielten Amoz und seine Gefährten ihre Wagen an. Steifbeinig kletterte Daya vom Karren. Sie griff nach Tante Adahs Hand, um sie sanft beiseite zu ziehen. Mit einem Seitenblick rief Amoz den beiden zu: „Du bist am Ziel, Frau! Ab hier trennen sich unsere Wege. Sollten mich meine Geschäfte demnächst wieder nach Zipporij verschlagen, werde ich Zadok ausrichten, dass ihr wohlbehalten angekommen seid.“
Adah lächelte gequält. „Ich danke dir, Krugmacher. Möge der Allmächtige euch eine gute Weiterreise schenken.“ Nur stoßweise verließen die Worte ihre Lippen, so, als bereite ihr das Sprechen übermenschliche Anstrengungen. Sie war am Ende ihrer Kräfte, davon zeugten nicht nur der träge Schritt und die gebeugte Körperhaltung, sondern auch der veränderte Klang ihrer Stimme.
Dies bemerkte jedoch außer Daya niemand. Das Mädchen sorgte sich. Unablässig fragte sie sich, wie es nun mit ihnen weitergehen solle. Tante Adahs Augen verloren von Tag zu Tag an Kraft. Daya hatte es längst bemerkt; immerfort bemühte sie sich, Tante Adah kleine Hilfestellungen zu geben, ihr Handgriffe abzunehmen und sie vor Hindernissen zu schützen. Gleichzeitig versuchte sie, Adah nichts davon spüren zu lassen, um ihr das erniedrigende Gefühl der Scham zu ersparen. Während Daya noch in ihre Gedanken und Grübeleien versunken war, beugte sich Adah zu ihr herunter. „Such einen ruhigen Ort, wo wir uns ausruhen können!“ Zum Zeichen, dass sie verstanden hatte, drückte Daya Tante Adahs Hand, eine stumme Vereinbarung zwischen ihnen.
Auf der Suche nach einem abgeschiedenen Platz glitt ihr Blick umher. Was hatte sie erwartet? Sie war ein Mädchen von fünf Sommern, zu klein, um über die Köpfe der Menschen hinwegblicken zu können. Sie erkannte nichts weiter als vorbeihastende Beine unter hellen, grob gewebten Leibröcken, Füße in geschnürten Sandalen, hier und da eine struppige Ziege an einem Strick und eine Menge Kinder mit schmutzigen Gesichtern an den Rockzipfeln ihrer Mütter. Ein lautloser Seufzer entstieg ihrer Kehle. Dann erinnerte sie sich an die hölzernen Boote, die sie im Hafen gesehen hatte. Sie wandte sich in die Richtung, aus der sie gekommen waren und führte Adah neben sich her, bis sie nach wenigen Schritten die Kaimauer erreichten. Der Lärm vom Markt drang nur gedämpft bis hierher. Seevögel staksten neugierig an der Wasserlinie entlang und die Fischer, die einen Steinwurf entfernt ihre Netze für den nächsten Tag vorbereiteten, verrichteten ihre Arbeit schweigend und mit geübten Handgriffen.
Daya und Adah setzten sich auf die niedrige Mauer, die von der Sonne gewärmt war. Daya ließ ihre Füße baumeln. Die vom See heran treibende Brise kühlte ihre erhitzten Gesichter. „Ich rieche den See.“ Daya drückte Tante Adahs Hand. „Es ist der Yam Kinneret. Ich weiß, dass er deiner Mutter viel bedeutet hat. Irgendwo an seinem Ufer gibt es eine verschwiegene kleine Bucht, die sie sehr mochte.“ Weit dehnte sich der See vor ihnen aus, grün schimmernd und glitzernd im Sonnenlicht. Das jenseitige Ufer war von hier aus nicht zu erkennen, nur die Hügel der Golanberge, die sich aus dem Dunst des Horizonts schälten.
„Es wird nicht einfach sein, deine Verwandten zu finden“, sagte Adah in die Stille hinein. Wieder drückte Daya ihre Hand. „Ich sehe nichts, du sprichst nicht, also müssen wir uns gegenseitig ergänzen. Wollen wir das versuchen, meine Kleine?“ Daya rieb ihre Wange an Tante Adahs linkem Arm, fest schloss sich die kleine um die große Hand.
Eine Weile noch blieben sie am Hafen, dann streiften sie über den Markt und durch die Gassen und Daya zupfte, wie besprochen, die Vorübereilenden an den Ärmeln, damit sie aufmerksam wurden und Tante Adah anhörten. Ungezählte Male, immer nach dem gleichen Muster, brachte Adah ihr Anliegen vor. „Auf ein Wort, bitte hör mich an. Ich bin Adah aus Zipporij, die Witwe von Chaim, dem Kopisten. Ich suche die Familie dieses verwaisten Kindes. Seine Mutter stammte aus eurer Stadt. Sie trug den Namen Yesha. Vielleicht hast du sie gekannt?“
An Dutzenden von Ärmeln musste Daya zupfen und ebenso oft trug Adah ihr Anliegen vor, wieder und immer wieder. Es schien kein Ende nehmen zu wollen und die Aussichtslosigkeit ihres Vorhabens wuchs mit jedem Kopfschütteln, mit jedem bedauernden oder unwilligen Blick, den man der Frau mit den leeren Augen und dem kleinen Mädchen zuwarf.
Endlich, nach zwei Stunden Mühsal, trafen sie auf eine Frau mittleren Alters, die sich im Gegensatz zu den vorherigen nicht gleich wegdrehte.
„Yesha, sagst du?“ Sie zog die Augenbrauen eng zusammen und neigte den Kopf ein wenig zur Seite, als habe sie den Namen nicht richtig verstanden oder als wecke er aus einem anderen Grund ihre Aufmerksamkeit. Während Adah ihn wiederholte, musterte Daya die Frau. Sie war von kräftiger Statur, nach jüdischer Sitte in Leibrock und wollenes Obergewand gekleidet und hatte ihr Haar mit einem sauberen, hellen Tuch bedeckt. An ihrem Gürtel baumelte ein bestickter Beutel und im Arm trug sie ein rundes Weidenkörbchen, bis zum Rand gefüllt mit dunkelroten Linsen. Bei ihrem Anblick schlang Daya beide Arme um den Leib, als ließe sich der Hunger mit dieser Geste besänftigen. Sie senkte den Kopf. Hinter den geschlossenen Lidern stieg eine Erinnerung herauf. Die Mutter am Kochfeuer. Ein Topf mit köchelndem Linsengemüse, Zwiebelstücke darin und Knoblauch, würzig duftend, verlockend, warm und sättigend. Heimat.
Die Stimme der Fremden zerrte Dayas Sinne zurück in Gegenwart und vertrieb damit den Blick auf das Vergangene. „Warum soll ich dir glauben?“, fragte sie an Adah gewandt, dabei betrachtete sie Daya mit unverblümtem Misstrauen.
„Woher könnte ich sonst wissen, dass Yesha bei einer Ziehfamilie lebte“, entgegnete Adah geduldig, „sie war eine Waise …“ Im Bewusstsein, dass Yeshas Tochter fortan das Schicksal ihrer Mutter teilen würde, tastete sie nach dem Schopf des kleinen Mädchens. „Yeshas Zieheltern leben beide seit Jahren nicht mehr. Yesha wusste davon. Sie sprach oft von den Geschwistern, mit denen sie hier in Kfar Nahum aufwuchs. Zwei Brüder, beide Fischer, wie der Ziehvater. Eine Schwester in ihrem Alter. Ich glaube, Yesha hatte es schwer in dieser Stadt.“
„Ja, das hatte sie“, gab die Fremde gedehnt zurück. Adah und Daya horchten auf. „Sie war von heidnischem Blut, unehelich geboren, man sagt, ihr Vater sei ein römischer Zenturio gewesen.“ Die Fremde richtete ihren Blick an Adah und Daya vorbei. „Doch die Frau, die sie bei sich aufnahm“, fügte sie hinzu, „kümmerte all dies nicht. Sie widersetzte sich dem Gesetz und hielt ihr Versprechen, für das Kind zu sorgen, als sei es ihr eigenes.“
„Dann glaubst du mir?“, fragte Adah aufgeregt.
Erneut bedachte die Fremde das Kind an Adahs Hand mit einem prüfenden Blick.
„Ja“, entgegnete sie dann, „ja, ich glaube dir. Sie ähnelt ihrer Mutter. Sehr sogar.“
Tränen der Erleichterung rannen Adah übers Gesicht, bevor sie sie fortwischen konnte. „Dann bist du vielleicht so freundlich, mir zu sagen, wo ich das Haus von Yeshas Familie finde?“ Aus jedem ihrer Worte sprach neugewonnene Zuversicht.
Dayas Blick suchend, beugte sich die Fremde leicht vornüber. „Ich selbst gehöre zu der Familie, die ihr sucht.“
„Du selbst? Baruch HaShem!“, rief Adah aus. „Bist du Yeshas Schwester?“
Die Fremde richtete sich auf, umklammerte ihren Korb. „Nein, aber ich lebe in ihrem Haus, seit mein Mann vor zwei Jahren …“ Sie zögerte, ehe sie tief Luft holte und den Satz beendete. „Seit man ihn tötete.“
Daya schluckte. Bilder von aufgeschlitzten Kehlen und angststarren Augen drängten sich ihr auf. „Mein Mitgefühl gehört dir, fremde Frau“, hörte sie Adah leise sagen, „der Friede des Allmächtigen sei mit deinem verstorbenen Gemahl.“
Die Fremde erwiderte nichts, starrte nur blicklos vor sich hin. Dann straffte sie die Schultern. „Mein Mann Jaquob war Yeshas ältester Bruder. Ihr Ziehbruder.“
Sie wandte sich zum Gehen. „Kommt mit mir“, rief sie ihnen über die Schulter zu.
Ihre Augen auf den Rücken der davoneilenden Frau gerichtet, verstärkte Daya rasch den Griff um Tante Adahs Hand. Nur wenig später stand sie mit schmutzigen Füßen, ungekämmtem Haar und so hungrig wie lange nicht mehr auf der Schwelle eines fremden Hauses, das fortan ihre Heimat sein würde.