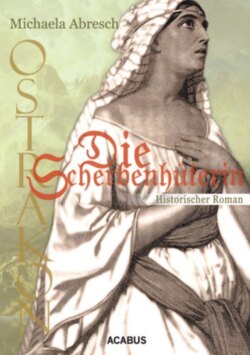Читать книгу Ostrakon. Die Scherbenhüterin - Michaela Abresch - Страница 12
Оглавление- Kapitel 5 -
Zipporij
Man schrieb den Monat Nisan. Vorüber war die Zeit des Opferlamms, der Pessachfeiern, die an das befreiende Ende der jüdischen Sklaverei in Ägypten erinnerten. Vergessen waren die Unwetter der entbehrungsreichen Wintermonate. Das Land blühte in satten Farben, an den Hängen verströmten Wildkräuter ihren ersten würzigen Duft. Die Erde erwachte zu neuem Leben, doch es schien, als vergäße sie dabei Daya und Adah, deren Herzen versteinert und ohne Freude waren. Sie suchten, jede auf ihre Weise, Trost und Antworten auf stumme Fragen.
Daya saß oft stundenlang mit gekreuzten Beinen am Grab ihrer Mutter, vor der wuchtigen Felsscheibe, die die Graböffnung verschloss. Einmal fand Adah sie schlafend, zusammengerollt wie ein schutzloses Tier. Die Sorgen um das Kind raubten Adah die letzten Kräfte. Die Kleine schien unter quälenden Angstträumen zu leiden; zuweilen vernahm Adah erstickte Laute, die Daya im Schlaf hervorbrachte und auch das ruhelose Hin- und Herwälzen blieb Adah nicht verborgen. All ihre Versuche, Daya zum Sprechen zu bewegen, waren bisher ohne Erfolg geblieben. Und als sei dies nicht genug des Kummers, litt sie mit jedem Tag mehr an der unaufhaltsamen Eintrübung ihres Augenlichtes. Das rechte Auge nahm allenfalls den Unterschied zwischen Licht und Dunkelheit wahr, mit dem linken erkannte Adah immerhin Gegenstände und Gesichter, sofern sie sich nicht weiter als eine Armlänge von ihr entfernt befanden. Wurde Adah von der Angst vor der vollständigen Erblindung übermannt, verließ sie das Haus und suchte sich einen einsamen Platz, an dem sie ohne Scheu weinen konnte. In diesen stillen Augenblicken fürchtete sie nichts mehr als den Tag, an dem sie von völliger Dunkelheit umgeben sein würde.
Eines Abends, als es im Haus still geworden war, trat Adah vor dem Schlafengehen noch einmal hinaus in den Garten. Sie hatte vergessen, ein Öllicht mitzunehmen, wie häufig in der letzten Zeit. Es machte keinen Unterschied mehr; der fahle Schleier vor ihren Augen trübte mit jedem Tag mehr ein, daran änderte auch die kleine Flamme einer Öllampe nichts. Es war eine finstere Nacht, der Mond hüllte sich in dichte Wolken. Sie wusste, der Schlaf würde wie üblich auf sich warten lassen, denn seit einiger Zeit kreiste ein Gedanke in ihrem Kopf und sie verspürte eine Mischung aus Erleichterung und wachsender Zuversicht, sobald sie es wagte, ihn zu Ende zu denken.
„Adah, bist du im Garten?“ Die immer etwas heiser klingende Stimme Judits beendete Adahs Grübeleien.
„Ich kann nicht einschlafen“, erwiderte Adah. „Die frische Luft hier draußen tut gut.“ Judit trat näher. Adah fragte sich, ob sie ihre Überlegungen mit Judit teilen könnte. Seit der Zeit, in der sie in ihrem Haus lebte wie jemand, der zur Familie gehört, war nicht ein einziges vertrautes Gespräch zwischen den beiden Frauen zustande gekommen. Bevor Adah weiter darüber nachdenken konnte, hörte sie Judit sagen: „Die Sorge um das Kind raubt dir den Schlaf.“ Adah wandte den Kopf in Judits Richtung und seufzte lautlos auf, als sie nichts als einen dunkelgrauen Schatten neben sich gewahrte. „Ja“, entgegnete sie matt, „manchmal fürchte ich, deswegen den Verstand zu verlieren.“
„Sie fühlt sich nicht wohl bei uns.“
„Ich weiß, Judit. Aber daran trägst du keine Schuld. Auch Zadok nicht. Ihr teilt mit uns, was ihr besitzt, dafür kann ich euch nicht genug danken. Und es besteht nicht einmal die Aussicht, es jemals wieder gutmachen zu können.“ Ein schwacher Duft von Eukalyptus lag in der Luft. Adah atmete tief ein. „Es fällt mir schwer, in eurem Haus als ewiger Gast zu wohnen“, begann sie nach kurzem Zögern, doch dann festigte sich ihre Stimme. „Daya und ich wollen nicht für den Rest unseres Lebens eine Belastung für euch sein. Ihr seid eine kinderreiche Familie und es bekümmert mich, täglich eure Unterstützung in Anspruch zu nehmen.“ Während sie sprach, berührte Judit Adah sanft an der Schulter; es war der erste Kontakt zwischen ihnen, der eine gewisse Nähe herstellte. Adah erschrak beinahe darüber, ließ es jedoch geschehen. „Mein Leben lang habe ich ein großes Haus geführt, Judit. Ich war immer eine wohlhabende Frau und bin nicht erfahren darin, auf die Hilfe anderer angewiesen zu sein.“ Adah schluckte, darum bemüht, ihren Kampf mit den Tränen vor Judit zu verbergen. „Und da ist noch etwas. Meine Augen … du weißt, dass ich nicht mehr gut sehe, aber du ahnst nicht, wie schlimm es geworden ist. Ich werde nicht mehr lange für Daya sorgen können, und sie ist noch zu jung, um für mich zu sorgen. Die Aussichten für eine blinde, alte Frau sind nicht sehr vielversprechend in unserem Land.“
Hastig rieb Adah sich mit dem Ärmel über die Augen. „Es bleibt mir nichts anderes, als die Gegebenheiten hinzunehmen. Mit dem Schicksal hadern hilft mir nicht weiter und die Zeit arbeitet gegen mich.“
„Was willst du tun?“, fragte Judit.
„Daya und ich werden euch verlassen“, erwiderte Adah und wunderte sich über die Unbeirrbarkeit, die hinter ihren Worten lag. Hatte Judit aufgeatmet? Adah furchte die Stirn. Natürlich hatte sie das! Wie hatte sie in all der Zeit nur so töricht sein können, lediglich ihr eigenes Missbehagen in Betracht zu ziehen? Eine so lange Zeit ungebetene Gäste zu beherbergen, Schlafkammer und Nahrung mit ihnen zu teilen, hatte auch Judit zugesetzt. Die Erkenntnis, so spät sie auch kam, bestärkte sie in ihrem Entschluss.
„Wo werdet ihr hingehen?“, fragte Judit.
In vielen Nächten ohne Schlaf hatte Adah sich den Kopf mit dieser Frage zermartert, darum antwortete sie jetzt ohne zu zögern und staunte dabei über die Entschlossenheit, die hinter ihren eigenen Worten lag. „Dayas Mutter stammte aus Kfar Nahum. Sie wuchs dort bei einer benachbarten Familie auf. Ihre Zieheltern leben nicht mehr, aber Yesha erzählte häufig von ihren Brüdern, ihrer Schwester und der Frau ihres ältesten Bruders. Ich werde Daya nach Kfar Nahum bringen und Yeshas Familie bitten, das Kind aufzunehmen. Ich könnte es nicht ertragen, sie zum Betteln auf die Straße zu schicken.“
„Und du hältst es für einen wohl durchdachten Einfall, allein mit dem Kind bis nach Kfar Nahum zu reisen?“ Eine senkrechte Falte grub sich zwischen Zadoks Augenbrauen, was den Eindruck erweckte, als sei er mit den Plänen, die Adah ihm am folgenden Morgen unterbreitete, nicht einverstanden. „Unterschätze den Weg nicht, es sind mindestens zwei Tagesmärsche bis dorthin!“
Adah schwieg. Judit lehnte, eine Tonschale mit frisch gemahlener Gerste im Arm, in der offen stehenden Tür. Niemand bemerkte Daya, die draußen mit angezogenen Beinen unter der Fensteröffnung kauerte und sich nicht einmal anstrengen musste, jedes Wort zu verstehen.
„Außerdem ist es in diesen Zeiten überaus leichtsinnig, ohne Schutz zu reisen“, fuhr Zadok fort. Beschwörend musterte er Adahs Gesicht. „Immer wieder hört man von Überfällen durch Räuberbanden. Erst vergangene Woche wurde eine Karawane von rechtschaffenen Kaufleuten ganz in unserer Nähe angegriffen und beraubt. Sie konnten froh sein, dass man sie am Leben ließ; die Zeloten gehen für gewöhnlich nicht sonderlich behutsam mit ihren Opfern um.“
Adah senkte den Kopf. Im Stillen gab sie Zadok Recht. Wenn Daya auf der Reise etwas zustoßen sollte, trüge sie, Adah, die alleinige Schuld. Hinter ihrer Stirn jagte ein Gedanke den nächsten, während sie fortwährend am Ärmelsaum ihres Obergewandes zupfte. Wie hätte Yesha in dieser Situation entschieden? Es musste sich doch eine Möglichkeit finden lassen, die Reise dennoch anzutreten!
„Denen würde vermutlich die Tatsache genügen, dass ihr aus Zipporij stammt“, fuhr Zadok wild gestikulierend fort, „unsere Stadt gilt als römerfreundlich, was in den Augen der Zeloten die größte Verachtung verdient. Nein, keine Verachtung! Ablehnung, Hass, tiefste Feindseligkeit, die sie zum Schlimmsten befähigt!“ Seine Stimme war unnatürlich laut geworden.
Daya legte den Kopf auf die angewinkelten Knie und umschlang sie fest mit beiden Armen, als ließe sich damit die unheilvolle Stimmung, die auf einmal über allem lag, auf ein erträgliches Maß reduzieren. Wieder vernahm sie Zadoks Stimme, noch immer aufgebracht, gleichzeitig aber auch besorgt. „Wenn du dich von deinem Vorhaben nicht abbringen lässt, kann ich nichts dagegen tun. Aber ich lasse auf keinen Fall zu, dass ihr ohne Begleitschutz reist!“
Nur wenige Tage später fand Zadok auf dem Markt eine Gruppe Handelsreisende, die ihrer Geschäfte wegen quer durch das Land zog. Ohne Umstände erklärten sie sich bereit, die blinde Frau und das Kind bei sich aufzunehmen. Für das Versprechen, den beiden Schutz zu gewähren und sie unversehrt bis nach Kfar Nahum zu bringen, zahlte Zadok ihnen zwei ganze Silberdenare, wovon Adah und Daya nie etwas erfuhren. Dem Trupp, der Adah und Daya aufnahm, gehörten vier zweiachsige Wagen an, die von jeweils einem Paar Eseln oder Maultieren gezogen wurden. Platz zum Sitzen boten die Wagen kaum, die Händler schritten meistens neben ihnen her und führten dabei die Zugtiere an Seilen. Amoz, ein Mann von gedrungener Statur, führte die Kolonne an. Seine tiefe Stimme hatte Daya anfangs Furcht eingejagt. Jedes Wort, das er von sich gab, klang, als spräche er es im Groll. Doch sein freundliches Gesicht und die Art, wie er mit Adah und Daya sprach, deuteten darauf hin, dass sie es mit einem rechtschaffenen Mann zu tun hatten. Noch bevor sich die Wagen in Bewegung setzten, bot er Daya einen Platz auf der Ladefläche an. So hockte sie mit gekreuzten Beinen zwischen Töpfen, Bechern und Krügen und obwohl alles sorgfältig in Tücher eingeschlagen war, rumpelte und schepperte es während der Fahrt beängstigend. Während sie Zipporij über die breite Handelsstraße verließen und das Aussehen der Landschaft ihr langsam fremd wurde, lenkte Daya ihren Blick zu Adah. Weder entging ihr der veränderte Gesichtsausdruck noch die ins Leere starrenden Augen und auch nicht Tante Adahs linke Hand, die sich so fest an die aus grobem Holz gezimmerte Seitenwand des Karrens klammerte, dass die Knöchel weiß hervortraten.
Daya erinnerte sich an einen der vergangenen Tage. Sie hatten draußen unter dem blühenden Mandelbaum in Zadoks Garten gesessen und Tante Adah hatte Daya auf ihren Schoß gehoben. Sie sei alt geworden, hatte sie mit erstickter Stimme zu erklären versucht, ihre Augen seien zu nichts mehr nütze und für sie, Daya, sei es das Beste, zur Familie ihrer Mutter zu gehen. Tante Adah hatte verzweifelt nach Worten gesucht, kaum die Tränen zurückhalten können, hatte Daya immer wieder an sich gedrückt und ihr schließlich ein paar neue Sandalen angezogen, gekauft von geborgtem Geld.
„Der Weg nach Kfar Nahum ist weit“, hatte sie gesagt, als sie mit zittrigen Fingern die Lederschnüre oberhalb von Dayas Knöcheln verknotete. Es hatte lange gedauert, Daya hätte die Knoten schneller fertig gebracht, doch sie wollte Tante Adah nicht beschämen. Sie wusste längst Bescheid, auch wenn Tante Adah nie mit ihr über ihre kranken Augen gesprochen hatte. Stumm hatte sie mit den Fingerspitzen den Strom aus Tränen im Gesicht der Tante berührt, in der Hoffnung, damit die unausgesprochene Frage deutlich machen zu können.
Warum weinst du, Tante Adah? Wir gehen fort von hier, aber wir bleiben doch zusammen, auch wenn wir bei Imas Familie leben. Niemand wird uns jemals trennen.
Daya spürte die Niedergeschlagenheit, die Tante Adah wie ein Schatten durch die Tage folgte. Sie hob ihren Arm und berührte mit ihrer kleinen Hand die verkrampften Finger auf der Seitenwand des Karrens. Überrascht sah Adah auf, ein winziges Lächeln umspielte ihre Lippen, doch ihr Blick verlor sich über Dayas Schulter in einer undurchschaubaren Leere.
„Wir werden nicht auf direktem Weg nach Kfar Nahum reisen“, sagte Amoz an Adah gewandt.
Daya horchte auf. Es war Mittag, die Sonne stand an ihrem höchsten Punkt. Die bewaldete Anhöhe, auf der sie sich befanden, schien den Kaufleuten geeignet für eine Rast und sie brachten ihre Zugtiere im Schatten der Bäume zum Stehen.
„Nicht direkt nach Kfar Nahum?“, wiederholte Adah, „was bedeutet das?“ Mit den Zipfeln ihres Kopfschleiers wischte sie sich den Schweiß aus dem Gesicht. Daya kletterte von der Ladefläche, froh, ihre Beine ausstrecken und sich bewegen zu dürfen.
Amoz indes zerrte zwei mit langen Schnüren versehene Säcke aus gegerbter Ziegenhaut vom Wagen. „Das bedeutet, wir werden vorher einige Ortschaften in der Umgebung aufsuchen, um ein paar Geschäfte zu machen.“ Mit den Säcken unterm Arm verschwand er hinter dem Gebüsch, das den Weg säumte. Adah seufzte auf. Nun würde die Reise länger dauern als die geplanten zwei Tagesmärsche. Erschöpft löste sie ihren Trinkschlauch vom Gürtel und nahm einen großen Schluck.
Bald darauf kehrte Amoz zurück, unter jedem Arm einen mit Wasser gefüllten Sack. Während er jedem seiner Zugtiere mit geschickten Handgriffen einen dieser Wassersäcke zum Saufen um den Hals band, wandte er sich wieder an Adah. „He, Frau! Setz dich mit deinem Kind in den Schatten und ruh dich aus, es liegen noch ein paar Stunden vor uns.“
Der letzte Teil des Satzes genügte, um Adah vollends zu entmutigen. Mit einem kummervollen Seufzer sank sie auf die Erde. Hatte sie ihr Vorhaben unterschätzt und nicht nur dem Kind, sondern auch sich selbst eine Last aufgebürdet, die sie kaum imstande war zu tragen? Sie spürte, wie sich der warme Körper Dayas an ihren schmiegte und wünschte sich, das Gesicht des Kindes sehen zu können, um dessen Befindlichkeit darin zu lesen. Durch das eigene, verlorene Augenlicht und die fehlende Stimme Dayas schien es Adah manchmal, als wüchse die Entfernung zwischen ihr und dem Mädchen jeden Tag ein wenig mehr. Nur die gegenseitigen Berührungen rückten dieses bittere Gefühl für kurze, vergängliche Augenblicke wieder gerade. Sanft strich sie dem Kind übers Haar.
„Hier, esst etwas, bevor wir weiterfahren.“
Amoz reichte Daya zwei harte Kanten Brot und ein kleines Stück Ziegenkäse. Daya überlegte kurz, dann nahm sie Adahs Hand und drückte ihr ein Stück Brot und den ganzen Käse hinein. Amoz wandte sich beschämt ab. Der Bissen Käse, den er selbst gerade zum Mund geführt hatte, verklumpte zu einem Kloß. Er brachte ihn kaum herunter.
Nachdem alle Zugtiere getränkt waren, ließen sich die Kaufleute im Gras nieder. Daya, die an den tiefen und gleichmäßigen Atemzügen Tante Adahs bemerkte, dass diese eingeschlafen war, wagte nicht, sich zu bewegen. Reglos kauerte sie in der Umarmung der Tante und spitzte dabei aufmerksam die Ohren. Sie erkannte die Stimme Nabors, des Weinhändlers, der ihr am Morgen eine Handvoll getrocknete Trauben geschenkt hatte. Er war ein breitschultriger Riese mit dichtem, braunem Bart und buschigen Augenbrauen.
„Es wäre nicht das erste Mal, dass ehrsame Bürger, Ziegenhirten oder Kaufleute wie wir in Handgemenge geraten!“, sagte er zwischen zwei Bissen Brot zu seinen Reisegefährten. Eine andere Stimme meldete sich zu Wort, sie gehörte dem Spezereienhändler, den sie seiner Abstammung wegen, so als habe er keinen richtigen Namen, nur den Nabatäer nannten.
„Nabor hat Recht. Wir sollten nichts riskieren. Lasst uns die Umwege meiden und lieber den sicheren Weg nach Gischala nehmen und von dort aus nach Kfar Nahum reisen. Nur wegen ein paar Dörfern, in denen nicht einmal viel zu verdienen ist, sollten wir die Gefahr nicht eingehen.“
„Ach, was soll schon passieren?“ Amoz, beide Hände in die Hüften gestemmt, beharrte auf dem gefährlicheren Umweg. „Wir sind Juden, genau wie sie. Der Hass der Zeloten richtet sich gegen die Römer, aus welchem Grund sollten sie uns etwas tun?“
„Ihre Gründe sind nicht mit gesundem Menschenverstand nachzuvollziehen, Amoz“, entgegnete Levi, der Tuchhändler, „man hört neuerdings von Schutzgeldern, die sie von den Reisenden erpressen. Und was machst du, wenn ein Zelot dir eine sica an die Kehle drückt und einen Beutel deiner Münzen verlangt? Nichts machst du, nichts! Weil sie dir keine Wahl lassen!“ Noch immer schienen Amoz die Argumente seiner Gefährten wenig zu beeindrucken.
„Amoz!“, rief Nabor entrüstet und verlieh seiner Stimme einen scharfen Unterton, „hast du vergessen, was passiert ist? Eine Karawane fahrender Kaufleute wurde überfallen, weil einer von ihnen die römische Garnison in Zipporij regelmäßig mit Wein beliefert. Den Aufständischen genügt es, wenn du gemeinsame Sache mit den Römern machst! Sobald du auch nur eine Silbermünze von Rom für deine Dienste annimmst, bist du für die Zeloten ein Feind!“
„Ach was!“, gab Amoz leichtfertig zurück. „Von uns macht keiner Geschäfte mit den Römern, oder täusche ich mich?“ Niemand erwiderte etwas. Levi murrte leise, während er weiter kaute. „Na, dann ist doch alles bestens“, rief Amoz, „was also spricht noch dagegen?“
Einer der Männer senkte seine Stimme, was Daya dazu veranlasste, sich nun doch vorsichtig aus Tante Adahs Umarmung zu lösen. Unauffällig rückte sie ein wenig von ihr ab, um das Gespräch der Männer weiter zu belauschen. Der Mann, dessen Stimme Daya dem Tuchhändler zuordnete, fragte: „Was ist mit der Frau? Weiß jemand etwas über sie? Kann sie uns vielleicht in Schwierigkeiten bringen?“
Amoz stöhnte leise auf und auch er antwortete nun mit gedämpfter Stimme. „Ich bitte dich, Levi! Sie ist eine alte, blinde Frau; eine anständige Bürgerin der Stadt, wie mir versichert wurde. Welchen Anstoß sollte ein Zelot an ihr nehmen? Sie hat ihr ganzes Hab und Gut verloren und bringt das Kind nun in die Obhut von Verwandten. Ganz gewiss hat sie nichts mit den Römern im Sinn.“
Zwar vernahm Daya die Worte, die die Männer wechselten, doch deren Sinn wollte sich ihr nicht erschließen. Aufständische. Handgemenge. Begriffe, die ihr zuvor nie zu Ohren gekommen waren. Etwas in den Stimmen der Männer hatte beunruhigend geklungen, sodass Daya rasch die Augen schloss und ihr Gesicht wieder an Adahs Schulter drückte, um in den gleichförmigen Atemzügen der Tante Trost zu finden. Sie beide gehörten zusammen, mochten Menschen und Dinge ringsumher auch fremd und voller undurchschaubarer Rätsel sein. Nichts würde sie je von Tante Adah trennen.
Die Dämmerung senkte sich über das Land, als sie die in einer Senke und hinter einem Olivenhain gelegene Ansiedlung gewahrten. Amoz hatte sich durchgesetzt. Sie hatten die Handelsstraße verlassen und waren den schmalen, holperigen Wegen am Fuß der galiläischen Berge gefolgt. In mehreren Dörfern hatten sie unbehelligt ihre Waren verkauft und die befürchteten Zwischenfälle durch die Rebellen, die sich in den Höhlen der Berge verschanzten, waren ausgeblieben. Dadurch war es später geworden als sie es geplant hatten, und nun hofften sie auf eine saubere Herberge für sich und einen Unterstand für die Tiere. Aus den Fensteröffnungen der dicht beieinander stehenden, ärmlich wirkenden Häuser glomm der Schein der gerade entzündeten Öllichter.
„Du glaubst doch nicht, dass wir in dieser Trostlosigkeit einen Platz zum Schlafen finden?“, wandte Levi sich an Amoz, der seine Esel mit einem kräftigen Ruck am Zügel zum Stehen gebracht hatte und mit prüfendem Blick auf das knappe Dutzend Häuser spähte.
„Ich wette um einen Krug meines besten Weines, dass dieser erbärmliche Flecken hier nicht einmal einen Namen hat!“, brummte Nabor.
„Ich wette dagegen!“ Eine Gestalt löste sich aus dem Schutz der Olivenbäume, ein Junge mit schmalen Schultern und schwarzen Locken, die ihm bis auf die Schultern reichten. Überrascht wandte sich Amoz ihm zu. Sein Lachen dröhnte unnatürlich laut, machte dem Jungen allem Anschein nach jedoch keine Angst.
„So, du hältst dagegen? Na, dann musst du dir deiner Sache aber recht sicher sein.“ Heftig nickte der Junge. Dabei wippten seine Locken auf und ab. Furchtlos trat er einen Schritt näher. Amoz’ Stimme schien ihn ebenso wenig einzuschüchtern wie sein Lachen. Mit einem raschen Blick streifte er die Ladeflächen der Wagen und zugleich begannen seine Augen zu leuchten. „Ihr seid Kaufleute?“
Nabor und Levi stießen sich an und grinsten. „Und ob wir das sind!“, rief Nabor, „aber lenk nicht ab, Kleiner! Du bist uns eine Antwort schuldig. Wenn du die Wette und den Krug Wein gewinnen willst, musst du uns beweisen, dass du Recht hast.“
„Bet Shen“, antwortete der Junge, „so heißt unser Dorf und ich wohne da drüben.“ Sein ausgestreckter Arm wies auf das letzte Haus am Ende der Straße, das sich kaum von den anderen unterschied. Im angrenzenden Garten gab es einen windschiefen Bretterverschlag, der darauf hindeutete, dass die Familie des Jungen zumindest eine Ziege oder ein paar Hühner ihr Eigen nannte.
Amoz rieb sich den struppigen Bart. „Bet Shen“, murmelte er, „nie gehört.“ Dann wandte er sich wieder dem Jungen zu. „Wir sind auf der Suche nach einer Herberge und hofften, in eurem Dorf ein Lager für die Nacht zu bekommen. Aber …“ Wieder glitt sein Blick über die jämmerlichen Behausungen. „Es sieht nicht danach aus, als gäbe es in Bet Shen ein Nachtquartier für uns“, beendete er den angefangenen Satz.
Der Junge schüttelte den Kopf, dass die Locken flogen und lachte auf. „Oh nein, Herr! Eine Herberge in Bet Shen? Außer euch hat hier noch nie jemand nach einem Lager für die Nacht gefragt!“
Lautlos stöhnte Adah auf. Alle Fasern ihres Leibes sehnten sich nach Schlaf und ein wenig Erholung. Aber nun deuteten alle Umstände darauf hin, als bliebe ihr dies versagt. Von ihrem leicht erhöhten Platz auf dem Krughändlerkarren musterte Daya den Jungen. Er schien ein Stück älter zu sein als sie und die Unerschrockenheit, mit der er den Fremden gegenüber trat, imponierte ihr.
„Hätten wir doch nur Amoz’ verrücktem Einfall nicht nachgegeben!“, murrte Nabor, „ich ahnte, dass das nicht gut geht!“
„He“, übertönte Amoz’ tiefe Stimme die anderen, „gegen meinen Vorschlag sprachen lediglich die befürchteten Überfälle der Rebellen. Dies hier hätte uns woanders ebenso passieren können.“
„Das ist doch Unsinn, Amoz“, warf Levi ein, „entlang der Handelsstraße gibt es überall Herbergen. Hier, im Hinterland dagegen bist du auf die Gastfreundschaft dieser armen Leute angewiesen.“
Heftig und wortreich diskutierten die Männer miteinander, schoben Schuldzuweisungen hin und her und hatten die Dorfbewohner auf diese Weise bald aus ihren Häusern gelockt. Verunsichert traten diese näher, eine Überzahl an Frauen und Kindern, die allesamt ihren Augen nicht trauten. Wann hatten zum letzten Mal fahrende Händler den Weg hierher gefunden? Im Nu waren die festgezurrten Lederplanen von den Ladeflächen abgenommen und noch bevor sich die Dunkelheit auf den unscheinbaren Flecken am Fuß der Berge senkte, hatten die Händler ein lohnenderes Geschäft gemacht, als sie es für möglich gehalten hatten. Sie staunten zwar über die vielen Silbermünzen, die die Frauen großzügig gegen Stoffe, Wein und Geschirr eintauschten, doch in der Begeisterung über das unerwartete und rentable Geschäft fragten sie nicht nach deren Herkunft.
Daya hatte Adah am Ärmel zur Seite gezogen und so standen sie nun, mit ineinander verschlungenen Händen, abwartend am Wegrand. Daya zuckte zusammen, als es hinter ihr im Gesträuch raschelte. Trotz der hereinbrechenden Dunkelheit erkannte sie den schwarz gelockten Jungen im Gestrüpp sofort. Er überragte sie um zwei Köpfe, was sie dazu zwang, zu ihm aufzublicken. Beim Lachen strahlte er übers ganze Gesicht, dabei blitzten makellose weiße Zähne. Mit zur Seite geneigtem Kopf lächelte Daya scheu zurück. Dann streckte er seinen Arm in ihre Richtung. Beim Anblick seiner zu einer Schale geformten Hand weiteten sich ihre Augen vor Erstaunen. Drei glänzende Honigdatteln klebten darin! Ihren Blick voller Verlangen auf die unerwartete Nascherei gerichtet, fuhr Daya sich mit der Zunge über die Lippen. Es war lange her, seit sie sich an einer solchen Leckerei gelabt hatte. Die letzte hatte Nathan ihr geschenkt, als er die Ziege brachte, ein paar Tage vor dem Unglück. Im gleichen Augenblick brandete der Schmerz auf, doch bevor er sich in der Brust festsetzen konnte, schüttelte Daya die Erinnerung daran aus den Gedanken; eine Fähigkeit, in der sie mit jedem neuen Tag geübter wurde. Sie schaute auf. Der Junge lachte noch immer, mit kühn blitzenden Augen.
„Nimm!“, forderte er sie auf und bekräftigte es mit einem Kopfnicken.
Mit Daumen und Zeigefinger griff Daya nach einer der Datteln. Gemeinsam kauten sie, lachten einander dabei zu und kosteten den süßen, zäh-klebrigen Geschmack bis zum Letzten aus. Daya leckte sich über Lippen und Fingerspitzen und als der Junge in weitem Bogen den Kern ausspuckte, tat sie es ihm nach.
Allmählich verebbte das Stimmengewirr ringsumher, nur noch vereinzelt standen einige Frauen um die Karren der Kaufleute.
„Dies ist die Frau, von der ich dir erzählte. Ihr Name ist Adah.“
Amoz’ unverkennbare Stimme ließ Daya aufhorchen. Er hatte eine Dorfbewohnerin bei sich. Sie trug ein kleines Mädchen auf dem Arm und in der freien Hand eine brennende Öllampe.
An Adah gewandt sagte Amoz: „Ich habe eine Schlafgelegenheit für dich und das Kind gefunden. Diese Frau hier ist so freundlich, euch für eine Nacht Gastfreundschaft zu gewähren.“
Mit einer Kopfbewegung deutete er auf die Frau neben sich. Ihr Gesicht war das einer jungen Frau, die zu früh mit dem Altern begonnen hat. Unter dem fadenscheinigen Tuch, das ihren Kopf bedeckte, verbarg sie zwei pechschwarze, geflochtene Zöpfe. Das Mädchen auf ihrer Hüfte mochte höchstens zwei Sommer alt sein, müde rieb es sich die Augen und wand sich unwillig im festen Griff seiner Mutter.
„Geht mit ihr und schlaft euch aus“, sagte Amoz und nickte Daya dabei aufmunternd zu, „wir anderen werden unter unseren Wagen im Freien schlafen. Morgen nach Sonnenaufgang reisen wir weiter.“
Eine Mischung aus Erleichterung und Dankbarkeit wallte in Adah auf. Sie tastete nach Dayas Hand. Gemeinsam folgten sie der jungen Frau, die leichtfüßig voranging. Der schwarz gelockte Junge lief in die gleiche Richtung, doch darüber wunderte Daya sich erst, als sie das Haus der Frau erreichten.
Es war das letzte am Ende der Straße.