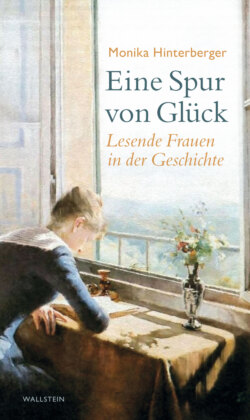Читать книгу Eine Spur von Glück - Monika Hinterberger - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Zwei Frauen im Gespräch über ihre Lektüre Colloquio di donne
ОглавлениеZwei Frauen im Gespräch über ihre Lektüre.
Diese Bildunterschrift wird einem Fresko des 1. nachchristlichen Jahrhunderts zugeschrieben, das Angaben des Bildarchivs Preußischer Kulturbesitz zufolge aus Pompeji stammt und dort den Raum einer Villa schmückte. Welche der pompejanischen Villen gemeint ist, bleibt offen. War es tatsächlich Pompeji, wo diese Wandmalerei entstand? Entstammt das Fresko möglicherweise einer Villa im nahe gelegenen Herculaneum? Oder einem römischen Wohnhaus in einer der anderen süditalienischen Städte ? Allen Nachforschungen zum Trotz lassen sich diese Fragen gegenwärtig nicht beantworten, auch nicht die, wo das Fresko aufbewahrt wird und ob es überhaupt noch existiert.
Das Berliner Bildarchiv gibt als Standort das Archäologische Nationalmuseum in Neapel an. Da das Fresko nach Auskunft des Museums dort weder im Literaturverzeichnis noch in graphischen Reproduktionen des 19. Jahrhunderts erscheint, wird angenommen, dass es Anfang des 20. Jahrhunderts in das Museum gelangte, ohne dass es inventarisiert worden wäre.
Wie gerne wüsste ich etwas über seine Herkunft und den heutigen Standort. Würde das Fresko selbst in Augenschein nehmen wollen. Seiner Wirkung nachspüren. Wer gab vor beinahe zweitausend Jahren den Impuls zu dieser Malerei ? Für wen war sie gedacht ? Wer erfreute sich daran ? Ich nähere mich dem Bild mit Staunen, mit Bewunderung, mit vielen Fragen.
Zwei Frauen im Gespräch. Ruhig und gelassen.
Eine der beiden hält eine geöffnete Papyrusrolle in ihren Händen. Sie steht vor ihrer Gefährtin, ihren rechten Fuß auf ein niedriges Podest gestützt. Sie scheint auf ihre Lektüre konzentriert. Trägt sie der vor ihr sitzenden Frau eine Textpassage vor? Diese ist in ihrer Haltung ganz der Gesprächspartnerin zugewandt. Mit dem linken Arm stützt sie sich auf ihren Sitz, die rechte Hand liegt entspannt in ihrem Schoß. Hinter ihr lehnt eine Lyra oder Kithara an einem Steinsockel. Der Sockel und die Andeutung einer Säule im Hintergrund legen die Vermutung nahe, dass die Frauen sich im hinteren Teil des Hauses, dem zu einem Peristyl gestalteten Gartenbereich aufhalten. Sie könnten Freundinnen sein.
Beide tragen die während der römischen Kaiserzeit traditionelle Frauenkleidung: ein langes, gegürtetes Untergewand, die Tunica, darüber eine für verheiratete Römerinnen standesgemäße und bis zu den Knöcheln reichende farbige Stola. Wohlhabende Frauen bevorzugten als Stoff eine leichte Baumwolle oder gar Seide. Und sie verzichteten ungern auf ihren reichhaltigen Schmuck: Spangen, Ohrringe, Armbänder und Ketten, Diademe oder mit Gold sowie Edelsteinen besetzte Bänder für ihr Haar. Auch das im Nacken zu einem kunstvollen Knoten gebundene Haar, das manchmal durch ein mit Goldfäden durchwirktes Haarnetz zusammengehalten wurde, gehörte zum typischen Erscheinungsbild einer verheirateten Frau. Nur die jungen, noch unverheirateten Mädchen trugen ihr Haar lang und ungebunden und konnten sich in der Öffentlichkeit auch ohne Kopfbedeckung frei bewegen.
Ein Colloquio di donne also.
So lautet die Auskunft des Archäologischen Nationalmuseums in Neapel. Dass tatsächlich zwei Frauen dargestellt sind, zeige ein Vergleich mit anderen ähnlichen Bildern gleicher Dimension und gleichen Stils.
Die Szene lässt mich an die Zeit griechischer Klassik denken, als das Lesen weitgehend ein Gemeinschaftserlebnis war, als literarische Texte aus Buchrollen vorgetragen wurden, sei es in einer größeren Öffentlichkeit, in kleinerer Gesellschaft oder auch zu zweit wie hier am Beispiel der beiden Frauen. Das Lesen für sich allein nahm im Leben des antiken Menschen erst allmählich größeren Raum ein, wobei das individuelle Lesen noch lange Zeit ein mehr oder weniger lautes Sichvorlesen bedeutete, zumindest literarischer Texte. Das Alleinsein mit der Lektüre, das stille Sichvertiefen in einen Text, wie wir es heute kennen, begann in hellenistischer Zeit gebräuchlicher zu werden, gleichwohl wurde das gemeinsame Hören und Lesen von Literatur noch über Jahrhunderte hinweg beibehalten.
Von einem solchen Moment erzählt das Wandbild aus Pompeji, von einem Moment der Begegnung zweier Frauen, im Gespräch über ihre Lektüre. Ich geselle mich zu ihnen, versuche ihnen zuzuhören, ihre Zusammenkunft zu ergründen, mich ihrer Lebenssituation im ersten nachchristlichen Jahrhundert zu nähern.