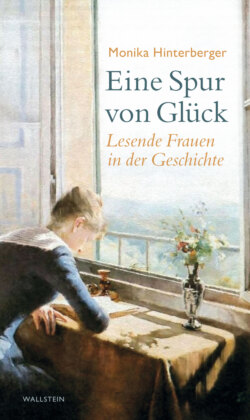Читать книгу Eine Spur von Glück - Monika Hinterberger - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Weibliche Vorbilder
ОглавлениеErlebten sich die beiden Frauen auf dem Fresko in einer weiblichen Tradition stehend?
Mit welchen Frauen pflegten sie Umgang? Wer waren ihre Freundinnen? Gab es Nachbarinnen, mit denen sie sich austauschten? Wie nahmen sie Frauen in der eigenen Familie wahr ? Ihre Mütter? Großmütter? Schwestern? Töchter? Was wussten sie von Frauen der Vergangenheit?
Wenngleich die Namen von Frauen und Kenntnisse über deren Leben der geschichtlichen Erinnerung vielfach verloren gingen, sind einige Namen literarisch gebildeter Frauen überliefert – sie waren vor allem Angehörige einer römischen Führungsschicht oder der kaiserlichen Familien. Calpurnia etwa ( 77 v. Chr.-unbek.), die letzte Gattin Julius Caesars ( 100-44 v. Chr.), gehört dazu, die wie ihr Vater der epikureischen Schule nahegestanden hatte. Oder Octavia ( 70-11 v. Chr.), eine Schwester des Kaisers Augustus ( 63 v.-14 n. Chr.). Die unter Augustus und der umsichtigen Kaiserin Livia ( 58 v.-29 n. Chr.) errichtete Porticus Octaviae, zu der neben bedeutenden Kunstwerken auch eine öffentliche Bibliothek ghörte, trägt sicher nicht zufällig den Namen Octavias. Sie selbst nahm die Einweihung der Bibliothek im Gedenken an ihren verstorbenen Sohn Marcellus mit den in Rom üblichen beiden Abteilungen vor, einer bibliotheca graeca und einer bibliotheca latina. Als Stifterin einer Bibliothek sind später auch Matidia ( 64-119 n. Chr.), eine Verwandte des Kaisers Trajan ( 53-117 n. Chr.), oder Flavia Melitine überliefert, die eine Bibliothek im Asklepieion von Pergamon stiftete.
Klugheit besaßen sie als Ehefrauen, Bildung und Kenntnisreichtum zeigten sie als Brief- und Gesprächspartnerinnen, Weitsicht und Entschiedenheit bewiesen sie als Mütter und Erzieherinnen ihrer Kinder. Sie waren Vorbild für andere Frauen. So hat sich etwa die Römerin Cornelia ( 190-100 v. Chr.), genannt die Mutter der Gracchen, als überaus gebildete Frau in das historische Gedächtnis eingeschrieben. Oder auch Marcia ( 25 v.-41 n. Chr.), die Seneca zufolge das Lebenswerk ihres verfemten Vaters, des Historikers Cremutius Cordus, tradierte und damit vor dem Vergessen bewahrte. Manche Frauen wurden ihrer Redegewandtheit wegen gerühmt. Die Römerin Hortensia beispielsweise hielt 42 v. Chr. eine kraftvolle Rede auf dem Forum in Rom und protestierte öffentlich – und erfolgreich – gegen die Erhebung von Sonderabgaben für vermögende Frauen. Wohlhabende Frauen waren seit der späten Republik keine Seltenheit. Im letzten vorchristlichen Jahrhundert hatte sich die manus-freie Ehe durchzusetzen begonnen. Das Mädchen wurde nun nicht mehr aus der Hand des Vaters in die des Ehemannes gegeben, sondern die beiden Heiratswilligen verblieben unter der Vormundschaft, der potestas der jeweiligen Väter. Zudem wurde eine klare Gütertrennung vereinbart, so konnten Ehefrauen nach dem Tode ihres Vaters über ihr oftmals aus Erbschaften stammendes oder auch zur Mitgift gehörendes Vermögen sui iuris, eigenen Rechts also, verfügen, Geschäfte tätigen, ihren Besitz veräußern, vererben oder auch zum Wohle der Allgemeinheit und der eigenen Familie stiften. Als reiche Land- und Gutsbesitzerinnen und ebenso als Stifterinnen sind sie im gesamten römischen Reich anzutreffen. Und als solche waren sie nicht ohne politischen Einfluss.
Das gilt zum Beispiel für Eumachia aus Pompeji, Tochter eines Händlers und Besitzers einer Keramik- und Ziegelmanufaktur und Ehefrau eines hohen städtischen Beamten, dessen Handelsunternehmen für Wolle sie nach seinem Tod selbstständig weiterführte. Sie war Patronin der Gilde der Tuchwalker und zudem hohe städtische Priesterin. Der Tuchhändlergilde ließ sie im eigenen und im Namen ihres Sohnes im Jahre 22 n. Chr. ein großes, reich geschmücktes Gebäude am Forum in Pompeji errichten. Die Gilde ihrerseits ehrte Eumachia durch eine Statue in der idealtypischen Gestalt einer jugendlich schönen Frau.
Bildungs- und verantwortungsbewusst trugen Frauen in vielen Bereichen zum gesellschaftlichen Gelingen bei. Und sie griffen selbst zur Feder. Einige Namen schreibender Frauen und Titel ihrer Werke fanden verstreut Erwähnung, doch kaum eine ihrer Schriften hat sich erhalten. Wenigstens förderte der Zufall einiges zutage, beispielsweise die Elegien der römischen Dichterin Sulpicia. Ihre Lebensdaten sind nicht bekannt. Ihre in den Jahren 25-20 v. Chr. entstandenen Gedichte wurden zusammen mit dem Schriftencorpus des Dichters Tibull ( 55-19 v. Chr.) überliefert und lange, bis in die Neuzeit hinein, für seine Werke gehalten. Vielleicht haben sie deshalb überleben können? Sulpicia, die Tochter einer römischen Senatorenfamilie, hinterließ mit ihren Liebeselegien ein Zeugnis weiblichen Selbstverständnisses, in dem sie gesellschaftliche Normvorstellungen ihrer Zeit und insbesondere die Rollenerwartungen an eine Frau zurückweist und den Wunsch nach freier Selbstgestaltung ihres Lebens – und ihrer Liebe – formulierte. Ob und auf welche Weise diese Gedichte auch von anderen Frauen wahrgenommen wurden, ob sie für kontroversen Gesprächsstoff sorgten, ob sie Ermutigung bedeuteten oder auch als gegen die herrschenden Sitten verstoßend verworfen wurden, wer mag dies beantworten? Sulpicia jedenfalls gehörte einem literarischen Zirkel in Rom an, in dem auch die Dichter Ovid und Tibull aus- und eingingen. Hier wird sie, den Gepflogenheiten gemäß, ihre Gedichte einem Kreis von Freundinnen und Freunden vorgetragen haben.
Mir gefällt die Vorstellung, dass die beiden disputierenden Frauen auf dem Fresko aus Pompeji sich vielleicht mit den Gedichten Sulpicias befassten. Oder mit Texten der Dichterin Cornificia ( 85-40 v. Chr.) ? Der Chronik des Kirchenlehrers Hieronymus ( 347-420) aus dem 4. Jahrhundert jedenfalls ist zu entnehmen, dass ihre viel gepriesenen Epigramme noch mehrere Hundert Jahre später gelesen wurden. Aber auch diese Werke sind heute allesamt verschollen.