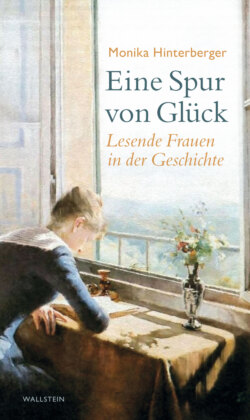Читать книгу Eine Spur von Glück - Monika Hinterberger - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
»Kennen sollst du auch Sappho …« ( Ovid)
ОглавлениеUnd was waren sie im Begriff zu lesen?
Welcher Text hatte ihr Interesse entfacht ? Ein Epos? Ein Lehrgedicht? Ein Drama? Sprachen sie über einen lyrischen Text? Setzten sie sich mit einer philosophischen Abhandlung auseinander? Was sie lasen, wird von ihren Interessen, ihrer Vorbildung, ihrem sozialen Umfeld und schließlich auch von ihrem Lebensalter bestimmt worden sein.
Den jungen Leserinnen beispielsweise empfahl der Dichter Ovid ( 43 v.-17 n. Chr.) im dritten, eigens an Frauen gerichteten Buch seiner Ars Amatoria, eines kurz vor der Zeitenwende erschienenen Lehrgedichtes über die Liebe, eine bestimmte Auswahl griechischer wie lateinischer Werke, unter denen seine eigenen nicht fehlten – aber auch nicht die der griechischen Dichterin Sappho ( um 600 v. Chr.). Ihre Lyrik hatte seit Jahrhunderten nichts von ihrer Anrührung verloren. »Nota sit et Sappho« – »Kennen sollst du auch Sappho«, hatte Ovid geschrieben. Seine Literaturempfehlung galt insbesondere der elegischen Dichtung, in der persönliche Belange, allen voran die das gesamte Lebensgefühl beherrschende Liebe, in erotisch gefärbte Verse gegossen waren. Dass die Elegiker ihre nonkonformen Dichtungen vorzugsweise an ein weibliches Publikum, an eine von ihnen imaginierte gebildete junge Frau, die puella docta, als Leserin richteten, wird ältere Frauen nicht vom Lesen der Liebeslyrik abgehalten haben. Und umgekehrt: Galten philosophische Schriften, Reden oder Werke der Geschichtsschreibung eher den verheirateten oder verwitweten gebildeten Frauen, den matronae doctae, als zuträglich, bedeutete dies keineswegs, dass nicht auch jüngere Frauen sich ernsthaft damit auseinandersetzten.
Ambitionierte Frauen wie die beiden auf dem pompejanischen Fresko, daran zweifle ich nicht, werden selbstbestimmt über Art und Umfang ihrer Lektüre entschieden haben, sei es aus beruflichen Gründen, aus wissenschaftlichem Interesse, sei es zur eigenen Erbauung oder der Geselligkeit wegen, vorausgesetzt, Bücher standen ihnen in dem gewünschten Umfang zur Verfügung. Weder in Pompeji noch in den anderen vom Vesuv verschütteten Städten Kampaniens sind für die späte Republik oder die frühe Kaiserzeit größere öffentliche Bibliotheken – ähnlich denen in Rom – nachgewiesen worden. Archäologische Ausgrabungen förderten jedoch private Büchersammlungen zutage: Räume innerhalb des pompejanischen Hauses, in denen Bücher und Bücherschränke vorhanden gewesen waren oder die aufgrund von Inschriften, Wandmalereien mit Lesenden oder aufgestellten kleinen Büsten antiker Schriftsteller als Bibliotheksräume angesehen werden. In unmittelbarer Nachbarschaft zu den Bibliotheksräumen, die wohl vorwiegend zur Aufbewahrung der Bücher dienten, gab es in der Regel kleinere Räumlichkeiten, cubicula, in denen ungestört gelesen oder auch rezitiert und diskutiert werden konnte. Die Bibliotheks- und angrenzenden Leseräume befanden sich sorgsam platziert im hinteren Bereich des Hauses, an Peristylen gelegen, dort, wo die ersehnte Ruhe und Konzentration auf die Lektüre am ehesten gegeben waren. Es scheint, als haben sich auch die beiden ins Gespräch vertieften Frauen dorthin zurückgezogen. Um unter sich zu sein, durch keinerlei Ablenkung gestört.
Das Vorhandensein einer privaten Bibliothek erleichterte natürlich den Zugang zur Literatur. Die familiäre Situation, das Interesse an Literatur und das Leseverhalten innerhalb der Familie, spielten für die Bildung der Mädchen und Frauen eine entscheidende Rolle. Und das gilt auch für die Frage, ob Frauen über eigene Bücher verfügten oder nicht. Vielleicht konnten die beiden Frauen auf eine gut ausgestattete häusliche Büchersammlung zurückgreifen, die auch Geschichtswerke, Reden, philosophische Schriften und Biographien enthielt und die ihnen für ihre Studien jederzeit zur Verfügung stand. Weshalb sollten sie diese nicht gelesen haben?