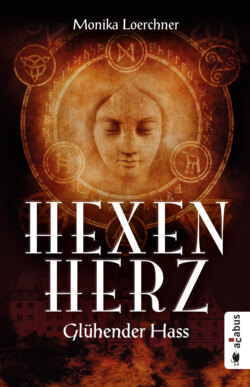Читать книгу Hexenherz. Glühender Hass - Monika Loerchner - Страница 13
Goldenes Reich Kapitel 2
ОглавлениеMama erstarrt. »Was?«
»Das heißt nicht ›Was?‹, sondern ›Wie bitte?‹«, grinse ich, doch Mama sieht nicht so aus, als hätte sie derzeit viel Humor.
»Ich meine das ernst«, füge ich schnell hinzu. »Du wirst mir die Magie beschaffen, die ich benötige, um mich als Frau auszugeben.«
»Und wie soll ich das anstellen, Herr Oberschlau? Soll ich als nächstes Fische auf Bäumen wachsen lassen, die Jahreszeiten umkehren und – wenn ich schon dabei bin – mir die Zweite der Goldenen Garde, die schöne Heidrun, ins Bett zaubern?«
Wann immer eine Mama auf ihre Vergangenheit anspricht, wird sie bestenfalls einsilbig. Es gibt Wunden, an denen besser keine rührt. Und so wie sie respektiert, dass ich so selten wie möglich über Ada, die Frau, die mich geboren, vor dreieinhalb Jahren von zu Hause weggebracht und zusammen mit meinem Vater im Stich gelassen hat, reden möchte, akzeptiere ich, nicht über unsere Zeit bei Adrian und seinen Leuten zu sprechen. Doch jetzt muss es sein. »Erinnerst du dich an Frenjas Anhänger?«
Mama zieht zischend die Luft ein. Allein Frenjas Namen zu nennen fühlt sich an, als würde ich eine Frau mit Luftmagie provozieren: Ein falscher Wimpernschlag jetzt, und mir werden eine Menge Dinge um die Ohren fliegen! Auch für mich ist es nicht einfach: Immerhin ist Frenja durch meine Hand gestorben.
Wir waren damals von Glenna und Gero gefangen genommen worden und Mama hatte es irgendwie geschafft, sich für uns eine glaubwürdige Tarnung auszudenken. Hätten die Aufständischen nämlich gewusst, dass Mama Zweite der Ostgarde war, hätten sie sie sofort getötet. Als Mama von Frenja durchschaut wurde, kam es zum Kampf. Frenja gewann und wollte Mama töten. Mit dem Mut der Verzweiflung stieß ich mit meinem Messer nach der Rebellin und traf sie in den Hals. Ich weiß bis heute nicht, wie ich das geschafft habe. Ich war noch so jung, dazu halb wahnsinnig vor Angst. Ich kann nicht sagen, dass es mir leidtut. Es war Notwehr. Dennoch wache ich selbst heute noch ab und zu auf, das Herz klamm vor Angst und vor meinem inneren Auge das schmerzverzerrte, blutige Gesicht der einst so lebensfrohen Rebellin. Schnell rede ich weiter.
»Du weißt, dass es geht, Mama, du hast es getan! Es ist möglich, die Magie einer Frau zu speichern und von einer anderen benutzen zu lassen. Also warum sollte das nicht auch mir möglich sein?«
Mama hatte Frenja nach ihrem Tod eine Kette mit einem ganz besonderen Anhänger, einem Netz aus reinem Silber mit einem Stein darin, abgenommen, nicht wissend, damit die mächtigste Waffe der Rebellion gegen die Hexenherrschaft in den Händen zu halten. Erst später entdeckte sie, dass der Stein in dem Anhänger in der Lage war, Magie aufzunehmen und zu speichern. Jede Frau kann Magie aus dem Stein ziehen, sofern sie darauf achtet, dass diese nicht in ihrer Beschaffenheit zu widersprüchlich zu ihrer eigenen steht. Mama, die einst über eine sehr mächtige Eismagie verfügt hatte, hatte diese Lektion auf die harte Weise gelernt, als sie sich bei dem Versuch, sich einer Amphibienmagie zu bedienen, fast selbst vergiftet hätte. Da ich als Junge über gar keine eigene Magie verfüge, mache ich mir in dieser Hinsicht allerdings keine Sorgen.
»Du weißt ja nicht, was du da redest«, herrscht Mama mich an. »Allein sich als Frau zu verkleiden, wird mit dem Tod bestraft. Aber nein, das reicht meinem lieben Sohn ja nicht. Er muss ja noch eins draufsetzen und sich in Dinge einmischen, die unsere gesamte Familie zerstören könnten. Allein das Wissen darum, was es mit Frenjas Anhängern auf sich hat«, der Schmerz in ihrem Gesicht lässt mich zusammenzucken, »hat mich meine Magie gekostet.«
Ich nicke. »Trotzdem. Ich muss es einfach versuchen.«
Mama dreht sich zu mir um, die Hände zu Fäusten geballt und rot im Gesicht. »Dir ist aber schon klar, dass sie mich nur hat leben lassen, weil die Goldene Frau der Ansicht ist, dies sei die größere Strafe für mich und dass sie mich für immer gebrochen hätte?« Mamas Stimme ist gefährlich leise. »Und dir ist auch klar, dass sie wegen dieser Sache, wegen dieses einen Anhängers, ein ganzes verdammtes Dorf ausgerottet hat?«
»Was soll ich denn sonst tun, Mama?« Ich stehe auf. Zornestränen schießen mir in die Augen. »Was verdammt nochmal soll ich denn tun? Ich bin hier in diesem verfluchten, beschissenen Goldenen Reich gefangen, in dem ich ein Nichts bin! Hier gelte ich als Junge einen Dreck! Meine Zukunft? Lass mich raten: Die Minen oder ein Bauernhof. Oh, oder ich gehe in die Hauptstadt und lasse mich als Kanonenfutter ausbilden, dann können sie mich in die erste Reihe stellen, wenn wieder mal wer mit Schusswaffen daherkommt. Weißt du was? Ist mir egal, ist mir alles egal. Oder auch nicht. Immerhin hast du mir viel beigebracht. Sagst doch selbst immer, was ich für ein helles Köpfchen bin. Nur habe ich da leider nichts von, nicht wahr? Weil ich ein Mann bin und zu nichts tauge als zu Drecksarbeit, vor anderen zu buckeln oder meiner Zukünftigen die Kinder großzuziehen. Denkst du, so habe ich mir mein Leben vorgestellt? Ich bin woanders aufgewachsen, weißt du? Drüben, im ach so bösen Patriarchat des Großen Moldawischen Reiches. Aber da war ich wer! Scheiß auf die Magie und scheiß auf alles, aber da bin ich wer gewesen! Der ganze Stolz meines Vaters, das war ich! Mein Großvater, meine Onkel, alle haben in mir etwas Besonderes gesehen, das zukünftige Familienoberhaupt. Und nicht bloß ein unnützes Maul mehr, das es zu füttern gilt. Aber das alles ist mir scheißegal, verstehst du das, wenn ich dafür nur meinen Papa wiederbekomme!«
Ich muss Luft holen und mache den Fehler, Mama dabei anzuschauen. Sie ist kreidebleich und starrt mich entsetzt an.
»So also siehst du dein Leben hier?«, flüstert sie. Eine Stimme in mir mahnt mich, meine harschen Worte zurückzunehmen, doch auf einmal möchte ich ihr einfach nur noch wehtun.
»Ja, genauso sehe ich es!« Ich drehe mich um und stürme aus der Küche.
Als Mama einige Zeit später zu mir kommt, habe ich mich längst beruhigt. Ich sitze an unserem Lieblingsplatz, draußen am Abhang, und starre hinaus auf die bewaldeten Berge, grübele über die Geheimnisse, die sie verbergen und die Menschen, die in ihnen Zuflucht suchen. Zum Beispiel Adrian. Ich verstehe bis heute nicht, warum Mama und ich nicht mit ihm gegangen sind, als er sie darum gebeten hat. Adrians vorherige Partnerin Mirja war tot, aber das spielte auch keine Rolle, denn er hätte sich sowieso von ihr getrennt, um mit Mama zusammen zu sein. Das hatte Adrian gesagt und keine, die ihn kennt, würde auch nur eine Sekunde lang an seiner Aufrichtigkeit zweifeln. Nicht mal Mama konnte das, nicht zuletzt, weil sie Adrians Worte mit Hilfe der Magie einer Lügenleserin auf die Probe gestellt hatte. Dennoch hatte sie ihn ziehen lassen.
»Hast du schon mal Frauen beobachtet? So richtig aufmerksam?« Mama setzt sich neben mich und schaut ebenfalls in die Ferne. Ihre Stimme ist leise und wiegt sich im Wind. »Wenn sie frisch erweckt sind und dann später, wenn sie sich an ihre Magie gewöhnt haben – was ist dir aufgefallen?«
Ich weiß, dass sie von mir keine Antwort erwartet. Noch nicht.
»Sie verwenden für jede Kleinigkeit Magie«, fährt Mama fort. Noch immer sieht sie mich nicht an, aber sie rückt dichter an mich heran, sodass sich unsere Arme fast berühren. Auch ich rutsche ein Stück näher und als zwischen uns Körperkontakt besteht, höre ich Mama erleichtert seufzen. Plötzlich schäme ich mich. Warum muss ich immer so aufbrausend sein, warum immer so wütend? Ich hebe an, etwas zu sagen, aber Mama redet schnell weiter. Helena von Smaleberg regelt die Dinge lieber jetzt und sofort. Als sie fortfährt, ist ihre Stimme weich und ich weiß, dass sie meine wortlose Bitte um Entschuldigung angenommen hat.
»Ab einem gewissen Aufwand wird keine Frau etwas so verrichten, wie du es gewohnt bist«, erklärt Mama, beugt sich vor und zupft ein Haar von ihrer Hose. »Selbst dieses Haar hätte ich mit meiner Magie aus der Handgelenkbewegung heraus weggewischt, verstehst du? Das ist eine Selbstverständlichkeit, die dir in Fleisch und Blut übergehen muss!«
Ich zucke mit den Schultern. »Ich weiß. Aber ich werde vorgeben, grade erst erweckt worden zu sein.«
Mama lächelt. »So wird sich keine etwas dabei denken, wenn du mal vergisst, Magie zu benutzen, sehr gut. Aber vergiss nie, dass ein Mädchen, das zur Frau geworden ist, so oft wie nur irgend möglich ihre Magie benutzen möchte, sie ist ganz wild darauf!«
»Oh ja!« Ich verziehe das Gesicht. Es ist nicht nötig, Mama davon zu erzählen, aber ich durfte schon oft genug für die jungen Frauen im Dorf als Versuchsobjekt ihrer frisch erweckten Fähigkeiten herhalten. Zweifelsohne – Großmutter hin oder her – hätte Mama die jungen Frauen zur Rede gestellt, wenn sie davon erfahren hätte. Früher hätte es keine gewagt einen Sohn der Helena von Smaleberg, Zweite der Ostgarde, zu triezen, aber die Zeiten haben sich geändert. Ich hatte einfach Angst, dass die jungen Frauen nicht davor zurückschrecken würden, Mama mit Magie anzugreifen, sollte sie versuchen, diese blöden Kühe um meinetwillen übers Knie zu legen. Also hatte ich nichts gesagt.
»Das kann ich mir gut vorstellen.«
Mama lacht. Dann wird sie wieder ernst und trommelt mit den Fingern auf die angezogenen Knie. Das tut sie oft, wenn wir über Magie reden. »Wenn es wirklich klappt, dass du Magie benutzen kannst – und ich sage nicht, dass es klappt, ich ziehe nur die Möglichkeit in Betracht, auch wenn es sich noch so verrückt anhört – dann wirst du sie ständig benutzen müssen. Es gibt viele Anwendungsmöglichkeiten der Magie, die auch Kindern, Fräulein und Männern auffallen. Aber ebenso gibt es unzählige, die ihr gar nicht bemerkt, weil ihr nicht von ihnen wisst.«
»Zum Beispiel?«
Mama überlegt kurz. »Die Sprache. Es ist für eine Frau selbstverständlich, reines Hochdeutsch zu sprechen.«
Ich gönne mir ein zufriedenes Grinsen. »Das kann ich auch ohne Magie!«, doch Mama schüttelt den Kopf. »Nicht akzentfrei. Eine Frau spricht immer und überall und in jeder Sprache ohne einen Akzent. Zumindest außerhalb ihrer magiefreien Tage.«
Neugierig schaue ich sie von der Seite an. »Und wie macht ihr das?«
Schulterzucken. »Du lenkst deine Magie in deine Stimme, deinen Kopf, deinen Hals … dein Ich. Und gehst dann mit dem, was du sagen willst, einfach auf die Linie deiner Gesprächspartnerin. Auf die Schwingung und Farbe ihrer Worte. Ach, keine Ahnung. Du machst es halt. Und sprichst dann ihre Sprache. Irgendwie und ganz instinktiv, verstehst du? So wie atmen.«
Mama seufzt, streckt die Beine und lässt sich nach hinten in das kühle, nasse Gras sinken. Sie verschränkt die Arme hinter dem Nacken und starrt in den Himmel. »Und wenn du auf eine triffst, die eine andere Sprache spricht, dann ist das so, als würdest du rennen, du atmest zwar weiter, aber anders. Schneller. Ach Göttin, ich kann es nicht besser beschreiben.«
Einen kurzen Moment wird mir klamm in der Brust. Mama hat recht: Ich habe eine ganze Menge zu lernen, sollte das mit der Magie hinhauen. Falls.
Ein anderer Gedanke drängt sich mir über die Zunge. »Mama, mal ernsthaft: Bist du eigentlich nie auf die Idee gekommen, dir auf diese Art das wiederzuholen, was sie dir genommen haben? Du weißt, dass du dir aus Gegenständen Magie nehmen kannst. Hast du nie darüber nachgedacht?«
Ruckartig setzt sich Mama wieder auf. »Ich wäre mein Leben lang auf andere Frauen angewiesen.«
»Bist du’s jetzt nicht?« Das wollte ich nicht sagen, aber es stimmt: Ohne das Geld, das uns verwandte Frauen von Mama aus allen Teilen des Reiches monatlich zukommen lassen, kämen wir nicht über die Runden.
»Vielleicht. Die Göttin weiß, ich würde einen Weg finden, uns auch so zu ernähren.«
»Ich weiß«, grinse ich. »Zur Not würdest du uns alle mit deiner bloßen Sturheit ernähren!«
Ich tauche nicht schnell genug zur Seite weg, und Mamas sanfter Watschen trifft mich hinterm Ohr. »Aua.«
»Stell dich nicht so an.« Wieder seufzt Mama, aber dieses Mal klingt es anders. Schicksalsergeben, aber auch irgendwie aufgeregt. »Also schön, ich werde dir helfen. Ich habe eine alte Bekannte in Annaburg, Irene Tamarasra, die mir noch einen ziemlich großen Gefallen schuldet; dort könntest du wohnen. Und wegen allem anderen … Versprechen kann ich nichts, aber ich werde Kontakt mit deinem Onkel Richard herstellen, er soll ein Treffen mit Adrian Samo vereinbaren.«
Irre ich mich, oder zittert Mamas Stimme beim Gedanken daran, Adrian wiederzusehen?
Mama steht auf und schaut mich ernst an. »Eine Sache musst du dir unbedingt merken, mein Sohn. Es wird einmal die Zeit kommen, zu der du dich entscheiden musst, was für dich wichtiger ist: Die Vergangenheit und alles, was dir passiert ist, oder die Zukunft und der Mensch, der du einmal sein willst. Vergiss das bitte nie, Mojserce. Das ist der beste Rat, den ich dir geben kann.«
Sie dreht sich um und lässt mich allein und nachdenklich zurück. Der Wind wird stärker, und erste Tropfen zerplatzen auf meinen von Gänsehaut überzogenen Unterarmen. Ich lege den Kopf in den Nacken und beobachte, wie immer mehr dunkle Wolken über das Tal getrieben werden. Ein Sturm wird über mich hereinbrechen, ich spüre es genau. Und ich werde derjenige sein, der ihn gerufen hat.
Ich strecke meine Hand aus. Ich weiß, dass es anders ist, anders gewesen sein muss, aber ich kann mich an keinen Tag erinnern, an dem daraufhin nicht Mamas Hand die meine genommen und festgehalten hätte. Vor uns steht ihr Bruder, Onkel Richard. Er hat sich schon vor vielen Jahren einer Gruppe Aufständischer – nicht Adrians, sondern einer anderen – angeschlossen und wird seither von den Garden gesucht. Ich kenne ihn kaum, habe ihn seit ich in Smaleberg lebe nur ein paar Mal getroffen. Immer nur nachts, immer nur heimlich und unter Wahrung sämtlicher Vorsichtsmaßnahmen. Nicht an hohen Feiertagen, nicht zu Selyms oder Kires Geburtstagen. Das wäre ja auch zu einfach gewesen, welcher Vater wäre nicht gern an so einem Freudentag dabei? Wobei es sich beim Tag von Kires Geburt auch um den Tag handelt, an dem Onkel Richard seine Frau Jessica verloren hat.
Auf jeden Fall unterlagen seine seltenen Besuche immer der strengsten Geheimhaltung. Seit einiger Zeit kann er nicht mal mehr seine ältere Tochter Selym besuchen, die mit ihren dreieinhalb Jahren zwar mittlerweile wunderbar plappern, aber leider kein Geheimnis für sich behalten kann. Mama sagt, dass es sein kann, dass er auch Kire demnächst für ein paar Jahre nur noch dann besuchen kann, wenn sie schläft. Und dass es nicht das Schlimmste auf der Göttin Erdboden sei, sich die kleinen Quälgeister nur im Schlaf anschauen zu müssen. Auch wenn es gemein ist das zu sagen, glaube ich sowieso nicht, dass die beiden ihren Vater groß vermissen. Sie kennen es ja nicht anders: Richard hatte die hochschwangere Jessica damals zur Entbindung zu seiner Familie gebracht – und sie war geblieben. Ein Leben auf der Flucht ist nichts für ein Baby, hatten sie schweren Herzens entschieden.
»Sie müssten bald hier sein, Lena«, sagt Onkel Richard, ohne den Kopf zu bewegen.
Mama nickt knapp. Erst jetzt, da nicht wie sonst Oma Rina, Opa Ernst oder Mamu dabei sind, fällt mir auf, wie wenig die beiden miteinander sprechen. Seltsam.
Mama seufzt, dann, wie auf ein geheimes Zeichen hin, wenden sie und Onkel Richard ihre Köpfe nach rechts. Ich lausche angestrengt, aber da ist nichts. Dennoch treten einen Moment später vier Menschen aus dem dichten Gebüsch.
»Adrian!«, schreie ich glücklich und renne auf den Anführer zu. Er schließt mich in seine starken Arme, die genau wie früher nach Moos, Erde, Tannennadeln und etwas Unbestimmtem riechen, und wuschelt mir dann über den Kopf. »Kolja, wie schön, dich zu sehen! Göttin, bist du groß geworden!«
Wenn mich die alten Tratschkerle in der Stadt damit nerven, ist das so eine Sache; Adrian dagegen hat mich jetzt seit über zwei Jahren nicht gesehen. Und überhaupt: Er dürfte mir das jeden Tag sagen!
Ich drehe mich ein bisschen in seinen Armen und beobachte Mama. Wie zu erwarten, hat sie ihren grimmigen Blick aufgesetzt: Sie beißt die Zähne so fest zusammen, dass ihre Kiefermuskeln vortreten und ich könnte schwören, dass sie exakt einen Zentimeter an Adrian vorbeischaut. So schaut sie auch Oma Rina an, wenn sie wütend auf sie ist, aber nichts sagen will.
»Hallo Helena!« Eine freundlich lächelnde Rebellin – ob Frau oder nicht, kann ich noch nicht sagen – löst sich aus der Gruppe und geht auf Mama zu. Es folgt eine herzliche Umarmung, der sich kurz darauf eine weitere Rebellin anschließt.
»Simone Brunhildsdother und Marzena Mariolanka!« Mama ist sichtlich gerührt. »Ihr seht großartig aus. Es tut so gut, euch wiederzusehen!«
Jetzt, da ich ihre Namen gehört habe, erinnere ich mich wieder an die beiden Frauen: Simone lernte ich als Teil von Adrians Gruppe kennen. Marzena hatte wie Mama einst zur Ostgarde gehört und hatte ihr geholfen, Adrian, Simone und die anderen zu befreien, um sie vor einer ungerechtfertigten Hinrichtung zu bewahren. Dafür war Marzena selbstverständlich von der Goldenen Frau verstoßen und für vogelfrei erklärt worden. Obschon keine Verräterin im klassischen Sinne, scheint sie sich an ihr Leben auf der Flucht gewöhnt zu haben.
»Nun mach mal halblang«, lacht Marzena. »So lange ist das nun auch wieder nicht her.«
Mamas Blick wird düster. »Zwei Jahre und –«
»Helena.« Wie immer ist Adrians Stimme eher sanft als fordernd. Was nicht heißen soll, dass sich keine Klinge darin verbirgt.
»Ja bitte?«
»Hör auf.«
Und Mama hört auf, ich fasse es nicht.
»Hätte ich vorher gewusst, dass es so einfach ist, dass du die Klappe hältst …«, grummelt der jüngere Rebell, der bislang geschwiegen hat.
»Corey! Wie schön dich zu sehen!« Mamas Stimme ist so süß wie Honig. Mich schaudert. »Hätte ich gewusst, dass du hier bist, hätte ich mir doch glatt ein Blümchenkleid angezogen und mir eine Rose ins Haar gesteckt.«
Corey fletscht die Zähne, Mama lacht.
»Lass das, Corey.« Dieses Mal höre ich deutlich, welche Macht Adrian über die anderen hat: Sein Wort ist Gesetz, da kann Corey noch so sehr die Hände zu Fäusten ballen.
»Und du, Lena, bleib gefälligst friedlich«, lacht Marzena und versetzt Mama einen freundlichen, aber nicht besonders sanften Hieb.
»Aua!« Mama reibt sich die Schulter. Dann zieht sie ihre Stirn kraus. »Seit wann haust du denn wie ein Junge?«
Marzenas Lächeln verblasst kurz, sie sieht zu ihrer Gefährtin Simone.
»Ach Lena…« Die Frau zuckt mit den Schultern. »Du weißt doch, wie das bei uns ist, hast ja immerhin selbst eine Weile bei der Bande gewohnt.«
»Unfreiwillig.«
»Naja, wir auch.« Marzena grinst breit. »Da du ja unbedingt die Goldene Frau verärgern musstest und die schöne Heidrun gleich mit, weil du vor ihrer Nase Gefangene befreit hast, blieb mir ja nichts anderes übrig als zu fliehen. Und wo hätte ich sonst auch hingesollt?«
»Jaja, schon gut«, wiegelt Mama ab. »Ist schon klar. Und weiter?«
Ihre ehemalige Gardeschwester verdreht die Augen. »Als ob du das nicht wüsstest! Solange Magie allein Frauen vorbehalten ist, bemühen sich Adrians Leute, alle Arbeiten möglichst gleich zu verrichten. Daher verzichten die meisten Frauen darauf, Magie zu benutzen, und das hat eben irgendwann auf mich abgefärbt.«
»So ein Blödsinn!« Mama schnaubt. »Heißt das etwa auch, dass sich muskulöse Männer extra schwach anstellen und schwerere Lasten mit Absicht zu zweit oder zu dritt tragen, obwohl sie es auch allein könnten?«
»Nein, natürlich nicht, das wäre ja …«
»Blödsinn, sag ich doch!«
Da ich mit dem Rücken zu Adrian stehe, kann ich sein Lächeln nicht sehen, wohl aber spüren. Obschon ich damals noch kein Deutsch konnte, habe ich mitbekommen, wie oft er und Mama sich unterhalten haben. Und auch, dass diese Gespräche dem Tonfall nach eher den Charakter von spielerischen Wortgefechten hatten. Adrian schätzt Mama also noch immer auf eine Weise, die mich hoffen lässt. Vielleicht …
»Wie dem auch sei.« Mama seufzt betont theatralisch. »Wenn du meinst, wie ein Junge hauen zu müssen, dann mach du mal. Aber dann beschwer dich hinterher nicht, wenn du dann ordentlich was auf die Nase bekommst.«
»Na, von dir ja wohl nicht, Großmutter!«
»Corey!« Adrian schiebt mich zur Seite und geht einen Schritt auf den Rebell zu. Sofort senkt dieser den Kopf, nuschelt eine Bitte um Entschuldigung. Adrian schüttelt den Kopf. Ich kann seine Wut deutlich spüren, und obwohl er wieder nur mit dem Rücken zu mir steht, weiß ich ganz genau, wie seine Augen jetzt aussehen: Fahlgrün und dumpf. Manchmal, wenn Mama wieder einen ihrer bösen Träume hat, fleht sie die Göttin an, wieder die goldenen Funken in Adrians Augen zu schicken.
Der Schockmoment ob Coreys Äußerung ist vorüber, Simone, Marzena und Richard schicken sich gleichzeitig an, etwas zu sagen, aber Mama bedeutet ihnen mit einer Geste zu schweigen.
»Ja, ich bin eine Großmutter, daran gibt es nichts zu beschönigen.« Das Lächeln, das sie Corey schickt, erinnert mich daran, wie sie einst mit all ihrer Eismagie gegen die Rebellin Frenja gekämpft hat. »Ausgeweidet auf Anordnung der Goldenen Frau höchstpersönlich. Weil ich euch geholfen habe zu fliehen. Jede hier weiß das, Corey-Schätzchen, ich werde nie wieder über Magie verfügen. Aber das bedeutet noch lange nicht, dass ich mir deine Frechheiten gefallen lassen muss. Und wenn du noch so viel mit deinen Freunden über die angebliche Gleichwertigkeit der Geschlechter faselst, in meinen Augen bist du nichts weiter als ein schwacher, kleiner Mann und ob mit oder ohne Magie, stehe ich nach dem Willen der Göttin über dir. Also noch so eine Frechheit, Schnuckie, und ich zeige dir, dass ich einen Mann auch ohne Magie in seine Schranken zu weisen weiß!«
Coreys Gesicht ist rot angelaufen, gleichzeitig macht er einen unbeholfenen Schritt rückwärts. Ich kann es ihm nicht verübeln: Wenn Mama wütend ist, geht jede, die nicht über halbwegs starke Magie gebietet, besser in Deckung.
Auch Onkel Richard sieht wütend aus, nur dass er im Gegensatz zu Corey bleich geworden ist. Mamas Lächeln ist nach wie vor so künstlich wie die Haarfarbe unserer Nachbarin Frau Klauke während ihrer Magiezeit. Doch noch bevor er etwas tun oder sagen kann, greift Adrian ein. »Das reicht!«
Dass der Anführer seine Stimme erhebt, lässt sogar Mama innehalten. Anhand der Bewegungen ihrer Kiefermuskeln und der gespannten Haut auf dem Rücken ihrer zu Fäusten geballten Hände kann ich erkennen, wie sehr sie sich zusammennimmt. Ich habe noch nie erlebt, dass sie sich – außer natürlich damals zum Schein – etwas von einem Mann sagen lässt.
Endlich schaut sie Adrian in die Augen. Ganz langsam öffnen sich ihre Fäuste, und ihr Kiefer entspannt sich wieder. Dann schaut sie zur Seite, zuckt mit den Schultern. »Vielleicht sollten wir uns alle beruhigen.«
Onkel Richard hebt fragend die Augenbrauen, sagt aber nichts. Corey zuckt ebenfalls mit den Schultern, während Marzena und Simone etwas unschlüssig dastehen. Die Spannung will einfach nicht nachlassen. Da fällt mir etwas ein.
»Wir haben euch etwas mitgebracht, Adrian.« Ich zeige hinter Mama und gehe dann betont munter zu dem Sack, den sie an einen Baumstamm gelehnt hat. »Brot, frisches Obst, ein paar Werkzeuge und Supermehl.«
»Supermehl?« Adrian zieht die Stirn kraus und stemmt die Hände in die mittlerweile schmalen Hüften. »Was ist denn ›Supermehl‹?«
Mama räuspert sich. »Die im Landwirtschaftsministerium haben schon lange an sowas geforscht. Da sie in den Pflanzen keine Magie speichern können, haben sie nach einer anderen Möglichkeit gesucht, den Ackerbau und die Zucht von Heilpflanzen und Kräutern zu verbessern. Unter anderem kam Supermehl dabei heraus. Sobald es mit Flüssigkeiten in Berührung kommt, ist es viermal so ergiebig wie herkömmliches Mehl.«
»Davon habe ich gehört«, meldet sich Marzena mit leuchtenden Augen zu Wort. »Ich habe das auch mal versucht.«
»Erfolgreich?«
»Wie denn?«, lässt Corey abschätzig vernehmen. »Wir sind ja gerade mal so weit, Magie in Gegenständen speichern zu können.«
Mama tut so, als hätte sie nichts gehört.
»Und seit wann hast du eigentlich Pflanzenmagie?«
»Hab ich ja gar nicht«, gibt die ehemalige Gardistin zu. »Aber ich habe mir über einen Magiestein was von einer anderen Frau geben lassen und habe ein wenig mit Blumenzwiebeln herumexperimentiert.« Marzenas Augen leuchten. »Habe die Pflanze – vereinfacht ausgedrückt – so lange an etwas Neues gewöhnt, bis sie es von sich aus übernommen hat. Ich habe keine Ahnung, wie sich der Ertrag steigern lässt, aber ich habe es geschafft, die Pflanze davon zu überzeugen, eine weitere Blüte herzustellen. Beziehungsweise wir, denn das ist harte Schichtarbeit, alleine wird das nichts! Und sobald Marianne mir wieder einen Stein mit ihrer Pflanzenmagie darin schickt, geht es weiter. Ach Helena, du ahnst ja nicht, wie gut es damals tat, endlich wieder über Magie zu verfügen!«
»Moment mal!« Mamas Augen sind rund. »Willst du mir damit sagen, dass du keine eigene Magie mehr hast?«
Marzena schüttelt den Kopf. »Aber nein! Nur anfangs nicht. In jener Nacht vor über zwei Jahren hatten wir uns die Magie ja von den Goldenen Gardistinnen fesseln lassen müssen, um zum Männerturm zu gelangen. Dann sind wir geflohen und kamen logischerweise nie an den Schlüssel heran.«
»Und wie hast du die Magiefesseln dann gelöst?«
»Gar nicht«, grinst Simone.
»Was soll das heißen?«
»Dass sie von allein abgefallen sind«, erklärt Marzena hastig, die sich im Gegensatz zu Simone etwas besser mit Mamas Ungeduld auskennt. »Kurz bevor sich meine Magie erneuert hat, ist die Fessel einfach abgefallen.«
»Was durchaus Sinn ergibt«, fügt Adrian hinzu. »Wo nichts ist, kann auch keine Fessel halten.«
Mama schüttelt den Kopf. »Ich wette, wir sind die Ersten, die das herausgefunden haben. Ich würde zu gern Heidruns Gesicht sehen, wenn ich ihr das unter die Nase reibe.«
»Wozu es allerdings nie kommen wird«, sagt Adrian mit sanftem Lächeln, »da du dich die nächsten hundert Jahre aus der Hauptstadt fernhalten wirst, nicht wahr?«
Mama grinst. »Sag niemals nie, mein Lieber. Es kann nicht schaden, die Schwäche eines Feindes zu kennen. Und bei einer Frau wie Heidrun kann diese Schwäche über Leben und Tod entscheiden.« Sie seufzt wehmütig. »Ahhh, ihr hättet diese Frau sehen sollen! So wunderschön. Und ihre Magie …!«
»Womit wir endlich beim Thema wären.« Onkel Richard zeigt auf mich. »Kolja braucht Magie.«