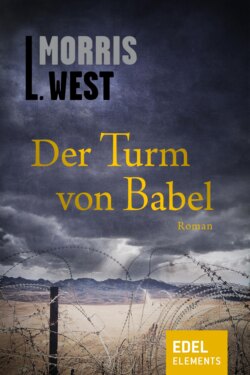Читать книгу Der Turm von Babel - Morris L. West - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Zweites Kapitel Jerusalem
ОглавлениеAchtundvierzig Stunden nach dem Zwischenfall bei Sha’ar Hagolan wurde Brigadegeneral Jakov Baratz zu einer Besprechung in das Büro des Premierministers in Jerusalem geladen. Die Besprechung war für 15 Uhr angesetzt. Eine gemütliche Fahrt von Tel Aviv nach Jerusalem dauerte höchstens zwei Stunden, aber Baratz beschloß, schon bei Sonnenaufgang zu fahren. Für seinen gähnenden und mürrischen Fahrer war es eine Strafe, für Baratz das reinste seiner spartanischen Vergnügen.
In der Morgendämmerung hatte das Meer die Farbe von Opalglas, und der Nebel zog in dünnen Schwaden über das Wasser. Die Luft war kühl und frisch und noch nicht von Benzindämpfen und Staub verunreinigt. Die Stadt lag noch im Schlaf, und die wenigen Fußgänger wirkten schwerfällig und ländlich, als wären sie nicht ganz am Platz in dieser betriebsamen, lauten Stadt, die wie ein Pilz aus den Sandhügeln nördlich des alten Jaffa emporgeschossen war.
Auf dem flachen Ackerland lag noch der Tau. Es roch nach Orangenblüten und gepflügter Erde. Die Strahlen der aufgehenden Sonne färbten die Blätter der Obstbäume grün, vergoldeten die Stoppelfelder und ließen das Kalkgestein, das zwischen fruchtbarer Erde zutage trat, rosa und weiß und bräunlich leuchten. Die Pinien in den Tälern im Osten waren noch dunkel und düster, aber auf den Bergkuppen funkelten sie rot in der Sonne, wie die Speere marschierender Heere.
Für Jakov Baratz war dies das wahre Antlitz des Gelobten Landes. Er war als Kind in dieses Land gekommen, als Sohn eines Kaufmanns aus dem Baltikum, und er hatte die Herrlichkeit seiner Ankunft nie vergessen: die strahlende Sonnenglut, den blendenden Himmel, das zerklüftete Gebirge, die Wüste, über der die Luft tanzte und Städte und Palmenhaine hervorzauberte, die im nächsten Augenblick wieder verschwunden waren. In seiner Jugend hatte er das Land bebaut, hatte mit bloßen Händen Felsmauern errichtet, körbeweise Erde angeschleppt und Weinstöcke und Zitronenbäume gepflanzt. Als Mann hatte er die militärische Ausbildung, die die Briten ihm gegeben hatten, dazu benutzt, um dieses Land zu kämpfen; und er hatte jeden blutigen Kilometer von Lydda bis Ramie und Abu Ghosh gezählt, bis er endlich auf dem Berg Zion stand. Seine Liebe zu diesem Land war vielgestaltig. Eine starke Leidenschaft band ihn enger an diese Erde, als er je an den Körper einer Frau gebunden war. Er war eifersüchtig wie jeder Liebhaber, denn er konnte seines Besitzes nie sicher sein, und niemand wußte besser als er, wie sehr dieser Besitz bedroht war.
Rechtlich gesehen – wenn es so etwas wie Rechtsbegriffe in den Auseinandersetzungen zwischen Nationen gab –, hatte Israel nicht einmal eine Grenze. Seine Grenzen waren Waffenstillstandslinien, die erst ein formaler Friedensvertrag anerkennen konnte – und der schien zur Zeit ferner als die Landung auf dem Mond. Selbst die Waffenstillstandslinien waren an vielen Stellen durch die Existenz entmilitarisierter Zonen gefährdet, in denen niemand eine Waffe tragen durfte, um Frau und Kinder und die Arbeiter auf dem Feld zu schützen. Der israelische Außenhandel wurde durch Sanktionen der arabischen Staaten behindert. Der Suezkanal war für israelische Schiffe gesperrt. Die Straße von Acre nach Sidon war versperrt durch Minenfelder, Stacheldraht und bewaffnete Soldaten, und es war nicht möglich, von einem Teil Jerusalems aus mit dem anderen Teil zu telefonieren.
Trotz alledem war Israel gediehen, und es würde weiter gedeihen. Aber zur Zeit hatte es etwas weniger Fett unter der Haut, und manches deutete darauf hin, daß noch magerere Jahre bevorstanden. Nach den ersten großen Immigrationswellen aus dem zerstörten Europa, aus Libyen, Tunesien, Algerien, Marokko, aus den südamerikanischen Ländern, aus dem Jemen, dem Irak, dem Iran und Hadramaut war der Strom der Einwanderer nahezu versiegt. Wenn Rußland nicht seine Tore öffnete und seine drei Millionen unglücklichen Juden aus dem Land ließ, war Israel gezwungen, sich auf das natürliche Anwachsen seiner Bevölkerung zu verlassen, um die bisher unbebauten Gebiete zu besiedeln, eine industrielle Wirtschaft aufzubauen und seine Truppenstärke zu erhalten. Der Nachschub an Köpfen und Kapital aus der Diaspora in Amerika hatte nachgelassen, denn die Erinnerung an die Massenmorde war schwächer geworfen, und die Trompeten von Zion fanden kaum mehr Gehör vor den Ohren der verwöhnten Jugend. Es kamen immer noch ein paar, die für ein oder zwei Jahre das Leben der Menschen in den Kibbuzim teilten, aber sie wogen kaum die Zahl derer auf, die das Land verließen um der Fleischtöpfe Europas und der Vereinigten Staaten willen.
Auch innerhalb der Grenzen Israels, so dachte er, begann die Geschichte sich zu wiederholen: mit Spannungen zwischen den Stämmen, religiösen Streitigkeiten, sozialer Unzufriedenheit und politischer Rivalität. Israel hatte noch nicht entschieden – und konnte auch noch nicht entscheiden –, was aus ihm werden sollte: ein über seine Grenzen hinausblickender westlicher Staat oder eine ganz auf sich beschränkte, kaum auf Dauer bedachte levantinische Gemeinschaft. Bis jetzt gab es trotz Massenerziehung und allgemeiner Dienstpflicht noch keine sehr glückliche Mischung zwischen den Kulturen der Einwanderer aus dem Westen und der aus dem Osten.
Der religiöse Zwiespalt war noch größer. Die Adukim, die streng Orthodoxen, wollten mit einem weltlichen Staat keinen Kompromiß eingehen. Sie nutzten ihre politische Macht genauso strikt, wie sie aus der Einhaltung der Reinigungsrituale bestanden. Ihretwegen hatte Israel noch immer keine Verfassung, und die soziale Gesetzgebung enthielt eine Menge Anormalien und Ungerechtigkeiten. Wenn man in Mear Sharim am Sabbat eine Zigarette rauchte, konnte es passieren, daß ein zorniger Eiferer sie einem aus dem Mund schlug. Aber Mitglieder des Rabbinats konnten die Mauern mit Plakaten bekleben, auf denen den Gläubigen verboten wurde, an einer legalen Abstimmung teilzunehmen – in den meisten Fällen wurden sie dafür nicht bestraft.
In Israel gab es keine Zivilehe. Man war Jude, Christ oder Moslem. Aber wenn man als einfacher weltlicher Mensch außerhalb einer religiösen Gruppe legal heiraten oder geschieden oder begraben werden wollte, dann mußte man zu diesem Zweck nach Zypern. Wenn einer Moslemfrau ein niedrigerer Unterhalt gewährt wurde als einer Jüdin oder Christin, hatte sie keinerlei Möglichkeit, sich gegen diese offenkundige Ungerechtigkeit zu wehren. Die Speisevorschriften waren für Andersgläubige oder Religionslose genauso verbindlich wie für die Orthodoxen, und ein Sabbat im Carmen-Hotel war so düster und trostlos wie in Mear Sharim.
Die politischen Konflikte hatten einen leichten Anflug von persönlicher Blutrache. Die großen Männer der kriegerischen Jahre waren alt geworden und mitunter wunderlich. Sie ärgerten sich über die Jungen, die ihre Autorität und ihre Politik in Frage stellten, und viele von ihnen waren verbittert. Sie alle waren immer noch eine Nation: und es war das Land, das sie zusammenhielt. Aber wenn sie nicht lernten, sich selbst zusammenzuhalten, so meinte Jakov Baratz, konnte es kommen, daß sie das Land am Ende wieder verloren, so wie sie es früher schon an die Assyrer verloren hatten, an die Hasmonäer und an die ottomanischen Türken.
Als sie in die Berge im Korridor von Jerusalem führen, wurde es plötzlich kalt, und Jakov Baratz schauderte. Bei Abu Ghosh verließen sie die Hauptstraße und bogen in eine Gebirgsstraße ein, die nach Habamisha und zur jordanischen Grenze führte. Der Weg ging weiter steil bergan durch Felder und Pinienhaine, bis er plötzlich einen breiten Kamm erreichte, von dem aus man die öden Hügel der jordanischen Berge, das gewundene Band der Ramallah-Straße und die dicht beieinanderstehenden Hütten der Grenzdörfer Beit Surik, Biddu und Qubeila sehen konnte.
Im kalten Licht des frühen Morgens sah die Landschaft aus wie ein fremder Planet. Die Konturen der Berge traten scharf hervor, die Farben waren grell: Gelb, Karmesinrot, Braun, das blendende Weiß des Kalkgesteins und das Schwarz der Schattenlöcher. Auf den ersten Blick schien das Land selbst für Ziegen zu karg, aber unten in den Wadis hatten die Beduinen ihre schwarzen Zelte aufgeschlagen und weideten ihre Herden, während die Dorfbewohner sich aus den Terrassengärten an den Berghängen mühsam ernährten. Alles wirkte friedlich – bis man an den Drahtverhau kam, der die Straße teilte, und zwei bewaffnete israelische Wachtposten aus dem Felsschatten traten. Sie waren sehr jung und gaben sich sehr soldatisch. Sie ließen Baratz und den Fahrer erst weiterfahren, nachdem sie ihre Papiere eingehend kontrolliert hatten. Dann grüßten sie schneidig, und der Wagen fuhr bis zu dem Kommandostand, der wie eine Festung in den Berg gehauen war.
Der Kommandant, ein dreißigjähriger Hauptmann, der Hebräisch mit dem harten Akzent der Jemeniten sprach, bewirtete sie mit schwarzem Kaffee, gekochten Eiern und Brot vom Tag zuvor. Dann stieg er mit Baratz auf den Aussichtsposten, und die beiden Männer blickten hinunter auf die Landschaft, die sich vor ihnen ausbreitete. Der Kommandant gab eine kurze Schilderung der Situation.
»… Sie kennen die generelle Einteilung. Eine Kompanie des Dritten Bataillons der jordanischen Arabischen Legion ist in Biddu stationiert. Ihr Gebiet erstreckt sich im Osten bis Beit Surik und im Westen bis Qubeila. In Ramallah liegen zwei Kompanien in Reserve. Diese Reservekompanien erfüllen auch Polizeiaufgaben bei den Palästinaflüchtlingen in Ramallah und den umliegenden Distrikten. Die Gegend macht ihnen viel Ärger.«
»Uns auch«, sagte Jakov Baratz. »Einer unserer Agenten in Ramallah berichtet von zwei neuen Waffenlieferungen an die PLO und einer neuen Propagandawelle – hauptsächlich Flugblätter. Ich glaube mit Sicherheit, Sie haben in Kürze mit Unruhen zu rechnen.«
»Wir sind darauf vorbereitet.« Der junge Hauptmann war sehr zuversichtlich. »Dieser Sektor war immer einfach zu halten. Das Gebirge bietet uns große Vorteile. Wir sind hier siebzig Meter höher als die nächste Erhebung in Jordanien, und drüben haben sie wenig Bodendeckung, während wir in jeder Richtung ein freies Schußfeld von zwei Kilometern haben. Seit zwei Jahren hat es bei uns keine Sabotageversuche gegeben.«
»Ich haben Ihren letzten Bericht gelesen, und deshalb bin ich hier. Sie berichteten von neuen Konvoi-Tätigkeiten.«
»Ja, in den vergangenen fünf Tagen haben wir Spähtrupps gesehen, die auf der Straße von Beit Surik nach Osten führen. Und es kamen Meldungen über andere Spähtrupps, die sich weiter westlich bei Beit Inan bewegten.«
»Wieviel Fahrzeuge waren es?«
»Gewöhnlich zwei Lastwagen. Manchmal auch drei. Und immer ein Jeep vorneweg. Sie fahren morgens zwischen acht und neun weg und kommen gegen vier Uhr nachmittags zurück.«
»Das sind sieben Stunden zwischen Abfahrt und Rückkehr. Wie groß ist die größte Entfernung in beiden Richtungen?«
»Fünfunddreißig Kilometer im Höchstfall.«
»Mir kommt es vor«, sagte Baratz, »als seien sie mehr an ihren eigenen Leuten interessiert als an uns. Sind keine Versuche gemacht worden, in Ihren Sektor einzudringen?«
»Nicht von der Arabischen Legion. Ich habe jedoch berichtet, daß die Beduinen viel näher an unseren Linien weiden.«
Baratz zuckte die Schultern. »Wer kennt sich schon mit Beduinen aus? Der Winter steht vor der Tür, das Weideland wird knapp. Sie nehmen, was sie finden. Manchmal erledigen sie was für die PLO, aber meistens kümmern sie sich nur um ihre eigenen Angelegenheiten. So – und die wilden Esel?«
Der junge Hauptmann lachte. »Vor zwei Nächten geriet ein halbes Dutzend wilder Esel in die Minenfelder. Einer trat auf eine Mine und wurde in die Luft gesprengt. Ein zweiter wurde erschossen. Das ist alles. Es schien mir kaum wert, berichtet zu werden.«
»Alles ist wert, berichtet zu werden. Außerdem ist das eine einfache Methode, um ohne Risiko festzustellen, wo Minen liegen.«
»Ja, aber die übrigen Minen sind deshalb immer noch da.«
»Stimmt«, sagte Baratz, » aber man kann ein Tier mit Sprengstoff beladen und einen Zeitzünder einbauen. Und wenn es durch das Minenfeld in unseren Sektor kommt, kann es beträchtlichen Schaden anrichten.«
»Daran hatte ich nicht gedacht.«
Baratz lachte. »Ich bis zu diesem Augenblick auch nicht. Aber wenn man einen Störungskrieg führt wie die PLO, und wenn der Lärm, den man dabei macht, genauso wichtig ist wie der militärische Effekt, dann lohnt es sich, originell zu sein. Deshalb möchte ich auch in Zukunft über wilde Esel und alle sonstigen Erscheinungen, die ungewöhnlich sind, ausführliche Berichte bekommen.«
»Ich werde daran denken.«
Sie blieben noch weitere zehn Minuten auf dem Aussichtsposten und verglichen das Land mit den Aufzeichnungen der Stabskarte. Dann gingen sie zurück in das Büro des Hauptmanns, und Baratz rief Dr. Liebermann im Hadassah-Krankenhaus in Jerusalem an.
»Franz, hier spricht Jakov Baratz. Ich bin in einer halben Stunde in Jerusalem. Kann ich Hannah kurz besuchen?«
»Wenn du unbedingt willst«, sagte Franz Liebermann ohne Begeisterung. »Und wenn du dich etwas vorbereitest.«
»Wird es schlimm für sie sein?«
»Sie wird dich nicht erkennen, Jakov«, sagte Liebermann ruhig. »Sie sieht nichts und hört nichts. Du kannst sie weder verletzen noch ihr helfen. Du tust dir unter Umständen nur selbst weh.«
»Sie ist meine Frau, Franz. Ich liebe sie.«
»Das meine ich ja«, sagte Franz Liebermann. »Ruf mich von der Halle aus an, wenn du da bist.«
Als sie zurück nach Abu Ghosh und durch die letzten Engpässe nach Jerusalem führen, war Baratz schweigsam und gereizt, und sein Fahrer, der nicht wagte zu fragen, was ihn so plötzlich verstimmt habe, fuhr den Wagen mit besonderer Sorgfalt.
In der Armee hatten sie einen Namen für Baratz: Adish, der Mann mit Eis in den Adern und Asche an Stelle des Herzens. Wie alle solche Spitznamen war auch dieser halb Kompliment, halb Spott. Baratz war für den Geschmack seiner Kameraden zu abweisend. Er war in seinem Beruf genau und präzise wie ein Chirurg, ohne Gnade für Drückeberger und ohne Nachsicht gegenüber Dummköpfen. Zorn machte ihn kalt und vorsichtig, und sein Humor war eher höhnisch. Was an Wärme in ihm war, hielt er eifersüchtig versteckt. Seine Freundschaften waren tief, aber nie überschwenglich.
Er lebte wie ein Mönch. Er trank kaum, rauchte überhaupt nicht und hatte in seinem ganzen Leben nur eine Frau gekannt: seine eigene. Er war nicht ohne Eitelkeit, denn er erschien jederzeit, ob spät in der Nacht oder früh am Morgen, frisch rasiert und adrett genug, um eine Parade abnehmen zu können. Bei Konferenzen trug er seinen Bericht oder seine Meinung mit kühler Sicherheit vor, die wenig Fragen und keine Opposition hervorrief. Dann setzte er sich und verharrte unbeweglich wie ein steinernder Buddha, während die anderen das Problem erörterten. Wenn es soweit war, daß das Problem gelöst schien und ein Entschluß gefaßt werden konnte, dann tat er es ruhig und leidenschaftslos.
Aber er kannte die Leidenschaft, auch wenn man es ihm nicht anmerkte. Seine Freunde aus den Tagen der Haganah erzählten von den gefahrvollen Unternehmungen, zu denen er seine Männer mit starken, beschwörenden Reden angefeuert hatte, die alle die Inbrunst der alten Propheten besaßen. Sie erinnerten sich an seine kurze romantische Werbung um Hannah, die mit sechzehn während der Aliyah Bet, der illegalen Einwanderung vertriebener Juden, aus Europa nach Palästina gekommen war. Er hatte sie zuerst als Kurier eingesetzt und phantastischen Gefahren preisgegeben. Nach sechs Monaten hatte er sie geheiratet und damit die Gefahren für sie noch vergrößert. Nach dem Krieg zog er sich mit ihr in das häusliche Leben zurück, an dem nur seine engsten Freunde teilnehmen durften.
Vor langer Zeit schon hatte Franz Liebermann ihn vor der Gefahr gewarnt, die diese Abhängigkeit von Hannah und ihre Abhängigkeit von ihm mit sich brachte. Er hatte es sehr einfach ausgedrückt. »Was geschieht mit dem anderen, wenn einer von euch stirbt? Für Hannah bist du eine Tür, die sich hinter ihrer Vergangenheit geschlossen hat, so daß sie sich nie mit der Erinnerung auseinandersetzen muß. Für dich ist sie… Ach verdammt! Woher soll ich das wissen. Aber es ist bereits zuviel. Du riskierst etwas, Jakov. Unter Umständen eine Tragödie.«
Jetzt war die Tragödie da, die vorauszusehen er sich immer geweigert hatte, und Franz Liebermann bereitete ihn auf den Schlußakt vor. Hannah war von ihm gegangen, wahrscheinlich für immer. Die Tür war aufgebrochen, und sie war in die Schreckenskammer zurückgekehrt, in der sie während der Massenmorde ihre Kindheit verbracht hatte. Er selber stand am Rand des dunklen Brunnens und blickte hinunter in die Tiefe, die er nie hatte wahrnehmen wollen. Als sie über den letzten Hügel führen und der Berg Zion in Sicht kam, war er plötzlich verzweifelt und voller Angst.
Es war nicht nur die Angst, sie zu verlieren, sondern auch Angst vor dem geheimnisvollen Zerfall eines Menschen in etwas, das weniger als menschlich war. Wann hatte es angefangen? Vor sechs Monaten? Vor einem Jahr? Als Hannah nach einer Liebesnacht in seinen Armen in Tränen ausgebrochen war und er eine halbe Stunde gebraucht hatte, um sie wieder zu beruhigen? Später passierte es gelegentlich, daß er von der Arbeit zurückkam und sie immer noch im Nachtgewand vorfand. Die Hausarbeit war nicht getan, und das Frühstücksgeschirr stand noch auf dem Tisch. Manchmal spielte sie wilde Musik, lachte, tanzte und sang schrill und hektisch. Manchmal wachte er in der Nacht auf und fand ihr Bett leer; sie saß dann stumm und starr im dunklen Wohnzimmer, und es dauerte eine Stunde oder zwei, bis er sie wieder zum Sprechen gebracht hatte. Schließlich erklärte sie sich damit einverstanden, daß Franz Liebermann sie behandelte. Nach einem Monat war sie scheinbar genesen zurückgekommen. Nach einem weiteren Monat hatte alles von vorn angefangen, diesmal allerdings schlimmer – die Ausgelassenheit heftiger und das Schweigen länger und tiefer. Wie war das geschehen? Und weshalb? Und wenn es mit ihr geschehen war, konnte es dann nicht, in abgewandelter Form, auch mit ihm geschehen, der eine andere Vergangenheit hatte, aber die gleiche geheime, verschlossene Kammer in seinem Innern?
Im Krankenhaus erwartete ihn Franz Liebermann, der grauhaarige, runzlige Freund mit Ziegenohren wie Pan. Er verschwendete keine Zeit mit Höflichkeiten, sondern führte ihn gleich den Gang hinunter in ein großes, luftiges Zimmer, das auf einen Blumengarten hinausging. In dem Zimmer waren etwa ein Dutzend Frauen und zwei junge Schwestern. Die Frauen sahen ganz normal aus. Einige spielten Karten, zwei strickten, eine las, und die anderen saßen wie Hühner um eine Kaffeetafel und schwatzten. Die Schwestern gingen von einer Gruppe zur anderen, wie Erzieherinnen in einem Kindergarten. Dr. Liebermann blieb mit Baratz in der Tür stehen und erklärte ihm auf seine knappe Art die Situation.
»Eine Gemeinschaft, wie du siehst. Das häufigste Symptom für Geisteskrankheit ist die Flucht vor der Gemeinschaft in eine eigene Welt. Wir versuchen, den Patienten in eine Gemeinschaft zurückzuführen, in der die Anforderungen an ihn gering sind. Das klingt einfach, ist aber kompliziert.«
»Wo ist Hannah?«
»Da drüben.«
Sie war so schmal und klein und in sich zurückgezogen, daß er sie zuerst gar nicht fand. Sie saß in der abgelegensten Ecke vor einem Bücherregal auf dem Stuhl, hatte die Knie hochgezogen und umklammerte sie mit beiden Händen. Ihr Blick war leer, ihr Gesicht abgemagert und blaß. Mit dem farbigen Band im Haar sah sie aus wie ein Schulmädchen.
»Du hast sie schon früher so gesehen«, sagte Franz Liebermann gleichmütig.
Baratz nickte. Er konnte nicht sprechen.
»Es gibt für sie nichts Gewaltsames, keine Panik. Sie hat ihr Gesicht in den Schoß der Zeit vergraben und wagt nicht aufzublicken.«
»Sie hatten sie in Salzburg vier Jahre lang auf dem Speicher versteckt. Der Raum hatte keine Fenster, nur eine Falltür. Sie gaben ihr nachts zu essen, wenn die Dienstboten schliefen. Kann ich mit ihr sprechen?«
»Wenn du willst.«
Baratz ging langsam durch das Zimmer auf sie zu. Die übrigen Patientinnen nahmen keine Notiz von ihm, bis auf ein Mädchen, das plötzlich laut und obszön lachte. Als er vor ihr stand, gab sie immer noch kein Zeichen des Erkennens von sich. Er legte eine Hand auf ihre Schulter. Sie war warm, aber sie schien hart wie Marmor. Er sagte: »Hannah, ich bin‘s, Jakov.«
Sie bewegte sich nicht, gab keinen Ton von sich. Er drehte sich um und ging zur Tür zurück.
»Komm, wir trinken eine Tasse Kaffee«, sagte Franz Liebermann.
Mit dem bitteren Geschmack des Kaffees auf der Zunge hörte Baratz in Liebermanns Büro den Urteilsspruch des alten Mannes.
»Du möchtest eine Hoffnung? Nun, ich kann dir nur eine ganz geringe geben. Manchmal wird der Bann gebrochen, wie bei der Prinzessin im verzauberten Wald. Du möchtest eine medizinische Prognose? Der Fall ist aussichtslos: Alle Symptome sind rückläufig.«
»Ich möchte einen Rat, Franz. Was soll ich jetzt machen?«
»Laß sie bei uns. Sie wird nirgends besser aufgehoben sein.«
»Das weiß ich.«
»Dann – «, Dr. Liebermann drehte einen Bleistift zwischen seinen Fingern, »dann würde ich sagen, du solltest daran denken, dein eigenes Leben wiederaufzubauen.«
»Wiederaufbauen? Wozu, Franz? Wozu?«
Der alte Mann legte den Bleistift aus der Hand. Dann sagte er leise: »Ich weiß es nicht, Jakov. Ich bin nicht Gott. Ich kann nicht allen Menschen helfen. Ich wollte, ich könnte es.«
Fünf Minuten später stand Jakov Baratz allein auf der Straße, atmete kühle, staubige Luft ein und blickte über das Tal auf die Mauern der geteilten Stadt. Plötzlich merkte er, daß er nicht an Hannah dachte, sondern an Selim Fathalla in Damaskus und an Fathallas Frau, die in Jerusalem lebte, und er schämte sich.