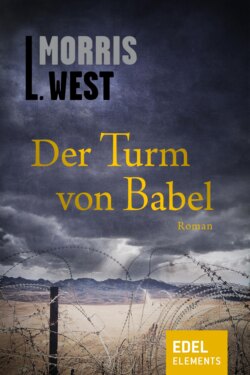Читать книгу Der Turm von Babel - Morris L. West - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Beirut
ОглавлениеWenn Nuri Chakry gut gelaunt war – und Zuversicht und Humor waren seine gewinnbringendsten Eigenschaften –, sprach er gern von sich.
»… so was wie Glück gibt es nicht. Charakter ist Schicksal. Wir handeln, wie wir sind. Wir bekommen, was wir verdienen. Ich zum Beispiel bin Phönizier. Ich liebe das Geld. Ich liebe den Handel. Feilschen ist für mich ein amüsantes Spiel, das Risiko so berauschend wie Haschisch. Wenn ich früher gelebt hätte, hätte ich unten am Hafen in einem kleinen Schuppen gesessen und Gold gegen Silber, Kamelhäute gegen Eisenäxte und Öl gegen die Linsen der Pharaonen eingetauscht. Ich bin ein Händler. Für mich gibt es nur einen Grundsatz: Mache nie Geschäfte mit einem Händler, der gerissener ist als du.«
Was er sagte, stimmte. Alles, was Chakry sagte, stimmte, denn er hatte es sich zur Regel gemacht, in geschäftlichen Dingen nie zu lügen. Das Problem für die, die mit ihm zu tun hatten, war, zwischen der poetischen und der eigentlichen Wahrheit zu unterscheiden und immer daran zu denken, daß das, was ungesagt blieb, manchmal wichtiger war als das, was er lebhaft und überzeugend vorbrachte.
Chakry war Phönizier insofern, als er in einer Stadt lebte, die einmal phönizisch gewesen war. Doch wer tief genug in den Akten grub, erfuhr, daß Chakry ein in Acre geborener Palästinaaraber war, der das Land 1948 beim Einzug der Israelis verlassen hatte.
Es gab manche, die behaupteten, noch tiefer gegraben und entdeckt zu haben, daß er in Wirklichkeit ein abtrünniger Jude sei, der an den Börsenberichten mehr Gefallen gefunden habe als am Talmud und der es vorziehe, auf dem freien Markt zu schachern, statt sich dem bürgerlichen Sozialismus des neuen jüdischen Staates zu unterwerfen. Aber selbst seine Feinde neigten dazu, das als Verleumdung zu betrachten, von Leuten ausgestreut, die er bei seinem schnellen spektakulären Aufstieg von der Leiter gestoßen hatte.
Daß er das Geld liebte, stand außer Zweifel. Daß er den Handel liebte, war ebenfalls eine feststehende Tatsache. Als er nach Beirut kam, besaß er so gut wie nichts, aber mit Betteln, Borgen und Bluffen gelang es ihm, sich in einer Seitengasse in der Nähe der Hafenanlagen als Geldwechsler niederzulassen. Das Geschäft ging Tag und Nacht. Seine ersten Kunden waren Seeleute, Zuhälter, Prostituierte, Hotelportiers, Nachtklubschlepper, Schmuggler, Hehler und Verkäufer von zweifelhaften Antiquitäten. Keine Währung war so schlecht, daß er nicht noch einen Profit herauszuschlagen wußte, kein Geschäft so unbedeutend, daß er nicht als Zwischenhändler aufgetreten wäre – vorausgesetzt, die Provision war angemessen und wurde von beiden Seiten bezahlt.
Er kaufte alte Münzen von den Bauern, die sie auf ihren Feldern gefunden hatten, und von den Arbeitern bei den Ausgrabungen in Baalbek und Byblos. Er säuberte sie und verkaufte sie über internationale Sammlerzeitschriften zu hohen Preisen. Er entwickelte einen hervorragenden Blick für Antiquitäten und ihren begrenzten, aber einträglichen Markt. Er war in der Tat ein Händler – mit viel Sinn für das angenehme Leben und intuitiver Kenntnis der Mittel, mit denen die Macht arbeitet.
Als erstes lernte er, daß schnelle Kommunikation der Schlüssel zum Erfolg ist. Eine phönizische Goldmünze war auf dem Samtkissen eines Händlers in Byblos vielleicht hundert Dollar wert. In New York würde sie den vierfachen Preis erzielen. Thaibahts standen in Beirut unter pari, aber in Bangkok konnte man damit Rubine, Saphire und Gürtel aus gewebtem Gold kaufen. Eine Pfundnote aus Ostafrika konnte man auf dem europäischen Markt mit fünf, manchmal sogar mit zehn Prozent Rabatt kaufen, aber wenn man sie nach Kenia zurückbrachte, bekam man den vollen Wert in Sterling. Daher saß Nuri Chakry in seinem schäbigen Büro und träumte von Schiffen und Fluglinien, von Telefonkabeln und Fernschreiben – und einem ganzen Spinnennetz von Verbindungen, über das er jeden Tag mit allen Märkten der Welt verhandeln könnte.
Er erfuhr bald, daß Geld und Furcht zusammengehören: Wer Geld hat, hat auch Angst. Die Reichen leben in ständiger Angst vor Steuereintreibern, Sozialreformen, Revolutionären, Politikern und verlassenen Frauen. Für diese verängstigten Millionäre, für die Ölscheichs aus Kuwait und Saudi-Arabien, die syrischen Kaufleute mit ihrer Furcht vor Enteignung, für die griechischen Reeder und texanischen Millionäre war Beirut ein Paradies.
Daher schloß Nuri Chakry eines Tages sein Büro am Hafen, steckte seine Träume in die Brusttasche eines neuen Anzugs und gründete die Phönizische Bank. Da er tüchtig war und mutig und bereit, den reichen Männern dabei zu helfen, in Ruhe ihren Lastern zu frönen, gedieh sein Unternehmen schnell. Die reichen Männer wurden einer nach dem anderen seine Kunden und vertrauten ihm ihr Vermögen an. Um ihr Vertrauen in ihn und seine Fähigkeiten zu bestärken, war er gewillt, Phantastisches zu leisten. In dem maurischen Pavillon neben seinem Büro, in dem er seine saudischen und kuwaitischen Fürsten zu unterhalten pflegte, stapelte er einmal Goldbarren einen halben Meter hoch auf den Tisch und bedeckte sie mit Pfandbriefen und Banknoten, um zu beweisen, daß das Geld seiner Kunden jederzeit flüssig war und daß es nirgendwo auf der Welt einen vertrauenswürdigeren Treuhänder gab als Nuri Chakry.
Als er fünfzig war – ein schlanker, schwarzhaariger, lebhafter Fünfziger –, hatte er sich ein Imperium aufgebaut, das von Beirut bis zur Fifth Avenue und von Brasilien bis Nigeria und Qatar reichte und das er von seinem Adlerhorst aus verwaltete – eine große Wohnung aus Glas und Beton, die im Westen auf das Mittelmeer und im Osten auf die Berge blickte, hinter denen die ölschwere Wüste lag.
Im ganzen Libanon gab es niemanden, der ihn an Macht und Ansehen gleichkam, und die goldenen Fäden seines Netzwerks waren mit einer Vielzahl von Unternehmen verknüpft. Seine Kunden und Arbeitnehmer stellten ein Zehntel aller Wahlberechtigten des ganzen Landes, und zwanzig Prozent des staatlichen Betriebskapitals lag in den Tresoren der Phönizischen Bank.
Auf seinem Schreibtisch lag in einer durchsichtigen Plastikschachtel sein Symbol und Glücksbringer – eine Goldmünze von Alexander dem Großen, die auf der einen Seite den Eroberer als Gott Ammon zeigte und auf der anderen die Göttin Athene. Vielleicht mochte ihn das als eitlen Menschen kennzeichnen, doch er war keinesfalls dumm. Er wußte, daß seinem Imperium engere Grenzen gesetzt waren als dem Reich Alexanders. Er wußte, daß seine Geldmittel die gewagten und riskanten Investitionen nur mangelhaft fundierten. Aber wenn er lange genug durchhielt, würde sich ihr Wert verdoppeln und verdreifachen. Wenn er allerdings in der Zwischenzeit gezwungen würde zu liquidieren, so wäre das, als verliere er seinen rechten Arm. Er wußte, daß seine Verbindungen unzuverlässiger wurden, je weiter er sie ausdehnte; und er wußte auch, daß allein schon seine Existenz von der gefährlichen Unausgeglichenheit der politischen Kräfte im Nahen Osten abhing. Je stärker die linksgerichteten Baathisten in Syrien wurden, desto mehr fürchteten die Kuwaitis und Saudis um die Zukunft ihrer reichen Autokratien. Je größer ihre Sorgen wurden, desto stärker verlangten sie danach, ihr Risiko mit Hilfe dieses zuvorkommenden Buchmachers Nuri Chakry zu verringern. Je heftiger sich Ägypten in den Jemenkrieg verstrickte, desto tiefer geriet es in die Schuld der Russen und um so dringlicher brauchte es einen freundlichen Bankier, der die Wechsel diskontierte. Mit jedem Zusammenstoß an der israelischen Grenze floß neues Angstgeld in den Libanon, um gegen europäische Sicherheiten eingetauscht zu werden. Sogar die Russen hatten die hübsche Summe von sechs Millionen Dollar deponiert, was ihre Schaukelpartner, die Amerikaner, dazu zwingen würde, etwas Ähnliches zu tun.
Aber um das Schaukelspiel zu spielen, brauchte man starke Nerven und eine geschmeidige Zunge und einen scharfen Blick für jedes fallende Blatt, das den Waagebalken verschieben könnte. An diesem Morgen segelten mehrere Blätter durch die Luft, und Nuri Chakry stand nachdenklich am Fenster seines Büros, blickte hinaus aufs Meer und überlegte, wo sie hinfallen würden. Nach ein paar Minuten kehrte er an seinen Schreibtisch zurück und schaltete die Sprechanlage ein.
»Mark? Ich habe jetzt Zeit für Sie. Kommen Sie bitte herein.«
Einen Augenblick später öffneten sich die elektrischen Türen des Büros geräuschlos, und Mark Matheson trat mit einer großen Ledermappe unter dem Arm ein. Er war ein dicklicher Mann Mitte Vierzig mit kurzgeschnittenem Haar und einem auffallend jungen Gesicht. Er war Amerikaner, der seinen Beruf bei den Rockefellers in New York erlernt und den Chakry nach Beirut gelockt hatte, wo er als sein Stellvertreter und Unterhändler für Europa arbeitete. Viele seiner Freunde hatten ihm davon abgeraten, das Angebot anzunehmen, aber Chakry zahlte sehr gut, und sein Vertrauen schmeichelte ihm, und so hatte er angenommen.
Bis jetzt hatte er noch keinen Anlaß gehabt, diesen Entschluß zu bedauern. Zuerst hatten ihn die verworrenen Manipulationen Nuri Chakrys erschreckt, aber die Bücher waren offen, die Akten in Ordnung, und Chakry ließ es nie an Respekt fehlen, wenn man ihm einen Rat gab, auch wenn er ihn nicht annahm. Wem er vertraute, zu dem war er offen und geradeheraus, und seine gelegentlichen Wutausbrüche wurden wettgemacht durch seine außerordentliche Großzügigkeit. Er bedeutete Mark, sich zu setzen, und kam sofort zur Sache.
»Wie stehen wir diesen Monat, Mark?«
»Wir sind knapp bei Kasse«, sagte Mark Matheson. »Knapper als sonst. Am Freitag brauchen wir die üblichen zehn Millionen für den Gehaltsscheck der Regierung. Die haben wir. In der nächsten Woche sind wir immer noch flüssig, es sei denn, daß größere Summen abgehoben werden. Am dreißigsten des Monats werden wir allerdings Hilfe brauchen.«
»Wieviel?«
»Sechs Millionen. Vielleicht kommen wir auch mit fünf aus.«
»Ich werde das organisieren«, sagte Chakry entschlossen. »Ich esse morgen mit dem Präsidenten. Wir werden die Zentralbank dazu bekommen, daß sie uns deckt. Und nun…« Er deutete auf die Zeitungen, die säuberlich aufgestapelt vor ihm auf dem Schreibtisch lagen. »Das gibt Ärger: Vier Zeitungen haben heute Angriffe auf König Feisal gebracht. Das wird ihm gar nicht gefallen.«
Matheson zuckte die Schultern. »Das ist doch die alte ägyptische Masche. Die Zeitungen werden mit Nassers Geld finanziert. Feisal wird das wissen.«
»Natürlich weiß er das«, sagte Chakry scharf. »Aber die Zeitungen erscheinen im Libanon. Für Feisal stellen sie einen beträchtlichen Teil der öffentlichen Meinung in diesem Lande dar. Deshalb…« Er brach ab.
»Deshalb?« nahm Matheson den Satz auf.
»Wenn ich Feisal wäre – und ich kenne ihn recht gut –, würde ich mich fragen, weshalb ich fünfzehn Millionen von meinem Geld im Libanon lassen soll, wo man mich jeden Tag in der Presse beleidigt, wenn ich das Geld auch nach London transferieren kann und dort von der chemischen Industrie acht Prozent Zinsen dafür bekomme.«
»Eine gute Frage«, sagte Mark Matheson.
»Eine gefährliche Frage – für uns«, sagte Nuri Chakry. »Jetzt etwas anderes. Heute morgen rief mich Ibrahim von der Pan-Arabischen Bank an.«
»Aha! Nun, wie gefällt ihm sein neuer Job?«
Chakry zuckte die Schultern. »Überhaupt nicht, aber solange wir ihn dafür bezahlen, wird er es ertragen. Er erzählte mir, daß die PLO bei der Pan-Arab auf das Konto von Idris Jarrah zweihunderttausend Pfund Sterling eingezahlt hat.«
»Auf Jarrahs Konto?« Matheson war bestürzt. »Er ist doch seit drei Jahren unser Kunde. Er hat doch eine beträchtliche Summe bei uns deponiert.«
»Ich weiß. Ich vermute, daß er in ein oder zwei Tagen hier erscheinen wird, um das Geld abzuheben und sein Konto zu löschen.«
»Und das bedeutet?«
Chakry nahm die kleine Plastikschachtel, die seinen Talisman umschloß, und schob sie von einer Hand in die andere. »Das bedeutet, daß die Ägypter ihr Mißfallen über die libanesische Politik ausdrücken. Sie wollen uns mehr arabisch sehen und weniger phönizisch. Sie wollen, daß wir gegen Israel aktiver werden. Sie wollen, daß wir die Jordanier und die Kuwaitis auf die Seite der VAR bringen.« Er hielt die Schachtel gegen das Licht und betrachtete sie eingehend, als sei sie ein Kristall. »Und wenn die Ägypter unangenehm werden, werden die Syrer noch unangenehmer, und die Russen werden uns gewaltig eins aufs Haupt geben. Zweihunderttausend Pfund sind eine Menge Geld – viel mehr, als Jarrah für Grenzsabotage braucht. Daher ist anzunehmen, daß sehr bald etwas Großes geschieht.«
»Mit zweihunderttausend kann er jeden Palästinaflüchtling westlich des Jordans kaufen – und obendrein noch einen Teil von Husseins Armee.«
»Vielleicht versucht er es«, sagte Chakry. »Sagen Sie, Mark, angenommen, wir brauchten schnellstens Deckung, woher könnten wir sie bekommen?«
»Wie hoch soll der Betrag sein – und bis wann wollen Sie ihn haben?«
»Fünfzig Millionen – in dreißig Tagen.«
»Großer Gott!« Mark Matheson war entsetzt. »Bei der derzeitigen Marktlage könnten Sie genausogut eine Scheibe vom Mond verlangen. Wenn ICI für eine Anleihe von vierundzwanzig Millionen acht Prozent bieten muß, dann heißt das, daß das Geld verdammt knapp ist.«
Chakry sah ihn mit einem spöttischen Lächeln an. »Angst, Mark?«
Matheson fand das nicht komisch. »Richtig, ich habe Angst. Wir sind zu dreieinhalb Prozent flüssig – was überall ein strafrechtliches Delikt wäre, bloß in Beirut nicht. Und Sie erzählen mir, daß eine Reihe größerer Kunden ihr Geld abheben will. Fünfzig Millionen in dreißig Tagen! Woher sollen wir das nehmen? In London kleben sie Tesafilm über den Riß im Pfund. In Zürich und bei den Rockefellers stehen wir in der Kreide. Also bleiben uns nur Mortimer auf der einen und der jüdische Markt auf der anderen Seite. Mortimer könnte uns mit einem Telefonanruf abdecken, aber Sie wissen, was er dafür verlangen wird.«
»Die Fluggesellschaft – und die bekommt er nur über meine Leiche.«
»Genau! Und damit bleibt Ihnen nur der jüdische Markt. Ich kann mir nicht vorstellen, daß die Juden große Lust haben, die Arabische Liga zu finanzieren, können Sie sich das vorstellen?« »Ich bin nicht so sicher«, sagte Chakry gelassen. »Geld kennt keine Rassenunterschiede. Und die Juden haben Sinn für Ironie. Ja! Ich könnte mir eine Situation vorstellen, in der eine starke jüdische Gruppe ganz gern mit der Phönizischen Bank zusammenarbeiten würde.«
Matheson starrte ihn voll skeptischer Bewunderung an. »Ich glaube wirklich, Sie haben die Unverfrorenheit, es zu versuchen.« »Das ist keine Frage der Unverfrorenheit, sondern eine Frage des Überlebens, und wenn ich, um zu überleben, mit Shaitan persönlich verhandeln muß, so werde ich das tun. Und jetzt wollen wir uns ein paar Notizen machen.«