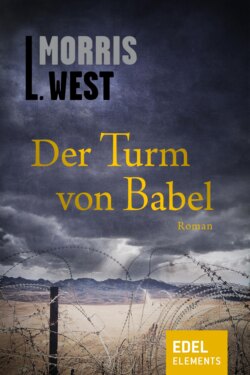Читать книгу Der Turm von Babel - Morris L. West - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Damaskus
ОглавлениеEr konnte sich nicht erinnern, wie lange er krank gewesen war. Die Zeit war eine unberechenbare Dimension geworden, die ihn eine Weile festhielt, ehe er wieder zurückglitt in die ruhelose Ewigkeit von Fieber, namenloser Angst und verworrenen Träumen. Die Zeit war das Sonnenlicht, das durch das geschnitzte Gitterwerk der Läden fiel, der Umriß der Tamariske draußen vor dem offenen Feuer und das Minarett der Moschee dahinter. Die Zeit war ein weißer Mond am blutroten Himmel. Die Zeit war das Gesicht einer Frau und die Berührung ihrer Hand und der Duft von Rosenwasser. Aber die Symbole waren ungenau. Wenn er versuchte, die Bilder festzuhalten, verschwammen sie vor seinen Augen und gerieten in Unordnung. Bis jetzt – bis zu diesem Augenblick, da er angstvoll, aber ruhig dalag und spürte, wie die Welt um ihn sich festigte.
Als erstes wurde ihm sein Körper bewußt. Er war kühl und trocken. Er spürte keine Schmerzen, nur eine eher angenehme Schwäche. Die Bettdecke fühlte sich frisch an. Das Kopfkissen war weich. Als er die Augen öffnete, sah er zuerst die große gepunzte Kupferlampe, die in der weißen Wölbung der Decke hing. Jedes Ornament, jede Figur war ihm aus hundert Nächten vertraut, in denen er wach gelegen und nachgedacht hatte. Es war also ausgeschlossen, daß er sich täuschte. Wenn die Lampe da war, war er auch da.
Direkt dem Bett gegenüber lag die Fensternische mit den Seidenvorhängen, in der ein Diwan und ein mit Perlmutt eingelegtes Taburett standen. Die Läden waren heruntergelassen, und das hölzerne Schnitzwerk hob sich dunkel vom blauen Himmel ab. Links von der Fensternische hing in der Mitte der weißen Wand die große blaue Fayenceplatte, die er aus Isfahan mitgebracht hatte. Alles war da, war bekannt und beruhigend, die Buchara-Teppiche, die glänzenden Kacheln, die auf Elfenbein gemalten Miniaturen, der Krummsäbel in der goldenen Scheide, den er bei Ali, dem Schwertmacher, gekauft hatte. Dann hörte er schwach, aber deutlich den Ruf des Bonbonverkäufers und danach das jammernde Wehklagen des Muezzins, das die Lautsprecher auf dem Minarett verzerrten. Plötzlich war Selim Fathalla kindlich glücklich, denn er lebte und lag in seinem eigenen Bett, in seinem eigenen Haus in Damaskus.
Es war seltsam, wie sehr er an der Persönlichkeit hing, die er darstellte, wie er sich an ihr erfreute, wie fleißig er darum bemüht war, sie zu stärken. Sie war keine Maske, alles stimmte an ihr, sie war ein in sich abgeschlossenes Ich, ohne das er sich verloren und einsam gefühlt hätte wie ein Bruder, der seines Zwillings beraubt ist. Das andere Ich – mit Namen Adom Ronen – war ebenso abgeschlossen in sich selbst. Sogar ihr Zwillingsverhältnis war vollkommen, und wenn die Interessen des einen die Ruhe oder die Sicherheit des anderen bedrohten, kam es zwischen ihnen zu brüderlichem Streit. Ihre Auseinandersetzung war ein Spiegelgespräch, bei dem immer die Angst zugegen war, daß der Spiegelmann eines Tages verschwinden könnte oder daß der Mann vor dem Spiegel weggehen und sein Ebenbild für immer in die Glasplatte gebannt zurücklassen könnte. Und beide hatten sie das gleiche Problem: Mit jedem Monat wurde es schwieriger festzustellen, wer das Ebenbild war und wer der Mann.
In dieser schäbigen, unlauteren Stadt war nur Selim Fathalla wirklich: Selim Fathalla, der Verschwörer aus Bagdad, der in Damaskus auftauchte, als die Baath-Partei im Irak unterdrückt wurde, und bei seinen syrischen Kameraden um Asyl bat. Er trug Briefe bei sich von Parteiführern, die sich, wie man wußte, versteckt hielten, und von alten Freunden an der amerikanischen Universität von Beirut. Er brachte auch Geld mit – ein großes Guthaben bei der Phönizischen Bank. Er besaß einige Kenntnisse des Import-Export-Geschäftes, die er sich auf der Rashid Street im alten Bagdad erworben hatte. Wegen der Briefe und des Geldes wurde er, wenn nicht mit Wärme, so doch wenigstens ohne allzu großes Mißtrauen aufgenommen. Da er liebenswürdig und großzügig war, schuf er sich schnell Freunde. Da er ein wagemutiger Kaufmann und obendrein ein linientreuer Baathist war, erwies er sich bald als nützlich für die Regierung, die die Industrie enteignet, die Landwirtschaft sozialisiert und den Kaufmannsstand abgeschafft hatte, und die nun vor dem Problem stand, ihre nationalen Produkte auf dem freien Markt zu verkaufen.
Selim Fathalla trug seinen Erfolg nicht auffällig zur Schau. Er wußte, daß man als Gast bescheiden sein mußte, wollte man nicht den Neid des Gastgebers erwecken. Deshalb kaufte er sich im alten Teil von Damaskus in der Nähe des Bazars ein Haus, hinter dessen schmucklosen Wänden er in unauffälligem Luxus lebte und Freunde aus der Partei und der Armee und Diplomaten aus Moskau, Prag und Sofia zu Gast hatte. Letztere schätzten ihn als gutunterrichteten Bekannten und kundigen Führer durch die Hintertreppenpolitik der arabischen Welt. Er war ein guter Moslem – wenn auch nicht übertrieben fromm. Aber man sah ihn oft genug in der Moschee, und er hatte genügend Freunde im Ulema, die an seiner Strenggläubigkeit keine Zweifel aufkommen ließen.
Er verliebte sich in seine Sekretärin und machte sie zu seiner Geliebten. Heiraten würde er sie allerdings nicht, da sie halb Französin war und außerdem Christin. Eine Ehe mit ihr hätte bei allen Anstoß erregt, die seinen guten Geschmack bei Frauen lobten. Er liebte den Handel und machte gern Geschäfte – welcher Iraker tat das nicht? –, aber er war nicht so habgierig, daß er sich Feinde machte, und nicht so dumm, die Regierung zu betrügen. So kam es, daß schließlich sogar der gefürchtete Safreddin, der Leiter des syrischen Geheimdienstes und Chefpräsident des Militärgerichtshofes, Vertrauen zu ihm hatte.
Adom Ronen, der Spiegel-Zwilling, befand sich in einer gänzlich anderen Lage. Er war weder froh noch zufrieden und fand es gelegentlich schwer, sich selbst zu respektieren.
Er war ein Gefangener in diesem weißgekalkten Zimmer. Eigentlich war er auf einen weit kleineren Raum beschränkt, auf eine winzige Kammer, kaum größer als ein Kleiderschrank, die hinter der Fayenceplatte versteckt lag: Hier schrieb er seine Berichte, fotografierte Dokumente und bewahrte die belastenden Geräte auf, mit denen er arbeitete. Von hier aus betrachtete er spöttisch die wilden Paarungen des Selim Fathalla und dachte an seine Frau und sein Kind in Jerusalem. Hier erlebte er jeden Tag die Tragödie der Spaltung: ja, er war gespalten und geteilt, und der eine Teil war des anderen Feind.
Adom Ronen war ein Gettojude aus Bagdad, der den Exodus seiner Landsleute organisiert hatte, selbst jedoch nie dazugekommen war, weil er nie ganz sicher war, wie weit er ihn wünschte. Er war ein Zionist, der das Haus Israel zu langweilig fand, um darin zu leben, sich aber dem Wagnis verpflichtete, es zu beschützen. Er war ein Abenteurer, geschlagen mit missionarischer Inbrunst, ein Zyniker, den Schuldgefühle plagten wie verborgener Aussatz.
Er war es, der Selim Fathalla erschaffen hatte und mit der amoralischen Gelassenheit beschenkte, die ihm half, alles zu ertragen. Er war es, der insgeheim Pläne entwarf und Ränke schmiedete, während Fathalla seine syrische Geliebte streichelte oder mit Safreddin im Namen Allahs Geschäfte besiegelte. Und trotz allem liebte er Fathalla, und Fathalla liebte ihn. Aus Gründen der Vernunft und des schlichten Überlebens waren sie aufeinander angewiesen. Wenn Adom Ronen die Belastung unerträglich fand, verführte Fathalla ihn zu satirischem Zeitvertreib. Wenn Fathalla ruhig schlafen konnte, dann nur, weil Adom Ronen über seine Gedanken und seine unbedachte Zunge wachte. Aber Selim Fathalla war in Damaskus an Malaria erkrankt und hatte acht Tage im Delirium gelegen, so daß keiner von ihnen wußte, was er gesagt hatte und wer es gehört haben könnte.
Er schob die Bettdecke zur Seite und setzte sich auf. Er fühlte sich benommen, aber kräftiger, als er erwartet hatte. Er stand auf und lehnte sich an die Wand. Als er sicher war, daß er nicht das Gleichgewicht verlieren würde, ging er langsam zum Fenster, öffnete die Läden, setzte sich auf den Diwan und blickte in den Garten hinaus.
Die Blätter der Tamariske hingen schlaff in der stillen Mittagsluft. Vor den grauen Mauern blühten die Geranien in Feuerfarben. Der Rosenstrauch vor dem Fenster stand schon zur Hälfte in Blüte. Aus dem Maul des Kreuzfahrerlöwen floß ein dünner Wasserstrahl in das Steinbecken. In der Mitte der kleinen Rasenfläche kniete Hassan der Gärtner wie auf einem Gebetsteppich, zupfte Unkraut aus und schnitt das Gras mit einer Schere. Der Straßenlärm und das Geschrei vom nahe gelegenen Markt drang nur schwach herüber. Der häusliche Friede war zumindest noch unversehrt.
Als er den schwachen Rosenduft einatmete, dachte er an Emilie Ayub und wünschte, sie wäre bei ihm, würde ihn baden und massieren und seinem ausgebrannten Körper die Leidenschaft zurückgeben. Aber sie kam erst, wenn er sie rief, denn das war die Rolle, die er ihr zugewiesen hatte. Sie war die verschwiegene und immer bereite Geliebte, die nur für ihren Mann da war und sein Ansehen unter seinen Moslembrüdern wahrte. Die Rolle schien sie zufriedenzustellen, während sie für ihn alles andere als befriedigend war. Aber er wagte es nicht, ihr eine größere Rolle anzuvertrauen, denn es war besser, die geistige Einsamkeit zu ertragen, als das Geheimnis der Zwillinge mit jemandem zu teilen und damit den Hals zu riskieren.
Das Klopfen an der Tür schreckte ihn auf. Er brauchte eine Weile, bis er wieder ruhig war, und dann rief er: »Herein!«
Die schwere Tür öffnete sich knarrend, und die alte Farida ließ Dr. Bitar in das Schlafzimmer. Bitar war ein großer geschmeidiger Mann, der ihn immer an ein Bambusrohr erinnerte, das sich im Wind bog. Sein Gesicht war lang und schmal und weich wie das einer Frau. Seine Hände waren zart und ausdrucksvoll und immer sehr gepflegt. Seine Stimme paßte eigentlich nicht zu seiner Erscheinung; er hatte einen lauttönenden tiefen Baß, der besser zu einem Opernsänger gepaßt hätte als zu einem Arzt. Sein Eintreten hatte etwas Theatralisches. Er schickte die alte Frau mit einer großen Geste aus dem Zimmer und blieb dann mit gespreizten Beinen stehen, um seinen Patienten prüfend zu betrachten.
»So, wir fühlen uns heute besser! Wir haben kein Fieber mehr! Wir glauben, wir seien vollkommen wiederhergestellt!«
Fathalla sah ihn lächelnd an und antwortete: »Ich fühle mich sehr schwach – und ich stinke wie ein Bettler aus dem Bazar.«
»Nehmen Sie ein Bad, mein Freund, Essen Sie nur leichte Sachen und trinken Sie viel. In zwei Tagen sind Sie ein neuer Mensch.« Mit der gleichen dramatischen Berechnung betrat er den Alkoven und ließ sich Fathalla gegenüber nieder. Er ergriff sein Handgelenk, fühlte den Puls und nickte weise. »Gut! Etwas schnell, aber gut. Sie wissen natürlich, daß Sie für immer infiziert sind. Wenn Sie weitere Anfälle vermeiden wollen, müssen Sie ständig Paludrintabletten nehmen. Ich hab’ Ihrem Mädchen das Rezept gegeben. Sie bringt sie Ihnen heute abend mit.«
»Wann kann ich wieder an die Arbeit?«
Bitar zuckte die Schultern. »In ein paar Tagen – es sei denn, Ihre Leber hat was abbekommen, aber das glaube ich nicht.« Dann sagte er etwas gedämpfter: »Sie reden im Schlaf, mein Freund. Das ist gefährlich.«
Fathalla blickte erschrocken auf. »Was habe ich gesagt?«
»Sie nannten Namen – Jakov Baratz und Safreddin und andere, die wir beide kennen, aber lieber nicht hören. Sie sprachen von der Ermordung eines Königs und von einem Mann auf Zypern, der Botschaften schickt, und noch von anderen Sachen.«
»Hat mich sonst noch jemand gehört?«
»Ihre Frau, Emilie Ayub. Sie war während des Fiebers Tag und Nacht bei Ihnen.«
»Wieviel hat sie verstanden?«
»Ich weiß nicht. Ich habe sie nicht gefragt, und sie hat nichts dazu gesagt. Es steht fest, daß sie Sie liebt, vielleicht ist das genug.«
»Habe ich von – anderen Frauen gesprochen?«
»Ich habe nichts gehört. Und sie? Ich hoffe nicht.«
»Ich habe Angst«, sagte Selim Fathalla.
»Gut!« sagte Dr. Bitar. »Wenn es Sie vorsichtig macht – gut!«
»Haben Sie noch andere Neuigkeiten?«
»Nicht direkt. Sechs Zeitungen griffen König Hussein an und nannten ihn ein Werkzeug in den Händen ausländischer Imperialisten. Angesichts dessen, was wir bereits wissen, ist der Zeitpunkt bedeutsam. Außerdem hat Safreddin mich zweimal angerufen und nach Ihrem Gesundheitszustand gefragt. Ich habe ihm gesagt, ich würde ihm sofort Bescheid geben, sobald Sie imstande sind, Besucher zu empfangen.«
»Soll ich ihn anrufen?«
Bitar überlegte einen Augenblick, dann spreizte er in einer Geste, die Gleichgültigkeit ausdrückte, seine weichen Hände. »Wie Sie wollen. Es wäre eine Gefälligkeit, die Ihnen eine kleine Information einbringen könnte.«
»Dann wollen wir es gleich tun«, erwiderte Fathalla.
Er ging leicht schwankend zum Telefon und wählte die Privatnummer des Leiters des Zivilen Geheimdienstes. Ein paar Sekunden später hörte er die bekannte monotone Stimme.
»Hier Safreddin.«
»Hier ist Selim Fathalla.«
»Ja, wie geht es Ihnen!« Safreddin wurde sofort herzlich. »Sie waren sehr krank. Doktor Bitar hat es mir erzählt. Wie fühlen Sie sich?«
»Etwas schwach. Aber das Fieber ist vorbei. Sie müssen in diesem Land wirklich mal was gegen die Malaria unternehmen.«
Es war ein schlechter Scherz, aber offenbar gefiel er Safreddin. Er lachte und antwortete freundlich: »Ich studiere gerade das neue Programm. Ich werde eine Fußnote hinzufügen, daß wir es uns nicht leisten können, gute Freunde wie Sie zu verlieren.«
»Doktor Bitar hat mir befohlen, noch ein paar Tage im Haus zu bleiben. Ich überlege, ob Sie vielleicht vorbeikommen und eine Tasse Kaffee mit mir trinken könnten.«
»Natürlich, ja. Sagen wir morgen vormittag gegen zehn.«
»Ich werde Sie erwarten.«
Dann kam eine lange Pause, und das Krachen in der Leitung klang gedämpft, als hätte sich eine Hand über die Muschel des Telefons gelegt. Schließlich wurde die Hand weggenommen, und Safreddin sprach wieder.
»Da wäre eine Sache, über die ich Sie bitten möchte nachzudenken, mein Freund. Vielleicht können Sie uns helfen.«
»Gern«, sagte Selim Fathalla ungezwungen. »Was kann ich für Sie tun?«
»Wann schicken Sie Ihre nächste Lieferung nach Amman?«
»Da muß ich nachsehen, aber ich glaube, am Mittwoch, dem fünfundzwanzigsten. Weshalb?«
»Wir möchten, daß Sie etwas von uns mitschicken.«
»Und was ist dieses Etwas?«
»Waffen«, sagte Safreddin freundlich. »Gewehre, Handgranaten und Plastiksprengstoff.«
»Oh…!« Fathallas Überraschung war echt, aber er betonte sie noch besonders. »Wir können weiße Elefanten mitnehmen, wenn Sie wollen – und falls Sie unsere Abfertigung an der jordanischen Grenze arrangieren.«
»In diesem Fall…« Safreddin beließ es einen Augenblick bei dem begonnenen Satz, als wolle er sich an den Schluß nicht binden. »In diesem Fall, mein Freund, sind wir unter Umständen bereit, von einer Zollabfertigung abzusehen.«
»Oh!« sagte Selim Fathalla wieder. »Dann sollten wir die Sache zusammen planen. Lassen Sie mich darüber nachdenken. Ich will versuchen, mir bis morgen ein paar Vorschläge für Sie zu überlegen.«
»Sie sind ein guter Freund«, sagte Safreddin höflich. »Ich möchte Ihnen sagen, daß wir sehr viel Vertrauen zu Ihnen haben.«
»Ich bin entzückt, das zu hören«, antwortete Fathalla.
Als er den Hörer auflegte, merkte er, daß seine Hände zitterten und klebriger Schweiß auf seiner Stirn stand. Als er Bitar erzählte, was Safreddin von ihm wollte, pfiff der Arzt leise durch die Zähne. Dann schwieg er. Fathalla sagte:
»Es stinkt. Die Sache stinkt wie ein Misthaufen.«
»Ich weiß«, sagte Dr. Bitar. »Es gibt mindestens hundert Möglichkeiten, Waffen nach Jordanien zu schmuggeln, ohne die Grenzbehörden einzuschalten. Safreddin hat sie alle schon mal benutzt. Weshalb braucht er Sie dazu? Und weshalb redet er so offen darüber?«