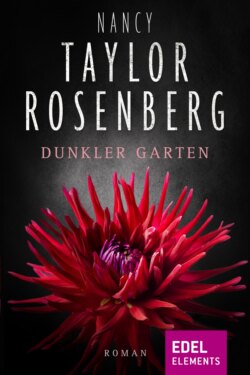Читать книгу Dunkler Garten - Nancy Taylor Rosenberg - Страница 5
Kapitel 3
ОглавлениеDonnerstag, 14. September 2006, 15.45 Uhr
Robert Abernathy ging zu seinem bronzefarbenen Acura, der auf dem Parkplatz der Verwaltungszentrale von Ventura County stand. Bis zu seiner Einweisung in die psychiatrische Klinik in San Francisco blieben ihm noch dreißig Tage, um seine Angelegenheiten in Ordnung zu bringen. Er war ein Mann von achtundfünfzig Jahren mit massigem Körper, einem runden Gesicht mit Hängebacken und schütterem grauen Haar. Seine tief liegenden Augen waren hinter dunklen Brillengläsern verborgen. Sein brauner, billiger Anzug war zerknittert und wies unter den Achseln Schweißflecken auf. Das heutige Treffen im Büro der Staatsanwaltschaft hatte vier zermürbende Stunden gedauert.
Die letzten zwei Jahre waren ein einziger Albtraum gewesen. Zum Teil war er freilich selbst dafür verantwortlich, dass es sich so lange hingezogen hatte. Er hatte sich standhaft geweigert, sich irgendeines Vergehens schuldig zu bekennen. Man hatte Experten aus dem ganzen Land herbeigerufen, um sein Labor auseinanderzunehmen und jedes einzelne Beweisstück zu untersuchen, das seine Techniker und er jemals analysiert hatten. Er hatte nur in einigen wenigen Fällen manipuliert oder das Ergebnis verfälscht. Doch es hätte auch ein einziger Fall genügt, um seine gesamte Arbeit in Misskredit zu bringen.
Als Abernathy seinen Wagen erreicht hatte, hörte er hinter sich eine tiefe Stimme, die ihn beim Namen rief, und er drehte sich um. Ein großer, dunkler Mann mit einer weißen Baseballkappe stand etwa drei Meter von ihm entfernt in der Mitte der Straße. Wahrscheinlich ein Zeitungsschnüffler, dachte er, während er rasch in den Wagen stieg und losfuhr.
Während er den Victoria Boulevard in Richtung Oxnard entlangfuhr, wo er wohnte, bemerkte er im Rückspiegel einen Pick-up, der ihn zu verfolgen schien. Er versuchte herauszufinden, ob es sich bei dem Fahrer um den Mann von vorhin handelte, konnte hinter dem Lenkrad jedoch lediglich eine schattenhafte, konturlose Gestalt ausmachen. Seine Retinopathia pigmentosa raubte ihm unaufhaltsam das Augenlicht. Zuerst war sein peripheres Gesichtsfeld verschwunden. In den letzten fünf Jahren war es dann so gewesen, als würde er die Welt durch einen Strohhalm sehen. Aus Angst um seinen Job hatte er versucht, seine Erkrankung zu verbergen. Und jetzt würde er in Schande in die unausweichliche Blindheit gehen, eingesperrt in der Klapsmühle mit einem Haufen Irrer.
Langsam und über das Steuerrad gebeugt, um besser sehen zu können, bog er in die Clover Street ab und fuhr weiter in Richtung Orange Avenue. Er veränderte seine Route nur selten, da er sich sonst leicht verfuhr und in Panik geriet.
Seit seiner Scheidung vor fünfzehn Jahren lebte Abernathy allein in einem bescheidenen Häuschen mit drei Zimmern. Seine erwachsene Tochter, Janie, wohnte in Irvine und kam ihn immer samstags besuchen; wenn sie dann abends in ein Restaurant gingen, setzte sie sich ans Steuer, weil er nachts nicht mehr fahren konnte. Doch aus Wut über sein Vergehen hatte sie ihn schon seit über einem Monat nicht mehr besucht, sondern nur mit ihm telefoniert. Er hatte sie jahrelang belogen und ihr erzählt, er untersuche kein Beweismaterial mehr und kümmere sich nun nur noch um die Verwaltung.
Als er vor der roten Ampel anhielt, glaubte er, den Pick-up wieder zu sehen, war sich jedoch nicht sicher. Er zündete sich eine Marlboro an und stellte fest, dass seine Finger zitterten. Nach wenigen Zügen begann er zu husten. Er drückte die Zigarette im Aschenbecher aus und kurbelte das Fenster hinunter.
Seine Anwälte hatten die Sorge geäußert, jemand könne ihm etwas antun. Auch aus diesem Grund hatten sie ihn zu der Verfahrensabsprache überredet, weil er dadurch die Möglichkeit erhielt, seine Strafe in einer Einrichtung außerhalb seines Heimatortes abzusitzen. Es graute ihn zwar vor der geschlossenen Anstalt, aber zumindest würde er dann nicht mehr ständig auf der Hut sein müssen.
Sehr zum Missfallen seiner Anwälte hatte sich Abernathy bei den verschiedenen Verhandlungsgesprächen geweigert, sein Problem gegenüber den Staatsanwälten und den Sachverständigen zu benennen. Er wollte sie lieber in der Annahme lassen, er habe eine Art Zusammenbruch erlitten, als ihnen zu gestehen, dass er an einem Punkt angelangt war, wo er selbst durch sein Mikroskop kaum noch etwas gesehen hatte. Er hätte schon vor Jahren, als ihm erstmals bewusst wurde, dass mit seinen Augen etwas nicht stimmte, den Dienst quittieren sollen. Aber er war ein starrköpfiger Mensch und er liebte seine Arbeit.
Natürlich hatte er versucht, einen Großteil der Arbeit an erfahrene Mitarbeiter zu delegieren, doch bei schweren Fällen hatten ihn Staatsanwaltschaft und Polizei gedrängt, das Material persönlich zu analysieren, damit sie ihn bei der Verhandlung als gerichtlich bestellten Sachverständigen anfordern konnten.
Wie hätte er seine Arbeit aufgeben sollen, wenn plötzlich die ganze Welt davon fasziniert war? Er war von einem unbekannten Laborfuzzi zu einer Berühmtheit geworden, die in Fernsehshows auftrat, Vorträge hielt und Artikel für Zeitungen und Zeitschriften verfasste.
Warner Chen war seine rechte Hand gewesen, und seine rechte Hand hatte sich gegen ihn erhoben. Im Gegensatz zu anderen Labortechnikern hatte Chen genau gewusst, was los war. Quasi über Nacht hatte er dann plötzlich sein Gewissen entdeckt. Nachdem er Abernathys Lebenswerk erfolgreich in Verruf gebracht hatte, hatte er für sich selbst einen angenehmen Deal ausgehandelt, wo er nichts weiter zu tun brauchte, als mit den Ermittlern zu kooperieren. Jetzt würden ganze Wagenladungen von Verbrechen neu verhandelt werden, und viele Verfahren würden mit einem Freispruch enden. Von offizieller Seite war alles versucht worden, um die Sache unter Verschluss zu halten, aber Chen hatte beschlossen, sich bei der Presse auszukotzen. Hoffentlich hatte Chen seine sechzig Sekunden des Ruhms genossen, denn die hatten Abernathys Leben zerstört.
Vorsichtig lenkte Abernathy den Wagen in seine Zufahrt. Als er die Wagentür öffnete und ausstieg, war ringsum alles ruhig. Die Straße war zu beiden Seiten von hohen Bäumen gesäumt, und sein Haus lag hinter dichtem Buschwerk. Er brauchte seine Privatsphäre.
Die meisten Leute aus seiner Siedlung waren noch nicht von der Arbeit zurückgekehrt. Ihre Gärten waren voller Dreiräder, Klettergerüste und anderem Kinderspielzeug, die Kinder selbst waren jedoch alle noch in der Kindertagesstätte. Keiner seiner Nachbarn hatte das Geld für ein Kindermädchen, wiewohl die Grundstücke in dieser Gegend stetig an Wert gewonnen hatten. Selbst ein Haus wie seines würde jetzt über fünfhunderttausend Dollar bringen. Er hatte vorgehabt, es zu verkaufen, wenn er in Rente ginge und von dem Gewinn zu leben. Der Reinwert des Hauses war inzwischen jedoch kaum noch der Rede wert. Wenn er seine Anwälte bezahlt hätte, würde der Restwert wahrscheinlich gerade noch für die zwanzigtausend Dollar Geldstrafe reichen, die als Bestandteil des Deals mit der Staatsanwaltschaft über ihn verhängt worden war.
Angst durchfuhr ihn, als dieselbe tiefe Stimme erneut seinen Namen rief. Durch den Tunnel seines eingeschränkten Gesichtsfelds erspähte er auf der anderen Straßenseite den Pick-up. Rasch öffnete er das Gartentor und eilte über den Gehweg auf sein Haus zu. Schritte. Als er sich umdrehte, sah er eine dunkle Gestalt, die drohend vor ihm aufragte.
»Sind Sie Robert Abernathy?«
»Was wollen Sie?«, rief Abernathy mit zitternder Stimme. »Verschwinden Sie von meinem Grundstück!«
»Beantworten Sie, verdammt noch mal, meine Frage. Sind Sie Robert Abernathy?«
»Nein«, log er, während er sich umdrehte und auf sein Haus zueilte. Das musste ein Reporter sein. Was wollten diese Idioten von ihm?
Während Abernathy nach seinen Hausschlüsseln kramte, blieb der Mann auf dem Bürgersteig stehen. »Verschwinden Sie!«, kreischte Abernathy und hob drohend die Faust. »Sie verfolgen die falsche Person. Wenn Sie nicht sofort gehen, werde ich die Polizei rufen. Ich kenne keinen Abernathy.«
»Und ob Sie den kennen«, erwiderte der Mann und zog aus seinem Anorak eine große, schwarze Handfeuerwaffe.
»Nein! … Bitte! …«, flehte Abernathy, ehe der Mann den Abzug drückte.
Die Wucht des Schusses warf ihn gegen die Tür. Die Beine gespreizt, glitt er zu Boden. Sein Kopf fiel auf die Brust. Blut tropfte auf seine Hose, bildete eine Pfütze auf dem Betonboden der Terrasse.
Abernathy brauchte sich keine Sorgen mehr um seine Fehler, seine Finanzen, sein schwindendes Augenlicht oder den Aufenthalt in der Psychiatrie zu machen. Er hatte über das Schicksal zahlreicher Menschen entschieden, und nun hatte jemand über seines entschieden.
Carolyn beschloss, früher nach Hause zu gehen, da sie am nächsten Tag ohnehin länger arbeiten musste. Ihre Tasche war randvoll mit Akten. Sie nahm fast jeden Abend Arbeit mit nach Hause, rechnete diese Überstunden jedoch nur selten ab. Denn nur auf diese Weise war es ihr möglich, auf dem aktuellen Wissensstand zu bleiben und dennoch Zeit mit ihren Kindern zu verbringen. Es herrschte überraschend wenig Verkehr, und so kam sie bereits um Viertel nach fünf an der Saint Johns Catholic Church an, parkte ihren weißen Infiniti und ging zum Seiteneingang des Gebäudes.
Saint John war eine kleine Gemeinde, und während der Woche fanden keine Abendmessen statt. Hin und wieder ging Carolyn zur Messe in die St. Bernadette, die ein paar Meilen entfernt war. Doch ihre Zeit war begrenzt, und obgleich sie versuchte, so oft wie möglich am Abendmahl teilzunehmen, schöpfte sie die meiste Kraft aus der kontemplativen Stille, die sie in einer leeren Kirche fand.
Sie ging durch den Mittelgang nach vorn, beugte das Knie, schlüpfte in die erste Bankreihe und kniete sich zum Beten nieder. Wenn sie hier hin und wieder andere Gläubige beim Beten antraf, fragte sie sich jedes Mal, ob sie für ein krankes Familienmitglied beteten oder Trost suchten, weil sie vor Kurzem einen geliebten Menschen verloren hatten, oder ob sie, wie Carolyn, gekommen waren, um Buße für ihre Sünden zu tun.
Carolyn hatte ein Menschenleben auf dem Gewissen. Man hatte ihr bestätigt, in Notwehr geschossen zu haben, und Carolyn war sich sicher, dass sie, hätte sie anders reagiert, heute nicht mehr am Leben wäre. Der Mann, den sie erschossen hatte, war ein Schwerverbrecher gewesen, ein Mörder und Handlanger eines internationalen Waffenhändlerrings. Dennoch war er ein Mensch gewesen, und sie hatte sein Leben ausgelöscht. Sie erinnerte sich nicht daran, eine bewusste Entscheidung zum Schießen getroffen zu haben. Das sei immer so, hatten ihr ihre Freunde bei der Polizei erklärt. In solchen Situationen übernehme der Instinkt.
Ihre Umwelt nahm sie als starke, kompromisslose Frau wahr, doch tief in ihrem Inneren lebte nach wie vor das sensible und idealistische Kind von einst. Ein Kind, das von einer schönen, friedlichen Welt träumte, wo die Menschen freundlich und respektvoll miteinander umgingen und es weder Waffen noch Gewalt gab.
Allmählich begann sich die Anspannung des Tages zu lösen. Hier, an diesem Ort, hatte sie das Gefühl, wieder ein Körnchen Hoffnung schöpfen zu können, ein Quäntchen Kraft, das ihr über den nächsten Tag helfen würde. Als sie die Kirche nach einer Viertelstunde wieder verließ, schlug ihr die Realität gnadenlos mitten ins Gesicht.
Ein Mann auf der anderen Straßenseite wusch gerade seinen schwarzen, nagelneu aussehenden BMW, unter Mithilfe seines Sohnes, eines kleinen Jungen mit flachsblondem Haar, der mit einer großen, seifigen Bürste eifrig die Felgen schrubbte. Plötzlich stieß der Mann eine Reihe von Flüchen aus und packte das Kind am Arm. »Ich habe dir doch gesagt, du sollst kein Wasser auf meine Hose spritzen, du kleiner Scheißer!«, brüllte er den Jungen an. »Und jetzt mach weiter. Die Reifen müssen blitzblank sein, hast du verstanden?« Abrupt ließ er den Jungen los, sodass dieser aus dem Gleichgewicht geriet und hinfiel. Nachdem sich der Junge wieder aufgerappelt hatte, schrubbte er weiter an den Felgen, die sein Vater mehr wertzuschätzen schien als seinen Sohn.
Carolyn zog ein kleines Notizbuch aus ihrer Handtasche und notierte sich die Adresse und das Kennzeichen des BMW, um diese Daten an das Jugendamt wegen Verdachts auf Kindesmisshandlung weiterzureichen. Genau in diesem Moment drehte sich der kleine Junge zu ihr um und lächelte sie strahlend an, als ob nichts passiert wäre.
Die Ruhe, die sie in der Kirche erfahren hatte, war zerstört. Wenn sie Gott wäre, dachte sie, würde sie die Welt in ihre Einzelteile zerlegen und die Schöpfung neu beginnen.