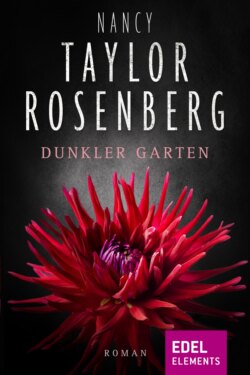Читать книгу Dunkler Garten - Nancy Taylor Rosenberg - Страница 8
Kapitel 6
ОглавлениеFreitag, 15. September 2006, 19.00 Uhr
Der Mörder trug einen langen schwarzen Trenchcoat und einen Cowboyhut, den er tief in die Stirn gezogen hatte. Das eingeebnete Stück Land lag mitten auf einem Hügel, zu dessen Füßen sich die Stadt erstreckte. Auf der linken Hügelseite befanden sich die Baustellen zukünftiger Häuser. Keine großen, aber wegen der Aussicht teure Häuser.
Wie viel Zeit blieb ihm noch?
Vor wenigen Monaten hatte er im Maklerbüro angerufen und gefragt, wann die zweite Bauphase beginnen würde. Irgendeine dumme Tusse hatte zehn Minuten seiner Zeit verschwendet, indem sie ihm einzureden versuchte, er solle jetzt kaufen, da die Häuser später fünfzigtausend mehr kosten würden.
Auf dem Rückweg zur Schotterstraße zählte er die Schritte zum Grab ab. Sobald er darauf stand, dachte er an jene Nacht zurück, als er sie hier begraben hatte. So viel Zeit war seitdem vergangen, als wäre es in einem anderen Leben passiert. Alles war gut gegangen, weit besser als erwartet. Kein Problem mit irgendwelchen Behörden. Er hatte, wenn überhaupt, nur wenige Fehler gemacht. Die Örtlichkeit war jedenfalls kein Fehler gewesen. Damals war dieser Hügel von dichtem Gestrüpp bedeckt gewesen, ein Stück Wildnis mitten im Nirgendwo. Jetzt befanden sich hier überall Einfamilienhäuser, Wohnblocks mit Eigentumswohnungen, Apartmenthäuser, Parks und Einkaufszentren. Wegen des Meeres konnte sich die Stadt nur in eine Richtung ausbreiten. Er blickte sich um und fragte sich, wann auch dieses Gebiet als Bauland erschlossen würde.
Er kauerte sich hin, nahm eine Hand voll Erde und ließ sie zwischen den Fingern hindurchrieseln. Sie war eine hübsche Frau gewesen, keine Schönheit, aber attraktiv. Sicher keine Intelligenzbestie, aber auch nicht dumm. Er hätte mit dem Tod um sie würfeln und sie am Leben lassen können, doch das entsprach nicht seiner Vorgehensweise. Unter der Erde war sie sehr gut aufgehoben, nur nicht an dieser speziellen Stelle.
Er nahm an, dass nicht mehr viel von ihr übrig war. Das war gut, da sie ziemlich schwer gewesen war. Nicht übergewichtig, nur tot, und ein Toter kam einem immer schwerer vor. Außerdem war ein menschlicher Körper mit seinen vielen Gliedmaßen sehr unhandlich. Selbst in tiefster Nacht war es riskant, mit einer Leiche über der Schulter durch die Gegend zu laufen.
Vom Meer wehte eine frische Brise zu ihm herüber. Bald würde es hier nach Menschen stinken – nach Autoabgasen, Kochdünsten, schmutzigen Windeln, Abfall. Es blieb ihm nicht mehr viel Zeit, um sie zu verlegen. Zuerst musste er jedoch einen anderen Ort auskundschaften. Und woher sollte er wissen, ob dort nicht über kurz oder lang dasselbe passieren würde? Er konnte nicht riskieren, eine längere Strecke mit sterblichen Überresten im Kofferraum zu fahren. Nein, er musste eine andere Lösung finden, eine Lösung, die endgültig wäre, sodass er diese Sorge hinter sich lassen könnte.
Bis auf das Ausgraben würde es kein großer Kraftaufwand werden. Zeit und Insekten hatten für ihn gearbeitet. Alles, was er brauchen würde, war ein Plastiksack.
Die Musik auf volle Lautstärke aufgedreht, fuhr Carolyn in ihrem zehn Jahre alten Infiniti nach Hause. Sie hatte den Wagen vor drei Jahren bei einer Autoversteigerung erworben, die die Polizeibehörde regelmäßig veranstaltete, um konfiszierte Autos zu veräußern. Der Wagen hatte ihr gute Dienste geleistet, doch jetzt wurde es langsam Zeit, die Bremsbeläge erneuern zu lassen. Wenn sie bremste, hörte sie, wie die Beläge gegen die Scheibe rieben. Sie hatte den Infiniti zu einem sehr guten Preis bekommen, da er bereits über hunderttausend Meilen auf dem Buckel gehabt hatte. In erster Linie hatte sie ihn aber wegen seiner erstklassigen Stereoanlage ausgewählt, die vermutlich von irgendeinem Drogendealer für ein kleines Vermögen eingebaut worden war. Wie alle anderen Dinge, die sie sich vor längerer Zeit angeschafft hatte, würde auch der Wagen bald größere Reparaturen benötigen.
Ihr Musikgeschmack war breit gefächert, reichte von Gruppen wie Fine Young Cannibals bis hin zu Prince, Peter Gabriel und Sting. Besonders gefiel ihr eine Nonnenband, die sich Daughters of St. Paul nannte und mit wahren Engelsstimmen sang. Ihr Gesang hatte absolut nichts mit langweiliger geistlicher Musik zu tun, und zu manchen Stücken konnte man sogar tanzen. Die Freude, die in den Stimmen mitschwang, wirkte sich auf Carolyns Laune immer positiv aus. Sie mochte aber auch Bluessänger wie Etta James und John Lee Hooker.
Heute Abend hatte sie jedoch etwas Rockiges gebraucht, das sie aus ihrer Niedergeschlagenheit riss und sich für Prince entschieden. Wegen seiner anzüglichen Texte und Flüche hörte sie ihn nie, wenn Rebecca im Auto mitfuhr. Er war gewissermaßen ihr Geheimnis. Doch nach der grässlichen Begegnung mit Carl Holden konnte nicht einmal die Musik ihre düstere Stimmung vertreiben.
Als sie in ihre Zufahrt einbog, sah sie im Vorgarten das Schild des Maklerbüros. Die Maklerin hatte gemeint, das Haus werde sich in Nullkommanichts gut verkaufen lassen. Dennoch überfiel Carolyn bei dem Gedanken, ihr Haus aufzugeben, eine tiefe Traurigkeit. Hier hatte sie ihre Kinder großgezogen, es war ihr Zuhause. So vieles war innerhalb dieser Mauern geschehen. Mit dem Verlust der vertrauten Räume würden mit der Zeit auch manche Erinnerungen verloren gehen.
Doch das Haus musste verkauft werden, mahnte sich Carolyn. Ihr achtzehnjähriger Sohn, John, war am MIT, dem Massachusetts Institute of Technology, aufgenommen worden. Er hatte letztes Jahr die Ventura High School beendet und anschließend den ganzen Sommer in einem italienischen Restaurant gekellnert, um Geld für sein Studium zu verdienen. Er würde im Frühjahr zu studieren beginnen, vorausgesetzt natürlich, Carolyn konnte das erforderliche Geld aufbringen.
John Sullivan war ein intelligenter junger Mann von über einem Meter achtzig, dichtem dunklen Haar und einer liebenswerten, angenehmen Art. Die Mädchen umschwärmten ihn, doch er interessierte sich mehr für intellektuelle Tätigkeiten. Carolyn war sich jedoch ziemlich sicher, dass er mit seinen achtzehn Jahren keine Jungfrau mehr war. Er hatte während der gesamten Schulzeit immer fleißig gelernt. Carolyn konnte ihn unmöglich bitten, auf eine billigere Hochschule zu gehen. Das MIT war sein Traum. Selbst mit einem Studentendarlehen und Stipendien würden die vier Hochschuljahre über hundertfünfzigtausend Dollar kosten. Und danach stand womöglich ein weiterführendes Studium an. Sie wollte, dass John so weit kam, wie es seinem intellektuellen Potenzial entsprach.
Vor einigen Jahren hatte Carolyn ein Abendstudium für Jura begonnen, in der Hoffnung, irgendwann eine eigene Kanzlei zu haben und genug Geld zu verdienen, um für ihre beiden Kinder die Ausbildung bezahlen zu können. Doch ihr Gehalt als Bewährungshelferin hatte nicht ausgereicht, um damit die Studiengebühren abzudecken, und auf Dauer wäre es ohnehin unmöglich gewesen, Studium, Arbeit und ihre Aufgaben als allein erziehende Mutter zu bewältigen.
Ihr jüngerer Bruder, Neil, hatte ihr finanzielle Hilfe angeboten, doch sie hatte abgelehnt. Als Künstler verfügte er über kein festes Einkommen. Außerdem machte er sich ständig Sorgen, dass ihm irgendwann das Geld ausginge.
Kaum hatte sie ihren Sicherheitsgurt gelöst, klingelte ihr Handy. »Hey«, meldete sich Neil, »du hast mich seit fast einer Woche nicht angerufen. Mom hat sich auch schon beschwert. Ich brauche meine große Schwester. Seit der Trennung von Melody bin ich schrecklich einsam.«
»Du warst auch einsam, als du mit Melody zusammen warst«, erwiderte sie. Sie hatte diese materialistische Frau, mit der er bis vor Kurzem liiert war, nie gemocht. Abgesehen davon war Neil auch nicht einsam; das sagte er nur, um Aufmerksamkeit zu erlangen. Wie Carolyn wusste, war er schon längst wieder in sein Junggesellenleben zurückgefallen und jonglierte mit einem Dutzend Frauen herum. Wenn jemand über Einsamkeit zu klagen hatte, dann war das sie, zumindest, was männliche Gesellschaft anbelangte.
Neil und Carolyn hatten beide die unheimliche Fähigkeit, die Gedanken des anderen zu lesen. John, der trotz seiner Jugend ein extremer Skeptiker war, hielt das für baren Unsinn. Doch wann immer einer von ihnen an den anderen dachte oder einer von ihnen in Schwierigkeiten war, klingelte unvermeidlich das Telefon. »Können wir morgen miteinander sprechen, Neil? Ich bin gerade erst nach Hause gekommen, und die Kinder haben wahrscheinlich Hunger.«
»Sie werden es überleben«, spöttelte er. »Gott, Carolyn, du wirst doch hoffentlich nicht kochen?«
»Sei still«, lachte sie. »Ich bin eine gute Köchin, und das weißt du auch.«
»Eigenlob stinkt.« Neil holte tief Luft. »Arme Mom. Wenn du sie nicht bald anrufst, wird sie sich an den Notdienst für vernachlässigte Senioren wenden. Als ich sie gestern Abend angerufen habe, meinte sie, sie habe nicht mehr lange zu leben. Ich habe mich in den Schlaf geweint.«
»Wie du weißt, behauptet Mom das schon seit fünfzehn Jahren. Ich habe Mittwochabend eine Stunde lang mit ihr telefoniert. Am Sonntag gehe ich sie mit den Kindern besuchen. Kommst du auch?«
»Du weißt, wie gern ich das möchte, Carolyn«, sagte er in dramatischem Ton. »Aber leider habe ich eine Ausstellung. Außerdem wollt ihr beiden euch doch sicher mal wieder von Frau zu Frau ausquatschen. Weibliche Probleme, Frisuren, Familienklatsch.«
»Du bist unverbesserlich, Neil«, lachte sie. Sie liebte seine Art von Humor. »Aber mir machst du nichts vor. In der Zeitung stand nämlich nichts von einer Ausstellung. Du lügst, damit du Mutter nicht zur Sonntagsmesse fahren musst. Aber du bist dran. Ich habe alle ihre Rechnungen bezahlt und einen Großteil ihrer Lebensmitteleinkäufe erledigt.«
»Du hast mich auch angelogen«, sagte er.
»Wann?«
»Als du sagtest, du gehst in den Laden, um Milch zu kaufen, dir stattdessen aber Schokolade gekauft und die ganze Tafel für dich gehamstert hast.«
»Herrgott, Neil, da war ich zwölf Jahre alt!«
»Olga spaziert gerade zur Tür herein. Sie ist das schwedische Model, das ich gemalt habe. Wangenknochen, für die man sterben könnte, und die längsten Beine, die ich je gesehen habe. Sie spricht kein Wort Englisch. Perfekt.«
Carolyn drückte auf die Aus-Taste. Sie tauschten nie Abschiedsworte aus, wussten beide instinktiv, wann ein Gespräch beendet war. Sie öffnete die Wagentür, stieg aus und betrachtete nachdenklich ihr Haus. Es brauchte dringend einen neuen Anstrich. John hatte keine Zeit zum Rasenmähen gehabt, da er für die Tagschicht eingeteilt war. Das Gras war hoch, und die einst so hübsch bepflanzten Blumenbeete lagen brach. Wenn Carolyn alles zu viel wurde, ging sie in den Garten und begann wie wild Unkraut zu rupfen. Zumindest das war erledigt, dachte sie nun. Morgen würde sie in die Gärtnerei fahren und Blumen zum Einpflanzen kaufen, damit der Garten nicht ganz so trist aussähe, wenn die Maklerin Interessenten das Haus zeigte.
Als sie die Haustür aufschloss und eintrat, fiel ihr auf, dass sogar die Möbel abgenutzt aussahen und der Teppichboden an mehreren Stellen fadenscheinig war. Dafür war es eine gute Wohngegend, auch heute noch. Das Ventura College war nur wenige Blocks entfernt, ebenso die High School und verschiedene Kliniken. Die Straße war vielleicht nicht so üppig bepflanzt wie in den nobleren Vierteln, und die umliegenden Einkaufszentren und Gebäude waren renovierungsbedürftig, dennoch hatte sie mit ihren Kindern immer gern hier gewohnt.
Sie ging zu Rebeccas Zimmer, klopfte an und trat, da keine Antwort erfolgte, ein. Rebecca lackierte sich gerade die Nägel mit blauem Nagellack und bewegte rhythmisch den Kopf zur Musik aus ihrem iPod. Carolyn nahm ihr die Kopfhörer ab. »Hast du was gegessen, Süße?«
»Nö«, erwiderte Rebecca desinteressiert.
»Eigentlich wollte ich ein paar Steaks braten, aber ich bin zu erledigt. Ich hole uns etwas. Worauf hast du Lust?«
»Auf nichts.« Rebecca stand auf und warf sich auf ihr ungemachtes breites Bett. Der Fußboden war mit Kleidungsstücken, Zeitschriften, Schulbüchern, Tellern mit Essensresten und anderen undefinierbaren Dingen übersät. Carolyn ärgerte sich zwar über die Unordnung ihrer Tochter, betrachtete die Zimmer beider Kinder jedoch als deren Privatsphäre. Wenn Rebecca im Dreck leben wollte, so war das ihre Entscheidung. Sie musste lediglich ihre Tür geschlossen halten. Da das Haus nun zum Verkauf angeboten wurde, würde allerdings auch Rebecca Zugeständnisse machen müssen.
Rebecca zupfte an ihren Haaren herum. »Wenn ich nichts esse, sparst du Geld, dann müssen wir nicht in eine bescheuerte Wohnung umziehen. Meine Freundinnen wohnen alle in Häusern. Nur Sozialhilfeempfänger leben in Wohnungen. Muss ich mir in Zukunft mein Mittagessen mit Essensmarken kaufen?«
»Du übertreibst«, sagte Carolyn. »In einer Wohnung zu leben ist nichts, dessen man sich schämen müsste. Wir verkleinern uns räumlich ein wenig, das ist alles. Die wenigsten Menschen auf der Welt sind so privilegiert wie wir. Du solltest dankbar sein, dass du nicht auf der Straße in einem Pappverschlag leben und in den Mülltonnen nach Essen wühlen musst.«
Das Mädchen verdrehte die Augen. »Bitte, Mutter, wenn du mir jetzt wieder einen Vortrag hältst, wird mir schlecht. Du musst nichts weiter tun, als John zu sagen, er soll auf eine andere Hochschule gehen. Warum muss er ans MIT? Das kennt doch kein Schwein. Wahrscheinlich gehen da nur Streber hin. Warum geht er nicht auf das University College in Santa Barbara? Da werde ich mich nämlich einschreiben.«
»Du kannst dich bei der Kosmetikschule bewerben, wenn du deine Schularbeiten nicht ernster nimmst«, erwiderte Carolyn. »Und räum endlich diesen Schweinestall auf. Die Maklerin wird das Haus demnächst Interessenten zeigen.«
Rebecca kickte ihren Schulrucksack von der Bettkante auf den Boden. »Ich bin also zu blöd, was? Nur weil ich Physik langweilig finde, hältst du mich für einen Versager. Ich werde Modedesignerin oder eine berühmte Malerin wie Onkel Neil. Ich habe ihm einige meiner Zeichnungen gezeigt, und er fand sie super. Er meint, ich sei jetzt so weit, um mit Ölfarben anzufangen.«
Carolyn warf einen Blick auf die in der Ecke stehende Staffelei, die mit getragenen Kleidungsstücken behängt war. »Für mich sieht das nicht so aus, als würdest du dich eifrig deiner Kunst widmen.«
»Ich brauche Malzeug, okay?«, entgegnete sie patzig. »Ich habe dich nicht darum gebeten, weil ich weiß, wie teuer dieses Zeug ist. Neil meinte, er würde mir ein paar Sachen vorbeibringen, aber offenbar hat er es vergessen. Ich will nicht mehr zeichnen. Ich will malen.«
Carolyn erinnerte sich, wie ihre Mutter Neil herabgesetzt hatte, als er in Rebeccas Alter gewesen war. Ständig hatte sie ihm gepredigt, Kunst sei nur ein Hobby und er würde niemals in der Lage sein, eine Familie zu ernähren, wenn er nicht einen anständigen Beruf ergriffe. Ohne Unterstützung seiner Eltern hatte Neil dann an den besten Kunstakademien der Welt studiert. Er hatte sogar unvorstellbar kostbare Kunstschätze im Vatikan restauriert. »Schreib einfach auf, was du alles brauchst«, sagte Carolyn. »Ich werde mit Neil darüber sprechen. Falls er nichts vorrätig hat, werde ich nächste Woche beim Laden für Künstlerbedarf vorbeifahren und es dir besorgen.« Als Carolyn bemerkte, wie Rebecca Tränen in die Augen stiegen, beugte sie sich zu ihr hinunter und küsste sie auf die Stirn. »Ich hab dich lieb, mein Schatz. Und du sollst wissen, dass ich dich in allem, was du tun willst, unterstützen werde. Ich hätte das mit der Kosmetikschule nicht sagen sollen. Aber ich habe einen grauenhaften Arbeitstag hinter mir.« Sie legte den Finger unter Rebeccas Kinn. »Wollen wir uns vertragen und noch mal von vorn anfangen?«
»Na gut.« In Rebeccas Augen trat wieder ein mutwilliges Glitzern. »Muss ich heute Abend mein Zimmer aufräumen, Mom? Ich habe wirklich schlimme Bauchkrämpfe.«
Geht schon wieder los, dachte Carolyn. »Du hattest letzte Woche deine Bauchkrämpfe. Du wirst also nicht schon wieder deine Periode haben. Bitte, Rebecca, räum einfach dein Zimmer auf. Das ist alles, was ich von dir verlange.«
Im Hinausgehen hörte Carolyn, wie Rebecca ihr etwas hinterherrief und machte wieder kehrt. »Was hast du gesagt?«
»Hühnchen«, wiederholte Rebecca, die nun auf dem Boden inmitten ihres Durcheinanders saß.
Carolyn stemmte eine Hand in die Hüfte. »Meinst du etwa mich?«
»Hühnchen aus dem El Polo Loco«, erklärte sie, während sie ihre Kleider in den offenen Schrank warf. »Wenn du uns von dort was holst, werde ich mitessen. Aber nur weißes Fleisch. Das hat weniger Fett.«
»Statt deine Klamotten im Schrank zu verstecken, solltest du sie lieber in die Waschmaschine geben.«
»Die Leute werden sicher nicht in meinen Schrank schauen, Mom, also reg dich ab.« Als ihre Mutter keine Antwort gab, drehte sich Rebecca entsetzt zu ihr herum. »Oh nein, sag bloß, sie werden auch an meinen Schrank gehen! Du lässt Fremde in meiner Unterwäsche herumschnüffeln! Ich werde zu Hillary ziehen. Ihre Mutter hat nichts dagegen. Hillarys Zimmer ist fast so groß wie unser ganzes Haus. Sie hat sogar ein eigenes Badezimmer.«
Um Fassung ringend, schloss Carolyn einen Moment die Augen. Sie wusste nicht, was schwieriger war – mit Kriminellen fertig zu werden oder mit einer Fünfzehnjährigen.
Sie musterte ihre Tochter, die ihrem Vater so ungemein ähnlich sah. Frank war Italiener, und Rebecca hatte offensichtlich nicht nur sein Aussehen, sondern auch sein Temperament geerbt. Carolyn vermutete, dass es zwischen den beiden aus diesem Grund auch ständig gekracht hatte. Rebecca hatte langes, fast schwarzes Haar, das sie offen über die Schultern trug. Auch Augen und Mund hatte sie von Frank geerbt. Sie war ein schönes Mädchen mit großen braunen, von dichten Wimpern gesäumten Augen, perfekten Zähnen und einem einnehmenden Lächeln. »Ich bin froh, dass du dich für Kunst interessierst, Schatz. Ich glaube nur, es wäre ratsam, wenn du eine gute Ausbildung erhältst, damit du irgendeine Sicherheit hast.«
»Wie beispielsweise was?«
»Du könntest Jura studieren. Oder du könntest Journalistin werden. Du kannst wunderbar schreiben.«
»Ich bin erst fünfzehn, Mutter«, erwiderte sie. »Darf ich nicht einfach noch ein Kind sein und mir später über diesen ganzen Kram Gedanken machen?«
»Natürlich, Liebling. Aber du könntest ja schon einmal darüber nachdenken. Nur für den Fall, dass es mit Modedesign oder irgendeinem anderen künstlerischen Beruf nicht klappt.«
»Okay«, sagte Rebecca. »Ich werde darüber nachdenken.«
Carolyn wusste, dass sie sich soeben wie ihre Mutter angehört hatte, aber sie konnte nicht anders. »Wo ist John?«
»Wo soll er schon sein? In seinem Zimmer.«
Carolyn ging hinaus, schloss die Tür hinter sich und eilte zu der umgebauten Garage im rückwärtigen Teil des Hauses. Sie klopfte an und rief: »Kann ich reinkommen?«
»Klar.«
Ihr Sohn saß an seinem Schreibtisch und schrieb etwas. »Was machst du da?«
»Papierkram«, antwortete er. »Ich habe heute mit Grandma gesprochen, und sie hat mir von einem Stipendium erzählt, für das ich mich bewerben könnte. Fünfzigtausend. Und im Internet habe ich noch mindestens dreißig andere Stipendien gefunden. Ich werde mich für alle bewerben.«
Carolyns Mutter war eine pensionierte Chemieprofessorin. Sie lebte in einem luxuriösen Seniorenwohnheim in Camarillo, einer Stadt, die mit dem Wagen fünfzehn Minuten von Ventura entfernt war. Carolyn trat ein und strich ihrem Sohn über die Wange. »Habe ich dir schon einmal gesagt, dass du der perfekte Sohn bist?«
»Hast du«, erwiderte John lächelnd, wurde aber sofort wieder ernst. »Wenn ich nur zwei, drei der größeren Stipendien bekommen würde, müsstest du das Haus nicht verkaufen.«
»Wir brauchen das Haus nicht«, entgegnete Carolyn. »Rebecca und ich kommen auch mit weniger Platz aus. Die Wohnanlage, die ich im Auge habe, ist wirklich sehr nett. Viele Bäume, kleine Bäche und gleich drei Swimmingpools. Hier am Haus fallen mehrere größere Reparaturen an. Angesichts der Steuern und der Versicherung ist es einfach sinnvoll, es jetzt zu verkaufen, solange es noch einen guten Preis erzielt. Kümmere dich nicht um deine Schwester. Wenn wir erst einmal umgezogen sind, wird sie eine Menge neuer Freunde kennen lernen, und alles wird wunderbar werden.« Sie atmete tief durch. »Ich hole uns jetzt was zu essen. Worauf hast du Appetit?«
»Egal. Such mir irgendwas aus.«
»Nach dem Essen kann ich dir ja bei deinen Anträgen ein wenig helfen«, sagte sie.
Carolyn bestellte im El Polo Loco das Essen und setzte sich zum Warten an einen Tisch. Ein Mann und eine Frau gingen zur Theke. Zunächst beachtete Carolyn die beiden kaum; ihr fiel nur auf, dass die Frau ziemlich dick und wie ein Strichmädchen gekleidet war. Der Mann hatte an Schultern und Oberarmen jene Art von Tätowierungen, die man sich im Gefängnis machen ließ. Laut vor sich hinfluchend, stapfte die Frau nun zum Getränkeautomaten, schob einen Pappbecher unter den Verteilerhahn und füllte ihn. »Glaub ja nicht, du Schlampe, dass du von mir Kohle kriegst«, kreischte sie die junge Latina hinter der Theke an.
»Richtig«, sagte der Mann, während er seinen Becher ebenfalls füllte. »Scheiß auf euch, ihr stinkendes Pack.«
Überzeugt, dass die beiden einen Überfall machen würden, griff Carolyn nach der Waffe in ihrer Handtasche. Die anderen Gäste saßen wie erstarrt auf ihren Plätzen. Doch das Pärchen verließ das Restaurant und stieg in einen neuen grünen Sebring. Carolyn merkte sich das Kennzeichen und stand auf, um die Verfolgung der beiden aufzunehmen. Gleich darauf sank sie wieder auf ihren Stuhl zurück. Es lohnte sich nicht, für den Preis zweier Erfrischungsgetränke sein Leben zu riskieren. Angesichts des Wagens, den die beiden fuhren, war Geldmangel wohl nicht das Motiv gewesen. Wahrscheinlich machte es sie an, wenn sie Leute wie diese junge Latina in Angst und Schrecken versetzten. Im Gegensatz zu der jungen Frau, die einer anständigen Arbeit nachging, finanzierten diese Freaks ihren Lebensunterhalt vermutlich durch kriminelle Handlungen oder dunkle Geschäfte.
Als Carolyn ihr Essen abholte, gab sie der Bedienung ein paar Scheine extra. »Damit Ihre Kasse heute Abend nicht völlig leer ist.« Sie beugte sich über die Theke und fügte leise hinzu: »Wenn diese beiden wiederkommen, rufen Sie sofort die Polizei. Versuchen Sie nicht, mit ihnen zu reden. Das sind gefährliche Leute, verstanden?«
Das Mädchen nickte; in ihren Augen glitzerten Tränen. »Danke«, sagte sie mit spanischem Akzent und legte das Geld in die Kasse. »Ich habe erst letzte Woche hier angefangen.«
Als sie gegessen hatten, half Carolyn John bei seinen Stipendienanträgen. Danach nahm sie sich einige der Akten vor, die sie mit nach Hause genommen hatte, war aber zu erschöpft, um sich zu konzentrieren. Also ging sie zu Bett und versuchte einzuschlafen. Da sie bald merkte, dass an Schlaf nicht zu denken war, stand sie wieder auf und zog ihren Morgenmantel über. Sie starrte durch das Wohnzimmerfenster auf die leeren Blumenbeete, die wie frisch geebnete Parzellen auf einem Friedhof wirkten.
Als Kind hatte Carolyn einen immer wiederkehrenden Albtraum gehabt. Sie spielte mit Neil im Garten Ball, und der Ball landete im Blumenbeet. Dort waren keine Blumen, nur Erde, und als sie den Ball aufheben wollte, griff eine Hand nach ihr und zog sie unter die Erde. Sie war überzeugt, dies sei der Teufel, und aus Angst, der Traum würde wiederkommen, weigerte sie sich abends, ins Bett zu gehen. Nachdem der Albtraum auch nach Monaten nicht verschwunden war, schleppte ihre Mutter sie zu einem Kinderpsychiater, einem streng dreinblickenden, dicken Mann, der ihr dumme Fragen stellte und sie die restliche Zeit über schweigend anstarrte. Wenn jemand der Teufel war, dachte sie, dann dieser Typ, und sie fürchtete sich fortan noch mehr als zuvor. Eines Nachts träumte sie, sie tauche im Nachbargarten neben einem Baumstumpf wieder aus der Erde empor. Danach war der Traum nie wiedergekommen.
Doch jetzt hatte es den Anschein, als sei der Teufel erneut aus seinem dunklen Versteck hervorgekrochen. Während Carolyn auf die vernachlässigten Blumenbeete blickte, erwartete sie beinahe, dass gleich eine Hand hervorkommen und sie, wie in dem Traum, unter die Erde ziehen würde. Es musste für den Teufel ein Triumph sein, dass Carl Holden aus dem Gefängnis entlassen worden war und Lester McAllen für den brutalen Mord an einem Kind womöglich ungeschoren davonkommen würde.
Carolyn wandte sich vom Fenster ab und packte, ohne nachzudenken, den dicken Strauß künstlicher Blumen, ein Geschenk ihrer Mutter, der in der Vase auf dem Esszimmertisch stand. Anschließend holte sie aus dem Geräteschuppen eine Handschaufel und stapfte entschlossen in den Vorgarten.
John, dessen Fenster nach vorn hinausging, entdeckte seine Mutter im Garten und ging zu ihr. »Was tust du da, Mom?«, fragte er. »Es ist fast Mitternacht.«
»Ich pflanze«, antwortete Carolyn. Sie grub ein Loch, setzte eine künstliche Blume ein und klopfte sie mit Erde fest. »Es ist kein Unkraut mehr da, das ich rupfen könnte.«
John streckte sich und gähnte. Dann nahm er eine der Blumen, roch daran und merkte erst jetzt, dass die Blumen nicht echt waren. »Soll das ein Witz sein?«
Carolyn setzte sich auf den Fersen zurück. »Ich habe Angst, dass etwas passiert und ich es morgen nicht in die Gärtnerei schaffe. Aber ich will, dass das Haus schön aussieht.«
»Ich habe noch nie gehört, dass jemand künstliche Blumen einpflanzt«, bemerkte John lachend. »Wow, auf der hier sind sogar künstliche Tautropfen.« Als er sah, dass seine Mutter weinte, kauerte er sich neben sie. »Ist schon in Ordnung, Mom«, sagte er und strich ihr die kurzen Locken aus der Stirn. »Jeder hat mal einen schlechten Tag. Morgen wird alles anders aussehen. Außerdem finde ich deine Idee richtig cool. So brauchen wir uns wenigstens keine Gedanken mehr um das Gießen zu machen.«
Carolyn lächelte, wischte sich die Tränen ab und ließ auf ihrer Wange einen Schmutzstreifen zurück. »Ist meine Frisur sehr schlimm?«, fragte sie und zupfte an den kurzen Locken. »Sei ehrlich. Sie ist schrecklich, nicht wahr?«
»Du siehst toll aus«, beruhigte er sie. »Wenn du blond wärst, könnte man dich glatt mit Meg Ryan verwechseln. Ich wette, sie pflanzt in ihrem Garten auch künstliche Blumen ein.« Er half seiner Mutter hoch und legte ihr den Arm um die Schultern. »Außerdem werden deine Haare, im Gegensatz zu diesen Blumen, wieder wachsen. Lass uns jetzt reingehen und heiße Schokolade trinken. Danach können wir die restlichen Blumen einpflanzen. Na, ist das ein Angebot?«
»Wer könnte da widerstehen?«, sagte sie und folgte ihm ins Haus.