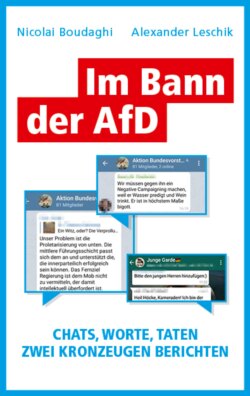Читать книгу Im Bann der AfD - Nicolai Boudaghi - Страница 7
Kapitel 1 SOZIALER AUFSTIEG
ОглавлениеDer Weg in die AfD I: Von der Straße in die Professorenpartei
Nicolai Boudaghi
Am 12. April 2013 saß ich in einem Zelt in Rommerskirchen-Anstel, einem Dorf im Rheinland zwischen Düsseldorf und Köln. Neben mir hatte ein älterer Unternehmer im dunklen Anzug Platz genommen, der an diesem Sonntag noch zum stellvertretenden Landesvorsitzenden gewählt werden sollte. Die Alternative für Deutschland hielt ihren ersten Landesparteitag im größten deutschen Bundesland ab. Professoren waren gekommen, Firmeninhaber, sicher auch viele Beamte. Die meisten waren Männer und Schlipsträger. Etwas Neues entstand, es herrschte Aufbruchsstimmung. Von 400 Teilnehmern hatte man vorher geschrieben, aber hier versammelten sich weitaus mehr Menschen. Und mittendrin ich. Drei Jahre zuvor hatte ich eine Zeit lang auf der Straße gelebt.
Mein Vater ist Iraner. Seine Familie stand an der Seite des Schah-Regimes, und als islamische Revolutionäre das Land 1979 übernahmen, floh mein Vater nach Deutschland. Meine Mutter kam als Kind aus Niederschlesien zuerst nach Hamburg, später nach Mettmann bei Düsseldorf. Bald nach meiner Geburt trennten sich meine Eltern.
Ich blieb bei meiner Mutter in Mettmann, die als alleinerziehende Sozialarbeiterin nicht gerade privilegiert war. Mein Vater weigerte sich standhaft, Unterhalt zu zahlen. Weil ich außerdem immer unter dem Eindruck stand, dass mein Vater mich gegen meinen Willen in den Iran entführen könnte, habe ich meine Kindheit als schwierig in Erinnerung. Mein Vater gründete schnell eine neue Familie. Heute habe ich sechs Halbschwestern und zu den meisten von ihnen ein gutes Verhältnis.
In meiner Jugend nahmen unsere finanziellen Probleme zu. Wir hatten Schulden. Meine Mutter konnte das nicht vor mir verbergen. Es ist mir unangenehm, ins Detail zu gehen, aber unsere Armut war im Alltag nahezu dauerhaft präsent. In die Schule schaffte ich es nicht immer. Irgendwann ging ich dann gar nicht mehr zum Unterricht. Meine Mutter konnte mir auch nicht helfen.
Im Januar 2010 fand ich mich nachts um drei Uhr am Essener Hauptbahnhof wieder. Ich hielt es zu Hause nicht mehr aus. Das Thermometer zeigte minus zehn Grad, und mir war klar, dass ich jetzt ganz unten angekommen war. Dass sich daran etwas ändern könnte, glaubte ich nicht. Mir fehlte jede Zuversicht.
Die Nächte der nächsten Monate verbrachte ich in einer Notunterkunft für Jugendliche. An solchen Orten sammeln sich Menschen mit unterschiedlichen Schicksalen. Ich lernte einen heroinabhängigen 14-Jährigen kennen und einen Jugendlichen, der abgehauen war, weil seine Eltern ihm nicht glaubten, dass sein Onkel ihn missbrauchte.
Die Unterkunft öffnete am Abend und schloss morgens um neun Uhr. Bis dahin hatten wir Essen, Wärme und auch etwas Schlaf bekommen – und mussten nun die Zeit bis zum Abend überbrücken. Einige zogen dann in Grüppchen los, ich hielt mich jedoch tagsüber meistens fern von den anderen Jugendlichen. Gemeinschaft und Zusammenhalt waren zwar auch für mich wichtig unter diesen Umständen, aber ich befürchtete auch, dass mich solche Gruppen noch weiter in den Abgrund ziehen könnten. Ich wollte mir die Probleme der anderen nicht zu eigen machen, oder besser: ihre Mittel, um durch den Tag zu kommen, denn die meisten schafften das nur mithilfe von Alkohol und Drogen. Zum Glück ist mir das recht gut gelungen. Ich nahm nichts Hartes und trinke bis heute wenig.
Es dauerte fast drei Monate, bis ich in eine Sozialwohnung im Essener Norden ziehen konnte. Hier wohnte ich wieder mit meiner Mutter zusammen. Wir bezogen Sozialleistungen, und ich spürte, dass es endlich aufwärtsgehen könnte. Das Leben auf der Straße hatte ich jedenfalls hinter mir gelassen. Vergessen werde ich diese Erfahrung nicht.
An der Volkshochschule Bochum holte ich zuerst meinen Haupt- und danach auch meinen Realschulabschluss nach. Das kostete mich nicht allzu viel Energie, der Unterricht selbst hatte mich ja nie überfordert. Ich hatte nur nicht die Struktur zur Verfügung gehabt, die es braucht für einen regelmäßigen und erfolgreichen Schulbesuch. Nach dem Realschulabschluss nahm ich am Berufskolleg Castrop-Rauxel mein Abitur in Angriff.
Politik und Gesellschaft interessierten mich schon damals. Ich setzte mich mit dem Islam auseinander, der Religion meines Vaters und vieler Menschen im Essener Norden. Ich schaute WDR-Dokumentationen über die islamische Religionsgemeinschaft DITIB an und über die Islamisten-Bewegung Milli Görüş. Ich entdeckte den radikalen Prediger Pierre Vogel und verfolgte, wie er geschickt Anhänger rekrutierte. Meine Ablehnung verfestigte sich und nahm später noch zu, als die Terroristen des Islamischen Staates in Syrien auch radikalisierte Muslime aus Deutschland einsetzten.
2011 stand ich mit Nazanin Borumand vom Zentralrat der ExMuslime in Kontakt. Ich fuhr nach Hamburg und demonstrierte mit ihr und einer kleinen Gruppe von 150 Leuten gegen Tausende Salafisten. Die Demo war von einer Kleinpartei organisiert, die es damals noch nicht lange gab. Sie hieß »Die Freiheit«. Ich weiß noch, wie uns die Antifa damals überschrie. Die Salafisten müssen sich totgelacht haben, auch weil Nazanin Borumand politisch sehr weit links stand.
Im Spätsommer 2011 trat ich der Partei »Die Freiheit« bei. Sie galt als islamkritisch, für mich passte das genau. »Die Freiheit« wollte sich zwar dem radikalen Islam entgegenstellen, vertrat ansonsten aber westlich-liberale Werte. Sie hatte nichts gegen Frauenrechte und war nicht gegen Schwule und Lesben. Und sie erschien mir auch nicht völkisch-national. Erst später wurde sie in Bayern vom Verfassungsschutz beobachtet.
Ich wollte eine Jugendorganisation aufbauen, die »Generation Freiheit«, und konferierte mit ein paar anderen jungen Parteimitgliedern über Facebook und Skype. Wer loslegen wollte, konnte einfach loslegen, das gefiel mir.
In meinem neuen Milieu traf ich aber auch auf radikale Typen. Einmal ging ich bei einem »Marsch der Patrioten« mit, den die »German Defence League« organisiert hatte, eine Organisation, die später vom Verfassungsschutz beobachtet wurde. Dort schimpfte man auch über die Antifa, und ich schimpfte eifrig mit.
»Die Freiheit« verstrickte sich allerdings bald in Richtungs- und Machtkämpfe. Der Bundesverband blockierte dann sogar die Gründung eines Landesverbandes in Nordrhein-Westfalen. Schon in den E-Mails, die ich damals erhielt, klang die Zerstrittenheit an. Einmal lud man zu einem »Treffen des westlichen Ruhrgebiets« nach Mülheim an der Ruhr ein. In der Tagesordnung ging es um die »Klärung der Zuständigkeit der offiziellen Koordinatoren«, um »Ausgrenzung von Mitgliedern« und um »Kommunikationsbarrieren, von Koordinatoren verursacht«. Entsprechend konfliktfreudig verlief der Abend.
Mir gelang es erst einmal, derlei Grabenkämpfe auszublenden. Ich suchte Zugehörigkeit und thematische Übereinstimmung, beides bot mir diese Partei. Einmal hielt ich sogar eine Rede auf einer Kundgebung, bei der auch Mitglieder von »Pro NRW« auftraten. Diese Kleinpartei war bereits zur Heimat von Rechtsextremisten geworden.
Mit der »Freiheit« geschah dann letztlich dasselbe. Ich war 20 Jahre alt und in gewisser Weise sicher auch naiv. Aber irgendwann verstand ich, dass mit dieser Partei nichts zu gewinnen war und dass man sich von einigen Mitgliedern besser fernhielt. Leute wie der Bundesvorsitzende Michael Stürzenberger mischten meiner Meinung nach berechtigte politische Anliegen mit rechtsextremen Forderungen, die nicht zu akzeptieren waren. Anfang 2013 trat ich aus der »Freiheit« aus.