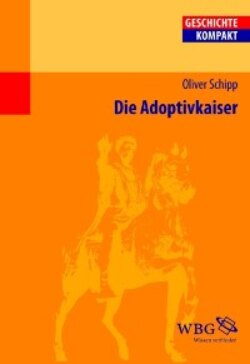Читать книгу Die Adoptivkaiser - Oliver Schipp - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. Materielle Zeugnisse und Befunde
ОглавлениеInschriften
Den literarischen Quellen verwandt sind die Inschriften. Die aufwendigen Inschriften und teuren Inschriften waren in erster Linie an die Zeitgenossen gerichtet und geben daher unmittelbare Auskunft über den behandelten Gegenstand. Unter den Inschriften sind einige wegen ihres spezifischen Informationsgehalts zu bestimmten Themen hervorhebenswert. So sind die Aufzeichnung über das öffentliche Unterstützungsprogramm für Kinder (alimenta) zweier Landstädte unter Trajan inschriftlich erhalten, die zum einen Rückschlüsse auf die kaiserliche Sozialpolitik erlauben und zum anderen Aussagen zur römischen Landwirtschaft zulassen (siehe Kap. III 2). Ebenfalls erhalten ist eine Ansprache Hadrians an die Truppen in Lambaesis nach einem Manöverbesuch 128 n. Chr. (siehe Kap. III 3). Äußerst aufschlußreich sind ferner die Landwirtschaftsinschriften aus Nordafrika, aus denen die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Pachtbauern und mithin deren rechtliche und soziale Stellung hervorgehen (siehe Kap. VI 2 u. VII 1). Und schließlich haben wir für die Adoptivkaiserzeit noch die Bergwerksordnung von Vipasca, die über die Organisation eines Bergwerksbetriebs detaillierte Information gibt (siehe Kap. VII 1).
Neben diesen wenigen epigraphisch festgehaltenen Kaiseransprachen, Gesetzestexten und Bekanntmachungen mit umfangreichen Formularen sind zahlreiche Ehren- und Bauinschriften erhalten, die vom Kaiser oder zu Gunsten des Kaisers in Auftrag gegeben worden sind. Sie geben Aufschluss über kaiserliche und private Bauprogramme und sind Zeugnisse für die Herrschaftsideologie der Zeit. Aufgrund der Anzahl der Konsulate sowie der Iteration der tribunizischen Amtsgewalt, die an der inschriftlichen Titulatur abzulesen sind, können diese Zeugnisse zur Datierung und Ergänzung der literarischen Quellen herangezogen werden. Siegerbeinamen wie Germanicus, Parthicus oder Dacicus weisen auf die militärischen Erfolge des Kaisers hin. Alle diese Angaben können genutzt werden, um historische Ereignisse zeitlich einzuordnen.
Neben den offiziellen haben unzählige private Inschriften aus dem 2. Jh. die Zeit überdauert. Diese finden sich auf so unterschiedlichen Schriftträgern wie Stein, Holz, Wachs oder Blei; sie sind gemeißelt, graviert oder geritzt und werfen Licht auf die unterschiedlichsten Lebensbereiche: Weiheinschriften geben Auskunft über den Glauben und die Hoffnungen der Menschen; Bauinschriften künden von privaten Baustiftungen; Grabinschriften informieren über den beruflichen und politischen Werdegang. Vielfach stereotype Wendungen können kaum einzeln, aber umso besser summarisch ausgewertet werden. So erlauben die Untersuchungen von Laufbahninschriften die Karrieren von Senatoren und Rittern wie von einfachen Soldaten zu verfolgen. Sie werden mithilfe der prosopographischen Methode untersucht.
E
Prosopographische Methode/Prosopographie
Prosopographie ist, vereinfacht gesagt, eine althistorische Methode zur Erforschung von kollektiven Lebensläufen. Es werden alle verfügbaren und miteinander vergleichbaren Daten bezüglich einer Personengruppe zusammengestellt. Mit quantifizierenden Methoden werden diese aus den unterschiedlichen Quellen gewonnenen Informationen ausgewertet. Neben Bevölkerungsgruppen, wie etwa ,die Senatoren‘ oder ,die Freigelassenen‘, können auch beruflich definierte Gruppen, bspw. ,die Soldaten‘ oder ,die Verwalter einer bestimmten Provinz‘, untersucht werden.
Münzen
Bei der Erforschung römischer Münzen können ähnliche Informationen gewonnen werden wie bei der Untersuchung der offiziellen Ehreninschriften. Die Namen, Titel, Siegesbeinamen und Akklamationen der Kaiser werden in den Umschriften (Legenden) akribisch verzeichnet. Auf der Vorderseite (Avers) zeigen die Kaiser ihr idealisiertes Antlitz. Ikonographische Untersuchungen des Kaiserportraits geben Aufschluss darüber, wie der Kaiser gesehen werden wollte. Das Münzportrait war somit Teil der kaiserlichen Selbstdarstellung. Hadrian etwa war der erste Kaiser, der sich mit Vollbart abbilden ließ, was wahrscheinlich Ausdruck seiner Verehrung der griechischen Kultur war. Commodus hingegen ließ sich als Herkules mit Löwenfell darstellen. In diesen Beispielen mögen sich persönliche Vorlieben einzelner Herrscher zeigen, aber zumeist wurden die Münzen gezielt zur Propagierung der eigenen Herrschaft eingesetzt. So wurde zur Legitimation eines designierten Nachfolgers dieser dem Volk im Doppelportrait mit dem derzeitigen Kaisers vorgestellt, auf diese Weise wurde zugleich die eigene Position gestärkt. Ferner konnten die Bilder der Kaiserinnen als Symbole von Herrschaftskontinuität fungieren. Auf der Rückseite (Revers) einer Münze konnten die Kaiser ihr Herrschaftsprogramm, Bauwerke, persönliche Schutzgottheiten, soziale Maßnahmen, Siege usw. darstellen. So wies Hadrian etwa auf seinen Besuch einer Provinz hin. Die Rückseite einer anderen Münze ist den vergöttlichten Eltern Trajan und Plotina gewidmet (divis parentibus). Faustina die Jüngere hingegen wurde mit sechs ihrer Kinder abgebildet und kündete von glücklichen Zeiten (temporum felicitas).
Papyri
Im Gegensatz zu den Inschriften und Münzen bewahren die Papyri unter anderem Aufzeichnungen, die nicht für die Nachwelt bestimmt waren. Dies macht den besonderen Quellenwert dieser Gattung aus. Der feuchtigkeitsempfindliche Beschreibstoff, der aus den Blättern der Papyrusstaude hergestellt wurde, konnte nur im trockenen Klima Ägyptens, Palästinas und Syriens überdauern. Auf den Papyri sind Steuerbescheide, Katasterurkunden, Rechtsgeschäfte, buchhalterische Notizen, Berechnungen von Zöllen (siehe Kap. VII 3), aber auch Soldlisten und Anwesenheitslisten beim Appell erhalten geblieben. Schließlich wurden auch einige literarische Werke auf Papyrus überliefert. Die meisten Papyri geben aber Zeugnis von alltäglichen Geschäften. Inwiefern deren Angaben auf das ganze Imperium Romanum übertragen werden dürfen, ist im Einzelfall zu prüfen. Oft zeigen die Aufzeichnungen aber nur die ägyptischen Verhältnisse.
Archäologie
Die Archäologie schließlich gibt wichtige Aufschlüsse über die architektonischen Überreste, die Artefakten sowie sonstige Überbleibsel aus dem 2. Jh. In den Provinzen erforscht die Archäologie die zunehmende Romanisierung bzw. Romanisation der Landstädte, den Ausbau der Grenzanlagen sowie der Militärlager und die Verbreitung der Landgüter (villae rusticae). Zusammen mit den unzähligen Funden von Gebrauchskeramik und den Wrackfunden erlaubt besonders die Untersuchung der Landgüter Rückschlüsse auf die römische Wirtschaft. In Rom selbst fanden die kaiserlichen Bauwerke die besondere Aufmerksamkeit der archäologischen Forschung. Kaiserforen, Tempel, Thermen usw. sind vielfach Zeugnisse der kaiserlichen Repräsentation und Inszenierung, an der die propagierten politischen Ziele ablesbar sind. Alle Kaiser betonten stets ihre Sieghaftigkeit. Die Adoptivkaiser waren zudem darauf bedacht, die Legitimation ihrer Herrschaft ins Bild zu rücken. Der Bezug zum jeweiligen Vorgänger wurde künstlerisch und architektonisch ausgedrückt, wobei auch die Kaiserinnen miteinbezogen wurden. Ein spezieller Forschungsgegenstand der Archäologie sind die Staatsdenkmäler. Die Reliefs auf Ehren- bzw. Triumphbögen und auf Ehrensäulen sowie die skulpturale und ornamentale Ausstattung von Sakralgebäuden setzen die Intention des Auftraggebers für jeden ersichtlich ins Bild. Die neue Ideologie des Adoptivkaisertums und die Abkehr von der als Tyrannei empfundenen Herrschaft des Domitian bestimmten die architektonischen Bauprogramme und die Bildersprache des 2. Jahrhunderts.
In einigen Fällen decken sich die Aussagen verschiedener Quellengattungen, sodass das geschilderte Ereignis eine größere Zuverlässigkeit erhält. Zum Beispiel das Regenwunder im Quadenland, das literarisch gut belegt ist, das sich möglicherweise auf Münzen wieder findet und das zugleich auf der Marc-Aurel-Säule dargestellt wurde (siehe Kap. VIII 1).