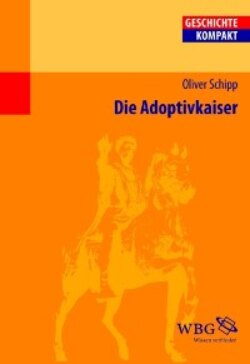Читать книгу Die Adoptivkaiser - Oliver Schipp - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Zeitzeugen und antike Kompilatoren
ОглавлениеTacitus
Der Senator und Historiker Publius Cornelius Tacitus (ca. 58 – 120) erlebte noch den Beginn der Adoptivkaiserzeit. Er starb in der Regierungszeit Hadrians. Leider sind nur wenige Notizen von ihm über die hier interessierende Epoche erhalten. Tacitus bedauerte, dass seine eigene Epoche, die Kaiserzeit, so ereignisarm gewesen sei, dass man sie kaum mit der Zeit der Republik vergleichen könne (Tacitus, Annalen 4,32). Zugleich stellte er erleichtert fest, dass es unter Nerva und Trajan erstmals zur Zeit des Prinzipats die Meinungsfreiheit gab, die seine Schriftstellerei erst ermöglichte (Tacitus, Historien 1,1,4).
Plinius der Jüngere
Detailliertere Informationen überlieferte Gaius Plinius Caecilius Secundus (61 / 62 – 112 / 13). Er wurde in Como geboren und als Halbwaise von seinem gleichnamigen Onkel, dem Naturforscher, adoptiert. Zur Unterscheidung von diesem wird er als Plinius der Jüngere bezeichnet. In Rom wurde er ausgebildet, wobei einer seiner Lehrer der berühmte Rhetor Quintilian war. Er schlug eine senatorische Laufbahn ein und wurde unter Trajan schließlich Statthalter der kaiserlichen Provinz Bithynia.
Aus dieser Zeit stammt auch die Korrespondenz mit Kaiser Trajan (121 Briefe), die er als zehntes Buch seiner Briefesammlung publizierte. Die ersten neun Bücher umfassen 248 Briefe, die Plinius an 105 verschiedene Adressaten gerichtet hatte. Die Briefsammlung des Plinius war zur Publikation bestimmt und entsprechend überarbeitet worden. Einige Themen, die Plinius erörtert, waren: persönliche Anliegen, Berichte, Politik, Bildungsfragen, Landschaftsschilderungen und Beschreibungen seiner Villen, das Tuscum im Apennin und das Laurentinum südlich von Ostia am Mittelmeer. Auf Anfrage des Tacitus beschrieb Plinius den Ausbruch des Vesuvs, bei dem sein Onkel ums Leben gekommen war. Plinius der Jüngere bietet detaillierte Einblicke in die Verhältnisse seiner Zeit, sowohl in den Alltag als auch in das politische Leben und in die zeitgenössische Gesellschaft. Berühmt geworden ist der Brief bezüglich der Behandlung von Christen, die den Kaiserkult verweigerten (Plinius der Jüngere, Briefe 10,97). Plinius reflektierte aber auch über die Möglichkeiten der Historiographie seiner Zeit.
Q
Plinius der Jüngere über die Geschichtsschreibung seiner Zeit
(Plinius d. J., Briefe 8,4,1 und 9,2,2)
Du [Caninius] tust sehr gut daran, dass Du den Krieg gegen die Daker zu beschreiben gedenkst. Denn wo findet sich ein so aktueller, so reicher, so ausgedehnter, schließlich ein so dichterischer und, obwohl es sich um eine reine Tatsache handelt, ein so wunderbarer Stoff?
Denn meine Lage ist nicht dieselbe wie die des Marcus Tullius [Cicero], auf dessen Beispiel Du mich hinweist. Er besaß nämlich eine riesige Begabung, und es bot sich ihm in reichem Maße eine seiner Begabung entsprechende Fülle von vielfältigen, bedeutenden Ereignissen.
Ähnlich wie Tacitus empfand Plinius seine Zeit als ereignisarm. Aber er erkannte zugleich, dass die Dakerkriege Trajans den klassischen Erzählstoff für Geschichtsschreibung boten. Außer den Briefen blieb von Plinius‘ Schriften eine Lobrede (Panegyricus) auf Kaiser Trajan erhalten, die er anlässlich seines Konsulats verfasst hatte. Hierin legte Plinius die ideologische Begründung des Adoptionsprinzips dar. Auch wenn man diese Schrift nicht unvoreingenommen betrachten sollte, vermittelt sie doch einen guten Eindruck von der öffentlichen Propagierung des Adoptionsprinzips (vgl. Kap. II 3).
Cassius Dio
Der wichtigste Historiograph der Adoptivkaiserzeit ist der aus Bithynien stammende Lucius Claudius Cassius Dio Cocceianus (ca. 155 – 235 n. Chr.). Er wurde in Nikaia geboren und kam schon früh nach Rom, wo er die senatorische Laufbahn einschlug. Unter Alexander Severus erreichte er schließlich im Jahre 229 n. Chr. seinen zweiten Konsulat und gab dem Jahr seinen Namen. Im gleichen Jahr endete auch sein Hauptwerk über die Römische Geschichte (Romaiké historía), das er in griechischer Sprache geschrieben hatte. In 80 Bänden strebte er eine ereignisgeschichtliche Darstellung an, die auf Fakten basiert (Cassius Dio, Römische Geschichte 35,46,1). Leider sind nur die Bücher 36 – 60 vollständig erhalten, in denen die Jahre 68 v. Chr. bis 47 n. Chr. behandelt werden. Die Lücken können zum Teil durch spätere Exzerpte des Xiphilinos aus dem 11. Jh. und des Zonaras aus dem 12. Jh. geschlossen werden.
Der besondere Wert dieses Werkes für die Betrachtung der Adoptivkaiserzeit liegt darin, dass es von einem Zeitzeugen geschrieben wurde, der in dieser Zeit seine politische Tätigkeit begann. Hiermit ist aber zugleich das Problem der Nähe des Autors zu seinem Gegenstand verbunden. Als Angehöriger der senatorischen Oberschicht hatte er sich wie die meisten seiner Standesgenossen mit der Monarchie abgefunden. Dies geht aus den eingeschobenen Reden hervor, in denen Cassius Dio selbst zu Wort kommt. Seine Beurteilung der Adoptivkaiser war geprägt von der Auffassung, dass die römische Geschichte in seiner Zeit einen Umbruch erfahre. Durch den Herrscherwechsel von Marc Aurel zu dessen Sohn Commodus sinke das römische Kaisertum herab. Der Prinzipat, einst von Augustus begründet, habe sich bis zu einem Goldenen Zeitalter unter Marc Aurel entwickelt. Danach sei die Römerherrschaft verfallen, weil Commodus sich nicht als Herrscher geeignet habe. Dieses negative Commodusbild war in der senatorischen Geschichtsschreibung verbreitet und durch den Umstand bedingt, dass Commodus eine Politik betrieb, die den Interessen des Senates zuwiderlief.
Q
Cassius Dio über seine Zeit
(Cassius Dio, Römische Geschichte 72,36,4)
Nur eines fehlt zu seinem [Marc Aurels] vollständigen Glück: Obwohl er seinen Sohn auf die bestmögliche Weise erzog und ausbildete, erlebte er mit ihm die allergrößte Enttäuschung. Davon müssen wir nun im Folgenden sprechen; unser Bericht aber sinkt, wie sich die Verhältnisse für die damaligen Römer und auch für uns gestalteten, von einem goldenen zu einem eisernen und rostigen Kaisertum herab.
In einigen der neuzeitlichen Darstellungen übernahm man die stringente und plausible Darstellung des Cassius Dio, vor allem aber folgte man seiner Epochenbewertung.
Herodian
Für die Zeit von 180 n. Chr. an tritt neben die Geschichtsdarstellung des Cas- Herodian sius Dio die ebenfalls griechisch geschriebene römische Geschichte Herodians (ca. 178 – 250). In acht Büchern behandelt dieser die Geschichte der Jahre von 180 bis 238, die vom Tode des Kaisers Marc Aurel bis zum Beginn der Herrschaft der Gordiane reicht. Herodian stammte vermutlich aus Syrien und war möglicherweise ein kaiserlicher Freigelassener (libertus), der in der Verwaltung in untergeordneter Stellung tätig war.
Der nicht immer zuverlässig berichtende Autor ist für die Ermittlung der Ereignisfolge und bei der Untersuchung einiger Details hilfreich. Sein Werk wird in der Forschung äußerst kritisch bewertet. Insbesondere seine Weitschweifigkeit steht in der Kritik. Es ist ferner nicht nachvollziehbar, auf welche Vorlagen er zurückgriff. Auch scheint er in einigen Passagen frei hinzugedichtet zu haben. Noch stärker als Cassius Dio bewunderte Herodian Marc Aurel. Die Charakterdarstellungen der anderen Kaiser traten vor dem Hintergrund dieses Idealkaisers besonders plastisch hervor. Da Herodian Reichsgeschichte als Abfolge der einzelnen Herrscher begriff, war für ihn abzusehen, dass das Imperium Romanum nach der Herrschaft Marc Aurels zwangsläufig seinem Niedergang entgegengehe. Herodian schreckte dabei nicht vor moralischen Bewertungen zurück. Dass er zur selben Einschätzung gelangte wie Cassius Dio, lag daran, dass er für die Zeit bis 229 dessen Werk heranzog. Für die Zeit danach steigt der Wert Herodians für die Forschung, da sein Werk für diese Epoche die einzige vollständige Geschichtsschreibung eines Zeitzeugen darstellt. Seine Angaben müssen aber aus den genannten Gründen stets kritisch geprüft werden.
Historia Augusta
Mit noch größerer Vorsicht ist die Historia Augusta heranzuziehen, eine Sammlung von Kaiserbiographien, die von einem oder von mehreren Autoren zur Zeit Diokletians und Konstantins geschrieben wurde. Die Historia Augusta umfasst die Biographien der Kaiser Hadrian bis Numerian, also die Zeit von 117 bis 285 n. Chr. Der oder die Autoren haben die Adoptivkaiserzeit nicht selbst erlebt. Die Autorenschaft und das Entstehungsdatum bzw. die Überarbeitungsstufen des Werkes sind in der Forschung höchst umstritten und können hier nicht diskutiert werden. Man muss sich bei der Zitation der literarisch ansprechenden Texte aber immer im Klaren darüber sein, dass wir nicht wissen, wer in welcher Absicht zu uns spricht. Das erklärte Vorbild der Historia Augusta sind die Kaiserbiographien des Sueton, an die sie anschließt. Sueton wird freilich nicht erreicht, zumal dessen Gliederung in Sachrubriken nicht übernommen wurde. Neben brauchbaren Fakten, die aus heute verlorenen Vorlagen geschöpft wurden, enthält die Historia Augusta fiktionale Einschübe. Die Absicht eine unterhaltsame Lektüre zu bieten ist wesentlich ausgeprägter als bei den bisher vorgestellten Autoren. Aber gerade die Biographien der Adoptivkaiser von Hadrian an sind in der Sammlung vollständig erhalten und bieten wichtige Ergänzungen zu anderen Quellen. Manche nebensächlich gegebene Angabe kann ebenfalls als glaubwürdig eingestuft werden, sodass eine eingeschränkte und kritische Nutzung der Historia Augusta als Quelle für die Adoptivkaiserzeit möglich ist.
Breviarien
Im 4. Jh. wurden vermehrt Geschichtsabrisse im kaiserlichen Auftrag geschrieben. Die erhaltenen Breviarien des Eutrop und des Aurelius Victor fassen möglicherweise ein nicht überliefertes Geschichtswerk zusammen, die nach ihrem Entdecker benannte Enmannsche Kaisergeschichte. Zumindest aber stehen diese beiden Autoren sowie der oder die Verfasser der Historia Augusta in derselben Tradition und haben die gleichen Vorlagen benutzt. Die Darstellung der Breviarien ist knapp gehalten, wobei sie zuverlässigere Fakten liefern als die Historia Augusta. Eutrops Breviarium ab urbe condita wurde im Auftrag des Kaisers Valens verfasst und in dessen Regierungszeit veröffentlicht. Die Blütezeit des Imperium Romanum war für Eutrop mit Augustus erreicht, womit er, anders als Tacitus, der Tradition der senatorischen Geschichtsschreibung folgt. Der Niedergang der Römerherrschaft begann für Eutrop mit den Soldatenkaisern (Eutrop 9,1), sodass die Adoptivkaiserzeit von ihm positiv bewertet wurde. Das Werk Eutrops wurde in der Spätantike viel gelesen und Hieronymus sowie Orosius griffen für ihre Darstellungen darauf zurück.
Aurelius Victor kommt zur gleichen Einschätzung der „Reichsgeschichte“ wie Eutrop (Aurelius Victor 24,8ff.). Das unter seinem Namen geführte Buch über die Kaiser (Caesares oder Liber de Caesaribus) umfasst ein Werk über den Ursprung des römischen Volkes, ein Buch über bedeutende Männer der Stadt Rom und als drittes Werk eine römische Kaisergeschichte von Augustus bis Constantius II., von denen nur Letzteres von ihm selber stammt. Das Gesamtwerk bietet einen biographisch-chronologischen Aufriss der römischen Geschichte bis ins 4. Jh. Aurelius Victor beurteilt hierbei Menschen nach ihrem Bildungsstand, hegt eine Abneigung gegen das Militär und ignoriert das Christentum. Außerdem streut er, wie Sallust, immer wieder moralische Urteile ein.
Des Weiteren sind für Detailfragen die Fachschriftsteller zu berücksichtigen, wie z.B. Quintilian für die Rhetorik, Frontin für die Wasserversorgung, Pausanias für Reisen und Kunst.
Rechtsquellen
Nicht zu vernachlässigen sind ferner die Rechtsquellen. Die Antwort- Rechtsquellen schreiben des Trajan auf die Anfragen des Plinius waren eine Form der kaiserlichen Reskripte, die Rechtscharakter hatten. Heranzuziehen sind ferner die Edikte und Dekrete der Adoptivkaiser und die Rechtssprüche führender Juristen, die ebenfalls Gesetzeskraft hatten und in den Digesten gesammelt wurden.
E
Digesten (Pandekten)
Die Digesten oder Pandekten sind eine Sammlung von Rechtssprüchen der römischen Rechtsgelehrten. Sie wurden 533 n. Chr. im Auftrag Justinians gesammelt und als geltendes Recht veröffentlicht. Diese Kompilation des Juristenrechts bildet zusammen mit der Kompilation der Kaisergesetze (Codex Justinianus), mit einem Anfängerlehrbuch (institutiones) und mit den neuesten Gesetzen Justinians (novellae leges) die Kodifikation des Römischen Rechts (Corpus iuris civilis).
Das Corpus kann für ökonomische, soziale und politische Fragen herangezogen werden. Dabei ist stets zu beachten, dass die Juristen Justinians Veränderungen der ursprünglichen Texte, die sogenannten Interpolationen, vorgenommen hatten.