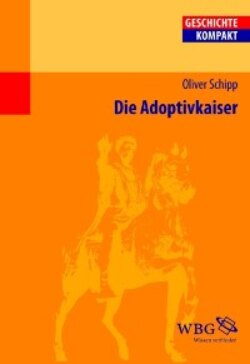Читать книгу Die Adoptivkaiser - Oliver Schipp - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Rekonstruktionen neuzeitlicher Geschichtsforschung
ОглавлениеEin knapp gehaltener Überblick über einige moderne Gesamtdarstellungen der Epoche soll dieses einleitende Kapitel abschließen.
Die Beurteilung der Zeit der Adoptivkaiser ist durchweg positiv. Diese Tradition hat Edward Gibbon begründet. Er bezeichnete die Kaiser Nerva, Trajan, Hadrian, Antoninus Pius und Marc Aurel als die fünf guten Kaiser (Five Good Emperors). Während einer glücklichen Periode von mehr als achtzig Jahren sei die öffentliche Gewalt durch die Tugenden und Talente eines Nerva, Trajan, Hadrian und der beiden Antonine geleitet worden. Er übernahm in seiner Darstellung die Sichtweise des Cassius Dio, indem er schilderte, dass mit Marc Aurel das goldene Zeitalter des Imperium Romanum zu Ende gegangen sei.
E
Edward Gibbon
Der britische Historiker Edward Gibbon (1737 – 1794) stammt aus einer wohlhabenden Londoner Familie. Nach einem unsteten Leben in verschiedenen Bildungsanstalten, auf Bildungsreisen sowie als Offizier und Parlamentarier konnte er nach dem Tod des Vaters das Leben eines Gentleman-Intellektuellen führen und seinen literarischen Ehrgeiz befriedigen. In seinem Hauptwerk The History of the Decline and Fall of the Roman Empire spannt er den Bogen von der Zeit der Adoptivkaiser bis zum Ende des Byzantinischen Reiches. Die Ursache für den Untergang des Römischen Reiches sieht er im aufkommenden Christentum. Durch die Jenseitsvorstellung der Christen hätten die Römer ihren Bürgersinn sowie die Kraft und den Mut verloren, das Imperium Romanum gegen äußere Feinde zu behaupten. Wenn diese These Gibbons auch als überholt gelten kann und der Untergang Roms wesentlich differenzierter gesehen werden muss, ist die Lektüre des Werkes schon wegen der literarischen Qualität sehr empfehlenswert.
Die Einschätzung, dass mit Marc Aurel das glückliche Zeitalter der römischen Geschichte endete, teilt auch Alfred Heuss, allerdings mit einer anderen Begründung. Er betitelt das entsprechende Kapitel seiner Römischen Geschichte mit „Das humanitäre Kaisertum“ und stellt die Regierung der Kaiser von Nerva bis Marc Aurel als glückliche Zeit der Regierungszeit des Commodus gegenüber. Das entscheidende Moment für die glückliche Regierung der fünf Kaiser sei der Ausgleich zwischen der senatorischen Opposition und der kaiserlichen Herrschaft gewesen. Die Hinwendung zum Griechentum habe dem Kaisertum etwas Aufgeklärtes und Humanitäres verliehen.
Die ausführlichste und präziseste deutschsprachige Darstellung der Adoptivkaiserzeit hat Karl Christ im Rahmen seines Werkes Geschichte der römischen Kaiserzeit vorgelegt. Eingeleitet mit einem Abschnitt über die Ideologie und Verfassungswirklichkeit des Adoptivkaisertums folgen Abschnitte zu den einzelnen Adoptivkaisern. Dabei wird nicht nur der ereignisgeschichtliche Verlauf geschildert, sondern auch auf soziale, kulturelle und ideologische Fragen eingegangen. Eine ausgewogene Charakterisierung der Adoptivkaiser und deren Regierungshandeln beschließt den jeweiligen Abschnitt. Karl Christ betont desgleichen die Zäsur nach der Regierung des Marc Aurel. Bei seiner Schilderung treten jedoch die persönlichen Schwächen und Stärken der Kaiser deutlicher hervor. Ihre Regierungstätigkeit wird vor diesem Hintergrund kritisch eingeschätzt. So macht er den zwiespältigen Erfolg der Eroberungen des Trajan und die Folgen des Politikwechsels durch Hadrian deutlich, der die inneren Kräfte des Imperiums zur Entfaltung brachte. Auf die lähmende Friedenszeit unter Antoninus Pius folgte die äußere Bewährung unter Marc Aurel. Diesem schreibt Christ die Schuld an der inneren Krise des Reiches zu, weil er seinen ungeeigneten Sohn als Nachfolger bestimmt hatte. Durch diese Tat habe Marc Aurel das Chaos mit verursacht, das durch die Regierung des Commodus ausgelöst wurde.
Stärker gegliedert als bei den anderen Autoren wird die Zeit der Adoptivkaiser von Colin Wells. Er unterscheidet Die Kaiser, die anderswo als in Rom gemacht wurden, die Zeit Von Hadrian bis Mark Aurel und die Zeit Von Commodus bis Maximinus Thrax – ein Zeitalter des Übergangs. Mit dem letzten Zusatz wendet er sich gegen die ältere Auffassung, die bspw. von Gibbon vertreten wurde, dass mit Commodus der Niedergang des Römischen Reiches einsetzte. Zu Recht zeichnet er das Bild eines Übergangs zur Spätantike, das nicht einen Niedergang, sondern eine Veränderung zeigt. Wells bezieht mehr als alle anderen die archäologischen Befunde mit in die Darstellung ein.
Ausführlich wird die Geschichte der Adoptivkaiser im 11. Band des Handbuches Cambridge Ancient History in zwei Kapiteln dargestellt. Dabei behandelt Miriam Griffin die Kaiser Nerva und Trajan, Anthony Birley hingegen die Kaiser von Hadrian bis Commodus. Birley ist ein ausgewiesener Kenner der Adoptivkaiserzeit. Von ihm stammen zwei grundlegende Biographien zu Hadrian und Marc Aurel. Entsprechend detailliert ist seine Darstellung. Da die Strukturgeschichte der Kaiserzeit in weiteren Kapiteln von verschiedenen Autoren behandelt wird, sind die Ausführungen von Griffin und Birley auf die politische Ereignisgeschichte konzentriert. Dem Leser wird eine solide quellennahe Geschichte des 2. Jahrhunderts geboten.
Einen gediegenen Überblick über die Ereignisgeschichte von der Ermordung Domitians bis zum „unwürdigen letzten Spross der Antonine“ bietet Heinz Bellen in seinen Grundzügen der römischen Geschichte. Dabei kommen auch die Reformen von Trajan und Hadrian nicht zu kurz.
Sei es Humanität und Bildung, seien es Tugenden und Talente der Kaiser, oder sei es der Höhepunkt und die Blüte des Kaisertums aufgrund der Friedenszeit; den Überblicksdarstellungen liegt – trotz gelegentlich aufkeimender Skepsis – ein positives Werturteil des Adoptivkaisertums zugrunde. Lediglich die Regierung des Commodus wird oft kritisch gesehen. Aufgrund jüngerer Forschungsarbeiten hat dieses konventionelle Bild von den Adoptivkaisern eine Neubewertung erfahren. Die imperiale Außenpolitik Trajans, die Frage, ob Hadrian Trajans Wunschkandidat war, und besonders die Bedeutung der Regierung des Commodus werden kontrovers diskutiert. Von der deutschsprachigen Forschung sind unter anderem die Untersuchungen zu Trajan von Martin Fell, zu Hadrian von Sabine Mortensen und zu Commodus von Falko von Saldern zu nennen. Auf dieser Grundlage kann man zu einer in Nuancen revidierten Einschätzung der Adoptivkaiserzeit gelangen. In einer Gesamtdarstellung wirkt sich dies bei Michael Sommer aus, welcher die Regierung des Commodus deutlich differenzierter sieht als in den älteren Darstellungen. Ob sich diese jüngste Forschungstendenz fortsetzt, ist derzeit nicht abzusehen.