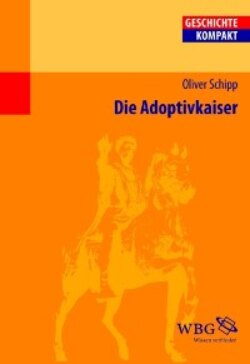Читать книгу Die Adoptivkaiser - Oliver Schipp - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1. Die Herrschergewalt des Prinzeps
ОглавлениеDer Erbe Caesars
Die politische Bedeutung des Octavian beruhte anfangs auf seiner testamentarischen Adoption durch Gaius Iulius Caesar. Mit der Adoption erbte er 44 v. Chr. nicht nur den größten Teil des Privatvermögens, sondern er wurde auch Patron von Caesars Klienten. Vor allem aber konnte er sich von nun an auf die in Italien angesiedelten Veteranen des Diktators verlassen. „Du, mein Junge, verdankst alles deinem Namen“, soll Marcus Antonius zu Octavian, in Anspielung auf die testamentarische Adoption durch Caesar, gesagt haben (Cicero, Philippica 13,24). Mit dem Antritt des Erbes ließ sich Octavian Gaius Iulius Caesar nennen.
Begründung des Prinzipats
Die formale Begründung des Prinzipats erfolgte im Januar 27 v. Chr., Begründung nachdem Octavian zuvor seinen Widersacher Marcus Antonius in der See- des Prinzipats schlacht bei Actium am 2. September 31 v. Chr. besiegt hatte. Seine Stellung als Alleinherrscher bemäntelte er, indem er dem Anschein nach die Republik wiederherstellte (res publica restituta). Feierlich legte er in der Senatssitzung vom 13. Januar 27 v. Chr. seine Ausnahmegewalt nieder und gab die Herrschaftsgewalt der Form nach zurück in die Obhut von Senat und Volk, ein Staatsakt, der gut vorbereitet war. Die tatsächliche Macht, die Gefolgschaft des Heeres, blieb Zeit seines Lebens in seiner Gewalt. Der Senat wurde zudem in einer weiteren Senatssitzung am 16. Januar 27 v. Chr. genötigt, ihm die Kommandogewalt, das imperium proconsulare, über die unbefriedeten Grenzprovinzen, in denen die meisten Legionen stationiert waren, zu übertragen. Außerdem blieb Octavian Konsul und ließ sich auch in den nächsten Jahren zum Konsul wählen, obwohl das Iterationsverbot dies nicht gestattete. In seinem Tatenbericht erwähnte er seine politisch-rechtliche Ausnahmestellung mit keinem Wort, um die Fiktion von der wiederhergestellten Republik aufrechtzuerhalten.
Begründung des Prinzipats
Tatenbericht des Augustus
(Res Gestae divi Augusti 34)
In meinem sechsten und siebten Konsulat (28 und 27 v. Chr.), nachdem ich den Bürgerkriegen ein Ende gesetzt hatte, habe ich, der ich mit Zustimmung der Allgemeinheit (consensus universorum) zur höchsten Gewalt gelangt war, den Staat aus meinem Machtbereich wieder der freien Entscheidung des Senats und des römischen Volkes übertragen. […] Seit dieser Zeit überragte ich zwar alle an Einfluss und Ansehen (auctoritas), Macht (potestas) aber besaß ich hinfort nicht mehr als diejenigen, die auch ich als Kollegen im Amt gehabt habe.
Im Jahre 23 v. Chr. verzichtete Augustus, wie Octavian seit der zweiten Se- Politisch-rechtliche natssitzung genannt wurde, wegen Widerständen gegen die kontinuierliche Legitimation Ausübung der obersten Amtsgewalt, auf den Konsulat. Stattdessen ließ er sich die Amtsgewalt eines Volkstribunen, die tribunicia potestas, übertragen. Seine Kommandogewalt wurde auf die senatorischen Provinzen und die Stadt Rom erweitert, das imperium proconsulare (maius). Wichtige innenpolitische Vollmachten übernahm er mit der Getreideversorgung (cura annonae; 22 v. Chr.) und der Aufsicht über die Wasserversorgung (cura aquarum; 11 v. Chr.). Weitere konsularische Befugnisse glichen schließlich den Verlust des Konsulats aus.
E
tribunicia potestas und imperium proconsulare (maius)
Der Patrizier Augustus konnte nicht das Amt eines Volkstribunen (tribunus plebis) annehmen, da dieses den Plebejern vorbehalten war. Er ließ sich daher die tribunizische Amtsgewalt (tribunicia potestas) übertragen. Dadurch erhielt er die Vollmachten eines Volkstribuns, ohne das Amt zu bekleiden. Er konnte aufgrund des damit verbundenen Veto- und Initiativrechts die Innenpolitik bestimmen. Die Bedeutung der tribunizischen Gewalt in dem Machtgefüge des Prinzipats zeigt sich daran, dass Augustus, wie alle seine Nachfolger, seine Regierungsjahre mit ihr zählte.
Die Kommandogewalt (imperium proconsulare) über eine bestimmte Provinz umfasste deren Verwaltung und den Oberbefehl über die dort stationierten Truppen. Ursprünglich auf eine Provinz und wenige Jahre beschränkt, wurden im Laufe der Krisenzeit der Republik die Imperien eines Sulla, Pompeius und Caesar auf mehrere Provinzen und mehrere Jahre ausgedehnt. Augustus erhielt 27 v. Chr. ein zehnjähriges Imperium über fast alle Provinzen, in denen Legionen stationiert waren. Im Jahre 23 v. Chr. wurde diese Kommandogewalt auf die noch dem Senat verbliebenen Provinzen erweitert. Zusätzlich hatte er das Recht, das imperium proconsulare maius von Rom aus wahrzunehmen und Statthalter in die Provinzen schicken zu können. Die Bezeichnung imperium proconsulare maius ist kein zeitgenössischer Begriff, sondern wird von der modernen Forschung verwendet.
Ideologisch-sakrale Legitimation
Augustus beanspruchte lediglich, alle an Einfluss und Ansehen zu überragen. Als Sohn des vergöttlichten Caesar, den man als divus Iulius in Rom und den Provinzen verehrte, wurden auch Augustus selbst göttliche Ehrungen zuteil. Zunächst baute man ihm im Osten gemeinsam mit der Göttin Roma Tempel und opferte ihm, dann begann man damit auch im Westen (zuerst 29 v. Chr. in Pergamon und Nikomedien; ab 12 v. Chr. in Lugdunum/Lyon). Der Name Augustus, der an Romulus und die Gründung der Stadt Rom erinnern sollte, hob den Prinzeps dann für alle ersichtlich über das normale Maß heraus. Zahlreiche Privilegierungen und Ehrungen ließen die ideelle Legitimation des ersten Mannes im Staate weiter wachsen. Bereits 36 v. Chr. verlieh ihm das Volk die Unverletzlichkeit seiner Person (sacrosanctitas). Er gehörte allen bedeutenden Priesterkollegien an (quindecemviri sacris faciundis, septemviri epulonum, Arvales fratres usw.). Seit dem Jahre 12 v. Chr. stand er als pontifex maximus dem altehrwürdigen Pontifikalkollegium vor. Der abschließende Höhepunkt war im Jahre 2. v. Chr. erreicht, als der Senat ihn mit dem Titel „Vater des Vaterlandes“ (pater patriae) ehrte. Die sakrale Überhöhung, die bereits im Augustusnamen enthalten war, wurde erneuert und die väterliche Fürsorge des Prinzeps auf alle Bürger ausgedehnt und akzentuiert.
Bedeutung der Sieghaftigkeit
Zu seiner herausragenden Stellung im Kultus kamen die militärischen Er-Sieghaftigkeit folge hinzu. Seine Sieghaftigkeit, die er seinem Freund und General Marcus Agrippa verdankte, fand ihren Niederschlag in imperatorischen Akklamationen, den Ernennungen zum Feldherrn auf dem Schlachtfeld. Bei seinem Tod waren es dreiundzwanzig. Noch deutlicher wird die Bedeutung der Kriegserfolge aber an der Bewertung von Niederlagen. Die Schlacht im Teutoburger Wald etwa wurde als eine Katastrophe angesehen. Auch wenn dem Statthalter Varus die Hauptschuld zugeschrieben wurde, hatte die Würde des Augustus Schaden genommen (Sueton, Augustus 23; Plinius d.Ä., Naturalis historiae 7,150; Velleius Paterculus 2,117,1). Viel schwerer als der reale Verlust dreier Legionen wog der Ansehensverlust. Das Vertrauen in die Sieghaftigkeit des Prinzeps musste erst wiederhergestellt werden und beschäftigte noch lange die kaiserliche Politik.
Die Herrschergewalt des Prinzeps beruhte also auf der Heeresgefolgschaft (consensus militum) und der allgemeinen Zustimmung des Volkes und des Senats. Durch Letztere erhielt der Prinzeps die rechtlich-politische Legitimation seiner Ausnahmestellung. Die Fiktion der wiederhergestellten Republik wurde dadurch aufrechterhalten.
Herrschaftsübertragung
Augustus erwarb die volle Herrschergewalt in einem längeren Prozess. Herrschafts-Seinen Nachfolgern sind die Befugnisse des Prinzeps von Senat und Volk in übertragung einem Zug übertragen worden. Das einzige Zeugnis, das diesen Vorgang dokumentiert, ist eine unvollständig erhaltene Bronzetafel, die heute in den Kapitolinischen Museen in Rom aufbewahrt wird. Von den erhaltenen Paragraphen der oftmals als Bestallungsgesetz für Vespasian bezeichneten Inschrift, soll hier ein Auszug gezeigt werden, um einen Eindruck dieses verfassungsrechtlichen Legitimationsaktes zu vermitteln.
Q
Die sogenannte lex de imperio Vespasiani
(Corpus inscriptionum Latinarum Bd. VI, Nr. 930 = Inscriptiones Latinae selectae, Nr. 244)
§ 6 [diskretionäre Klausel] Dass er, was immer seiner Ansicht nach dem Interesse des Gemeinwesens und der Erhabenheit göttlicher (und) menschlicher, öffentlicher und privater Angelegenheiten entspricht, das Recht und die Macht haben solle, (dies) auszuführen und zu tun (ei agere facere ius potestasque erit), so wie es dem vergöttlichten Augustus, dem Tiberius Iulius Caesar Augustus (und) dem Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus zustand.
§ 7 [dispensatorische Klausel] Dass von den Gesetzen und Volksbeschlüssen (legibus plebeive scitis), denen, wie schriftlich festgelegt, der vergöttlichte Augustus, Tiberius Iulius Caesar Augustus und Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus nicht unterworfen waren, (auch) Kaiser Vespasian befreit sein solle (iis legibus plebis scitis … solutus sit); was immer aufgrund eines Gesetzes oder Gesetzesantrags der vergöttlichte Augustus, Tiberius Iulius Caesar Augustus oder Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus tun durften, dass alles dies zu tun (auch) dem Kaiser Vespasianus erlaubt sein solle.
§ 8 [transitorische Klausel] Dass alle vor diesem Gesetzesantrag erfolgten Maßnahmen, die vom Kaiser Vespasianus Augustus oder auf seinen Befehl und seine Weisung von einem anderen verfügt und angeordnet wurden, ebenso rechtmäßig und gültig sein sollen (ea perinde iusta rataque sint), wie wenn sie auf Veranlassung des Volkes oder der Plebs erfolgt wären (ac si populi plebisve iussu acta essent).
Vespasian wurde die Herrschergewalt in einem Staatsakt verliehen. Die genannten Spezialkompetenzen wurden ihm zugestanden, wobei Bezug genommen wird auf Augustus (Iulius Caesar Augustus), Tiberius (Tiberius Iulius Caesar Augustus) und Claudius (Tiberius Claudius Caesar Augustus Germanicus). Nicht genannt werden Caligula und Nero, da das Angedenken an diese ausgelöscht worden war (damnatio memoriae).
Nach der transitorischen Klausel (§ 8) zu schließen, handelt es sich hier um ein Gesetz (lex). Die Herrschergewalt des jeweiligen Prinzeps wurde durch einen Volksbeschluss verliehen. Diesem lag wiederum ein Senatsbeschluss zugrunde, was sich an den formelhaften Satzeinleitungen zeigt (utique … liceat – dass es ihm erlaubt sein soll). Der Senat hatte eine entsprechende Empfehlung abgegeben und es war üblich, dass die Volksversammlung dieser folgte. Somit wurde die Herrschergewalt durch das Volk und den Senat verliehen.
Die Grundlage der Herrschaft bestand für Vespasian, wie für jeden Kaiser, in dieser allgemeinen Zustimmung von Senat und Volk. Vor allem aber war die Zustimmung der Legionen erforderlich. Schon Augustus hat diesen consensus universorum in seinem Tatenbericht besonders hervorgehoben.
Die politisch-rechtlichen Befugnisse wurden also per Gesetz auf den neuen Prinzeps übertragen. Wie erreichte man aber die allgemeine Zustimmung für einen Nachfolger? Wie vererbt man eine ideelle Legitimation? Wie vermeidet man einen Bürgerkrieg beim Herrscherwechsel, wenn keine leiblichen Söhne vorhanden waren? Nach dem erzwungenen Selbstmord Neros und der Ermordung Domitians brachen innenpolitische Wirren aus. Jeder Kandidat musste bestrebt sein, Unruhen zu verhindern. Eine Möglichkeit war, den präsumtiven Nachfolger rechtzeitig zu designieren und durch Adoption an Sohnesstatt anzunehmen.