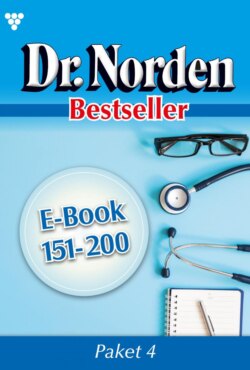Читать книгу Dr. Norden Bestseller Paket 4 – Arztroman - Patricia Vandenberg - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеWenn Fee Norden für einen besonderen Anlaß ein ganz besonders schönes Kleid brauchte, suchte sie die Modeschöpferin Melanie Dittmar auf. Fee konnte sicher sein, daß diese ihr einen Freundschaftspreis machte, und das nicht nur, weil Fee eine so besonders aparte Frau war, für die man mit Begeisterung arbeitete.
Melanie hatte Dr. Norden viel zu verdanken. Er hatte sie durch eine gezielte Behandlung von einem Schilddrüsenleiden ohne Operation kuriert, das ihr psychisch mehr zu schaffen gemacht hatte als physisch. Und vor dem Chirurgen hatte Melanie eine heillose Angst gehabt.
Vielleicht war Melanies Krankheit auch schuld daran gewesen, daß ihre Ehe in eine so schwere Krise geraten war, die dann die Scheidung zur Folge hatte. Sie hatte sich von ihrem Mann, dem Bauunternehmer Vinzenz Dittmar, unverstanden gefühlt. Sie hatte sich auch unausgefüllt gefühlt, als die einzige Tochter Susanne den Kinderschuhen entwachsen war und oft die Partei des Vaters ergriffen hatte. Sie wollte wieder in den Beruf zurück, den sie des Kindes wegen aufgegeben hatte, sie wollte ihre Talente nützen. Das hatte ihrem Mann nicht gepaßt. Sie hätte das wahrhaftig nicht nötig, und was sollten die Leute denken, hatte er gesagt. Keiner hatte nachgegeben. Und seit der Scheidung vor sechs Jahren hatten sie kein Wort mehr miteinander gewechselt.
Das wußte Fee Norden, und wenn sie es auch nicht ganz verstehen konnte, so meinte sie doch, daß reife Menschen wissen müßten, was sie tun. Vinzenz Dittmar, der ebenfalls ein Patient ihres Mannes war, besaß ihre Sympathie genauso wie Melanie. Ihr tat nur Susanne leid, die zwischen den Eltern stand, die beide liebte und keinem weh tun wollte.
Als Fee das Modestudio von Melanie betrat, kam Susanne gerade aus dem Atelier. Sie sah entzückend aus, war wie immer nach neuestem Schick gekleidet, an diesem Tage aber ganz besonders anziehend.
Ihre samtbraunen Augen leuchteten auf, als sie Fee anblickten. »Wie freue ich mich, Sie zu sehen, Frau Dr. Norden«, sagte sie mit schwingender Stimme. »So können Sie auch gleich die große Neuigkeit erfahren. Ich werde in vier Wochen heiraten.«
Fee war überrascht. »Und wer ist der Glückliche?« fragte sie.
»Adrian von Cordes. Heute feiern wir mit Paps Verlobung, am Wochenende mit Mami. Vielleicht bekommen wir sie zur Hochzeit doch noch an einen Tisch.«
Du liebe Güte, dachte Fee, wenn die Hochzeit schon in vier Wochen sein soll, warum dann erst noch eine Verlobungsfeier und ein gewisses Befremden konnte sie auch nur schwer unterdrücken, denn der alte Baron von Cordes war als sehr adelsstolz bekannt.
Susanne hatte es dann sehr eilig, und Melanie verabschiedete gerade eine Kundin, die ihr anscheinend nicht recht in den Kram paßte.
Melanies Miene hellte sich auf, als sie Fee begrüßte. »Wenigstens ein Lichtblick an diesem Morgen«, seufzte sie.
»Freut es Sie denn nicht, daß Susanne so glücklich ist?« fragte Fee bestürzt.
»Ach, Sie haben die Neuigkeit schon vernommen«, sagte Melanie freudlos.
»Susanne hat es mir eben gesagt. Sie sind nicht einverstanden, Melanie?«
»Keineswegs, aber ich will ihr nicht dreinreden. Warum wohl will ein Cordes die Tochter eines Bauunternehmers heiraten? Er hat Adel, sie hat Geld«, sagte Melanie bitter. »Und wer den alten Cordes kennt, weiß, daß ihnen das Wasser bis zum Hals stehen muß, daß er mit dieser Verbindung einverstanden ist. Aber daß Vinzenz das mitmachte, erbittert mich.«
»Susanne macht doch aber einen sehr glücklichen Eindruck«, lenkte Fee ein.
»Sie ist neunzehn, völlig unerfahren, und der Himmel hängt ihr voller Geigen. Ich sehe das ganz anders, Fee«, sagte Melanie deprimiert.
»Aber sie ist entzückend, warum sollte da auch bei dem jungen Cordes nicht das Herz entschieden haben?«
»Er ist eiskalt und berechnend«, ereiferte sich Melanie. »Natürlich ist ihm ein hübsches, reiches Mädchen lieber als eine häßliche arme Adlige, aber ich sehe all die Konflikte schon im voraus.«
Sie ist nicht objektiv, dachte Fee. Weil ihre Ehe schiefging, hat sie diesbezüglich Komplexe bekommen.
»Als ich Vinzenz geheiratet habe, besaßen wir nicht viel«, fuhr Melanie gedankenverloren fort. »Da war es wirklich Liebe. Aber mit zunehmendem Wohlstand verflachten die Gefühle. Er hatte nur seine Geschäfte im Kopf. Er wollte nur noch Geld scheffeln, und das ist ihm auch gelungen. Daß eine Frau auch ihre eigene Persönlichkeit entfalten möchte, dafür hatte er kein Verständnis. Eine Frau gehört ins Haus, an den Herd und in die Kinderstube. Diesbezüglich ist er auch ein richtiger Spießer geblieben. Und sein Größenwahn geht soweit, Susi mit einem Erbschleicher zu verkuppeln.«
»Sind Sie nicht ein bißchen ungerecht, Melanie?« fragte Fee vorsichtig. »Es scheint doch so, als sei Susanne wirklich glücklich.«
»Ich sagte es ja schon, sie schwebt im siebenten Himmel, und ich vermag es nicht, sie auf die Erde zurückzuholen. Sie würde mich hassen, wenn ich ihr meine Meinung ehrlich sagen würde. Und ich fürchte, ihr Vater wird sich dafür ruinieren, um ihr diesen Wunsch zu erfüllen. Ich werde also meiner Tochter ein Brautkleid nähen, in das ich viele Tränen hineinweinen werde.«
»Vielleicht sehen Sie zu schwarz, Melanie«, sagte Fee.
»Ich weiß, was aus einer Ehe werden kann, die aus Liebe geschlossen wurde. Was soll da erst aus einer Ehe werden, die nur aus materiellen Gründen geschlossen wird? Das kann mir niemand ausreden. Ich weiß, wie es um die Cordes steht. Ich habe Erkundigungen eingezogen.«
*
Diesbezüglich übertrieb sie keineswegs. So entzückt Fee Norden von dem Abendkleid war, das Melanie für sie entworfen und geschaffen hatte, sie ging mit sehr gemischten Gefühlen. Melanie mochte in mancher Hinsicht sehr eigensinnig sein, aber sie liebte ihre Tochter und wollte nur ihr Glück.
Und hätte Fee das Gespräch belauschen können, das Aribert von Cordes jetzt mit seinem Sohn Adrian führte, hätte sie volles Verständnis für Melanie gehabt.
»Es gibt keine andere Lösung, Adrian«, sagte der Baron. »Wir müssen in den sauren Apfel beißen, sonst verlieren wir alles. Die einzige standesgemäße Partie mit Vermögen wäre Cecile gewesen, und ausgerechnet sie entscheidet sich für einen Bürgerlichen.«
»Erinnere mich bitte nicht daran, Vater, nicht jetzt«, sagte Adrian gereizt. »Sie hat mir doch wohl deutlich genug zu verstehen gegeben, daß sie nicht das geringste Interesse daran hat, unsere Schulden zu bezahlen.«
»Sie hatte schon immer einen Hang zum Proletariat«, sagte der Baron verächtlich. »Überhaupt kein Traditionsbewußtsein. Nun, jedenfalls ist Susanne bedeutend attraktiver als sie, und der Geldadel zählt heute ja auch anscheinend mehr. Man muß sich umstellen und anpassen. Aber vor allem ist es wichtig, daß uns der Besitz erhalten bleibt. Scheidungen sind bei uns auch kein Tabu mehr. Du kannst dir den Weg zu Tatjana offenhalten.«
Adrian starrte seinen Vater befremdet an. War das seine Moral, die er immer so hoch pries?
So unbequem ihm dieses Geschäft, denn als Geschäft bezeichnete er es, auch gewesen war, jetzt erwachte Trotz in ihm.
»Diese Bemerkung hättest du dir sparen können, Vater«, sagte er kühl. »Immerhin ist Susanne ein reizendes, liebenswertes Mädchen, und ich darf erwarten, daß du sie nicht nur als ein Huhn, das goldene Eier legt, betrachtest. Ich habe mich übrigens mit ihr verabredet und muß jetzt gehen. Am Samstag werden wir mit ihrer Mutter essen.«
»Ich werde unpäßlich sein«, sagte der Baron.
»Das wirst du nicht«, sagte Adrian heftig.
»Eine geschiedene Frau«, sagte sein Vater verächtlich.
»Und Dittmar ist der geschiedene Mann dazu. Außerdem hast du eben eine eindeutige Bemerkung gemacht, was Scheidungen anbetrifft. Auch du hast nicht das Privileg gepachtet, dir eigene Gesetze zu schaffen.«
»Was sind das für Töne?« fragte der Baron erbost.
»Vielleicht habe ich Gefallen an Susanne gefunden«, sagte Adrian heiser. »Sie ist zu schade, um nur als Objekt betrachtet zu werden.«
Er ging, und sein Vater blickte ihm konsterniert nach.
*
Susanne war noch beim Friseur gewesen und hatte sich einen neuen Haarschnitt zugelegt, der ihr ein noch aparteres Aussehen verlieh. Seit sie Adrian kannte, entwickelte sich ihre Persönlichkeit und auch ihr Geschmack. Sie hatte sich für einen damenhaften Stil entschieden. Adel verpflichtet, hatte ihre Mutter spöttisch gesagt, und das hatte Susanne einen Stich versetzt, aber sie dachte nicht an das »von«, sie dachte nur an Adrian, der für sie der einzige Mann auf der Welt war.
Als sie das Restaurant betrat, in dem sie sich verabredet hatten, sprang Adrian wie von einer Tarantel gestochen auf, so hinreißend sah sie aus und so damenhaft, daß er augenblicklich den Atem anhielt.
Und sie sah ihn, groß, schlank, das schmale dunkle Gesicht, das verriet, daß er sich viel in der frischen Luft aufhielt, die sehr hellen Augen, die jetzt durchaus nicht kühl blickten, und sie vergaß all die Gedanken, die sie sich auch selbst gemacht hatte, als er ein ernsthaftes Interesse für sie an den Tag legte.
Er küßte ihr die Hand. Das hatte er in der Öffentlichkeit auch noch nicht getan.
»Du siehst bezaubernd aus, Susanne!« Das hatte er auch noch nie gesagt.
»Es freut mich, daß dir meine neue Frisur gefällt«, sagte sie. »Hoffentlich finde ich auch langsam Gnade vor den Augen deines gestrengen Vaters.«
Schüchtern war sie nie gewesen. Sie war die Tochter eines erfolgreichen Vaters, ausgestattet mit einer ganz gehörigen Portion Selbstbewußtsein, das auch von ihrer Mutter in jeder Beziehung gefördert worden war, und Klassenunterschiede ignorierte sie. Im Innersten war sie von Anfang an überzeugt gewesen, daß Adrians Interesse allein ihr gelte und nicht ihrem Geld. Seine Zurückhaltung hatte sie nur positiv gewertet. Er hatte eben eine konservative Erziehung genossen. Er machte keine dreisten Annäherungsversuche, wie andere junge Männer. Und sie selbst war ja auch stets zurückhaltend gewesen.
Sie wählte aus der Speisekarte zielsicher, was sie essen wollte, und sagte zu dem Ober mit einem freundlichen Lächeln: »Das Filet aber wirklich medium und nur Salatherzen.«
»Aber selbstverständlich, gnädige Frau«, sagte er.
»Mir das gleiche«, sagte Adrian.
Susanne lachte leise. »Du wirst davon nicht satt werden, Adrian. Aber kannst dir ruhig Appetit für heute abend aufsparen. Paps wird allerhand auffahren lassen, und unter dem kritischen Blick deines Vaters wird mir wohl der Appetit vergehen.«
»Das hoffe ich nicht«, sagte er. »Schüchtert dich Vater so ein?«
»Ihm wäre es auf jeden Fall lieber, wenn ich auch ein ›von‹ vor dem Namen hätte, aber damit kann ich leider nicht dienen.«
»Bald wirst du es haben«, sagte Adrian heiser. »Ist es dir so wichtig?«
»Aber nein«, erwiderte sie lachend. »Ich heirate dich, nicht deinen Namen.«
Und plötzlich schämte sich Adrian entsetzlich. Er griff nach ihrer Hand. »Du bist herzerfrischend natürlich, Susanne«, sagte er leise. »Ich kann mich nur glücklich schätzen, daß du mir keinen Korb gegeben hast.«
Nachdenklich blickte sie ihn an. »Ich liebe dich«, flüsterte sie.
In diesem Augenblick erklang ein girrendes Lachen. »Adrian, das ist ja eine Überraschung«, sagte eine sehr helle Stimme, die ihm jetzt ebenso schmerzhaft in den Ohren tönte wie Susanne.
Tatjana, Gräfin Almassy, blieb am Tisch stehen, während ihre Begleiter sich an dem runden Tisch schräg gegenüber niederließen.
Adrian hatte sich erhoben, verneigte sich. »Darf ich bekannt machen, Gräfin Almassy, meine zukünftige Frau Susanne«, sagte er stockend.
»Und wann ist die Hochzeit?« fragte Tatjana spitz, ohne Anstalten zu machen, Susanne die Hand zu reichen.
»In vier Wochen«, erwiderte Adrian.
»Nun, da werde ich ja hoffentlich eingeladen«, sagte Tatjana, »oder wird der Adel ausgeschlossen?«
»Wir sind uns über die Gästeliste noch nicht ganz einig«, erwiderte Adrian.
Susanne hatte die Schrecksekunde überwunden, wenngleich ihr augenblicklich auch ein Kribbeln über die Haut lief.
»Wenn Sie nichts Besseres vorhaben, sind Sie selbstverständlich eingeladen«, sagte sie.
Tatjana verschlug es die Stimme. »Wahrscheinlich werde ich wohl etwas Besseres vorhaben«, sagte sie herablassend. »Man wird dich in unseren Kreisen vermissen, Adrian.«
»Ich werde es überleben«, sagte er sarkastisch, und da ging sie zu ihrer Gesellschaft.
»Und so was nennt man gute Erziehung«, sagte Susanne leise. »Mir ist der Appetit vergangen.«
»Das tut mir leid. Aber den Gefallen werden wir ihr nicht tun, gleich zu gehen, Susanne.«
Zwingend sah er sie an und fuhr fort: »Ich entschuldige mich für sie.«
»Das brauchst du nicht. Ich heiße zwar nur Dittmar und mein Vater ist Bauunternehmer, aber ich bin stolz darauf, was er durch ehrliche Arbeit erreicht hat. Man kann mir den Appetit nehmen, aber nicht meinen Stolz.«
»Du wirst dich doch nicht durch so törichte Bemerkungen irritieren lassen, Susanne«, sagte er gepreßt.
»Durchaus nicht. Ich habe mir die Leute, mit denen ich verkehren wollte, immer selbst ausgesucht und genau angeschaut, und daran wird sich nichts ändern.«
Und in diesem Augenblick wurde ihm bewußt, wie beeinflußbar er bisher selbst gewesen war, wie sehr er unter der Fuchtel seines Vaters gestanden hatte.
Irgend etwas beschäftigte Susanne doch, als sie nach Hause kam. Einfach abschütteln konnte sie dieses seltsame Gefühl doch nicht, das Tatjana in ihr geweckt hatte.
Und dann hörte sie, wie Franz und Erna, das Hausmeisterehepaar miteinander redeten.
»Ob das guttut, daß unsere Susanne den Adligen heiratet?« sagte Erna. »Recht schikaniert werden wird sie wohl von dem Baron.«
»Ich mein’, daß der junge Baron schon ein netter Kavalier ist«, sagte Franz.
»Mag ja sein, aber aufs Geld sind sie aus, das kann mir keiner ausreden.«
»Der Dittmar hat doch seinen Verstand beisammen«, sagte Franz.
»Aber er gefällt mir nicht so recht in letzter Zeit«, sagte Erna. »Heute hat er auch wieder mit dem Dr. Norden telefoniert.«
Susannes Herz begann schmerzhaft zu klopfen. Sie lehnte sich an die Wand, haltsuchend, weil sich alles um sie drehte.
Das tust du mir nicht an, Adrian, daß du mich nur wegen des Geldes heiratest, dachte sie. Die beiden reden genauso töricht daher wie die Gräfin Almassy.
»Ich bin da«, rief sie laut, »Ist niemand zu Hause?«
Da kam Erna, verlegen mit hochroten Wangen. »Wir haben Sie gar nicht kommen hören«, sagte sie stotternd. »Mei, sehen Sie aber schön aus, nur a bisserl blaß.«
»Ist Paps nicht zu Hause?« fragte Susanne.
»Er hatte noch was zu erledigen, aber es ist alles gerichtet. Es wird an nichts fehlen.«
»Das weiß ich, Erna«, sagte Susanne leise. »Ich werde mich ein Stündchen ausruhen.«
*
»Es ist der Blutdruck, Herr Dittmar«, sagte Dr. Norden. »Er ist viel zu hoch. Da spielt das Herz auch verrückt, obgleich es sonst erstaunlich in Ordnung ist. Ruhe müßten Sie halt mal geben und nicht zu üppig essen.«
»Man hat ja so viel Verpflichtungen«, sagte Vinzenz Dittmar. »Aber heute abend muß ich fit sein. Wir feiern Susannes Verlobung.«
»Und das sagen Sie mir erst jetzt?«
»Ist ja auch nur, weil es zum guten Ton gehört. Die Hochzeit findet in vier Wochen statt. Daß meine Tochter mal eine Baronin wird, habe ich mir auch nicht träumen lassen. Aber sie ist ja vernarrt in den Adrian, dagegen ist nichts zu machen. Das Mädel hat selbst Verstand genug um zu wissen, was sie sich zumuten kann. Und die Mitgift wird gut angelegt sein.«
Dr. Norden horchte auf. »Eine Heirat ist doch kein Geschäft, Herr Dittmar«, sagte er unwillig.
»Eine arme Frau könnte sich Adrian von Cordes nicht leisten«, sagte Vinzenz Dittmar. »Aber Susanne will ihn haben, und sie soll ihn bekommen. Er ist nicht übel. Sie wird ihn schon auf Vordermann bringen. Natürlich weiß sie nicht, daß der alte Cordes nur daran denkt, sich sanieren zu können. Aber dem werde ich auch schon noch zeigen, mit wem er es zu tun hat, wenn die Hochzeit erst vorbei ist. Mir macht keiner mehr was vor.«
»Wirklich nicht, Herr Dittmar?« fragte Dr. Norden. »Nur weil Sie Susanne keinen Wunsch abschlagen können?«
»Sie können einem schon zusetzen, Dr. Norden«, brummte Vinzenz Dittmar, »aber Ihnen nehme ich nichts übel. Susanne weiß nichts von den Abmachungen, die ich mit dem alten Cordes getroffen habe. Sie wird davon auch nie was erfahren. Und ich bin nicht so blöd, daß ich meine Tochter nicht absichern würde. Außerdem bekomme ich endlich das Grundstück am See. Für mich ist es ein gutes Geschäft, und Susanne bekommt ihre große Liebe.«
»Und wenn diese große Liebe nach der Hochzeit als Seifenblase platzt?« fragte Dr. Norden.
»Dann kann der Adrian was erleben, aber er ist nicht so, wie die meisten denken. Er kann sich doch auch alle zehn Finger schlecken, wenn er Susanne zur Frau bekommt.«
»Sie sehen das als Vater, aber er sieht vielleicht doch nur die einzige Tochter eines reichen Vaters«, sagte Dr. Norden frei heraus. »Wie denkt Susannes Mutter?«
»Das weiß ich nicht, das interessiert mich auch nicht. Sie fühlt sich ja auch wohl in dieser High society. Ich stelle für gutes Geld wenigstens auch Gutes auf die Beine, aber diese verrückten Weiber geben einen Haufen Geld für Fetzen aus, die schon im nächsten Jahr nicht mehr modern sind. Meine Häuser überdauern Generationen.«
»Ihre Frau macht aber sehr hübsche Kleider, die auch über Jahre hinaus tragbar sind«, sagte Daniel. »Ich weiß das aus Erfahrung.«
»Melanie ist nicht mehr meine Frau«, sagte. Vinzenz Dittmar. »Wollen Sie meinen Blutdruck höher treiben?«
»Keinesfalls, aber was Recht ist, muß Recht bleiben. Sie ist eine tüchtige Frau. Sie braucht keinen reichen Mann. Aber manche Männer brauchen eine reiche Frau. Nehmen Sie mir es nicht übel, wenn ich das sage.«
Dittmar kniff die Augen zusammen. »Und meine Susanne? Ist das ein Mädchen, das man nur wegen ihrer Mitgift nimmt? Wenn das so wäre, dann kann Adrian etwas erleben. Aber wenn ich Ihnen nun sage, daß er bei mir einsteigen wird, daß er mir zugesichert hat, meine Firma zu repräsentieren? Ein Baron von Cordes, Repräsentant der Baufirma Dittmar, ist das nichts?«
»Der Name allein macht es nicht, Herr Dittmar. Aber mich würde es für Susanne freuen, wenn Ihre Menschenkenntnis Sie nicht im Stich gelassen hat. Sie können mich nun schelten, wenn ich Sie daran erinnere, daß Sie auch einmal sagten, daß Ihre Frau kein Bein auf die Erde bringen würde, wenn sie auf sich allein angewiesen wäre. Aber was hat sie bewiesen! Ich wette, daß sie bereits auch Millionärin ist.«
»Sie sind ein harter Brocken, aber so was mag ich«, sagte Vinzenz Dittmar. »Nur als Arzt werden Sie es nicht zum Millionär bringen. Dazu sind Sie viel zu gutmütig.«
»Vielleicht bin ich sehr viel reicher als Sie, Herr Dittmar. Ich habe eine wundervolle Frau, drei gesunde Kinder, die nicht maßlos verwöhnt werden, und sehr viele Patienten, die mir treu bleiben, und dann auch noch die Insel der Hoffnung. Vielleicht sollten Sie mal eine Kur dort machen. Da würden Sie viele Leute kennenlernen, die längst erkannt haben, daß Geld nicht glücklich macht.«
Vinzenz Dittmar blickte zu Boden. »Sie haben ja recht. Sie haben immer recht. Aber meine Susanne soll doch glücklich werden. Sie ist mein Alles. Und wehe, wer ihr ein Härchen krümmt!«
*
Fee Norden hatte das neue Kleid angezogen, bevor ihr Mann kam.
»Mensch, siehst du toll aus«, sagte Danny.
»Man sagt nicht ›Mensch‹«, wies Felix seinen großen Bruder zurecht.
»Ist mir doch bloß rausgerutscht. Toll sieht Mami aus.«
»Schön«, säuselte Anneka. »Wie eine Königin.«
»Die Königinnen im Fernsehen sehen aber doof aus«, sagte Danny,
»Ruhe«, sagte Fee, als sie hörte, daß Daniel kam. »Mal sehen, was Papi sagt.«
Daniel stand stumm da und betrachtete seine Frau bewundernd. »Umwerfend«, murmelte er, »aber das bist du auch ohne alles.«
»Ohne alles?« sagte Danny. »Wie meinst du das, Papi?«
»Im Bikini meint er«, sagte Felix. »Da sieht Mami doch noch dünner aus.«
»Ihr müßt ja immer eure Kommentare geben«, brummte Daniel. »Ich habe Hunger.«
»Ich ziehe mich schnell um«, sagte Fee mit einem schelmischen Lächeln.
»Und ich sage Lenni Bescheid«, sagte Danny.
Daniel folgte seiner Frau. »Wofür ist das Kleid eigentlich gedacht?« fragte er, seine Arme um sie legend.
»Du hast doch nicht etwa vergessen, daß Professor Emmrich seinen siebzigsten Geburtstag feiert? Da werden auch Minister mit ihren Gattinnen erscheinen.«
»Das ist doch erst in zwei Wochen«, sagte Daniel.
»Aber Melanie muß auch für die Gattinnen der Minister Kleider schneidern«, sagte Fee lächelnd.
»Die du auch im Nachthemd in den Schatten stellen würdest, mein Schatz«, sagte er schmunzelnd.
»Ich möchte wissen, was du sagen würdest, wenn ich da im Nachthemd erscheinen würde«, erwiderte sie neckend. »Aber Scherz beiseite, es gibt große Neuigkeiten.«
»Meinst du die Hochzeit von Susanne Dittmar?« fragte er.
»Woher weißt du das schon wieder?«
»Von ihrem Vater. Er war bei mir. Heute wird erst mal die Verlobung gefeiert.«
»Warum sagst du das so anzüglich?«
»Vielleicht überlegt er sich noch, ob ihn die Heirat nicht doch zuviel kostet.«
»Du denkst genau wie Melanie«, sagte Fee nachdenklich.
»Ich denke nicht, ich kombiniere nur«, sagte er. »Sein Blutdruck ist sehr hoch. Er regt sich innerlich auf. Er gibt es nicht zu, so ganz geheuer ist ihm die Heirat auch nicht. Aber Susanne liebt diesen Adrian von Cordes.«
»Und sie sieht sehr glücklich aus«, sagte Fee. »Ich habe sie getroffen. Und wenn er dieses entzückende Mädchen nicht liebt, ist er blöd.«
»Du hast es gesagt. Aber vielleicht ist er blöd. Zumindest degeneriert. Aber diese ganze adlige Gesellschaft soll sich nur nicht in Vinzenz Dittmar täuschen oder ihn gar auf die Palme bringen. Der Mann hat was auf dem Kasten, nicht nur Geld. Er hat auch Verstand. Und so sehr ich Melanies Talent schätze, zauberhafte Kleider zu schneidern, blöd war auch sie, sich von diesem Mann zu trennen.«
»Das habe ich auch schon oft gedacht, Daniel«, sagte Fee. »Aber wenn zwei Dickköpfe zusammenkommen, fliegen eben die Fetzen. Da bedarf es manchmal nur eines kleinen Anlasses. Wenn ich nur wüßte, was bei den beiden der Anlaß war.«
Das hätte ihr Melanie sagen können und auch Vinzenz Dittmar, wenn sie es gewollt hätten.
Da war nämlich ein Mann aufgetaucht, der mal Melanies Jugendliebe gewesen war, und gleichzeitig hatte Vinzenz bedauerlicherweise auch eine Sekretärin gehabt, die es sehr gut verstand, ihm um den Bart zu gehen. Mehr als alles andere war Eifersucht im Spiel gewesen, daß sie sich in die Haare kriegten, obgleich weder der Jugendfreund noch die Sekretärin später eine Rolle in ihrer beider Leben spielten. Aber sie waren geschiedene Leute, und jeder gab dem anderen Schuld daran.
Und am Nachmittag dieses Tages dachte auch Susanne darüber nach, warum sich ihre Eltern eigentlich getrennt hatten. Diese Tatjana von Almassy hatte ihr plötzlich klar gemacht, was eine Ehe, eine Liebe gefährden konnte.
Liebt mich Adrian überhaupt, dachte sie. Gesagt hat er es noch nie. Und sie ärgerte sich nun auch, daß sie es ausgesprochen hatte, was sie für ihn fühlte.
Aber sie war die Tochter ihres Vaters. Ich werde nicht kapitulieren, dachte sie. Ich werde um ihn kämpfen. Und wenn einer auf der Strecke bleibt, werde nicht ich es sein.
Mal sehen, was er macht, wenn ich ihm zu verstehen gebe, daß ich auch andere Chancen habe, dachte sie dann. Was will diese Zimtziege eigentlich? Konfektionskleidung trägt sie. Zu mehr reicht es wohl nicht. Sie könnte sich keine Kleidung aus dem Atelier Melanie leisten.
Dann wurde sie vernünftig. So dachte sie sonst doch nicht. Sie schätzte die Menschen doch nicht nach ihrer Kleidung ein. Aber diese Tatjana war ihr unsympathisch gewesen. Diese Arroganz, nur weil sie eine Gräfin war, stand ihr nicht zu.
Susanne mußte an die Fürstin Ravensport denken, die auch eine Kundin von ihrer Mami war. Was war das für eine vornehme Frau!
Und dann dachte sie an ihre Freundinnen aus dem Internat. Sogar eine Prinzessin war darunter gewesen, und keine hatte sich so ordinär benommen wie diese Tatjana. Ja, es war ordinär gewesen. Madame Gerard, die Internatsleiterin, hätte so ein Benehmen sehr bemängelt.
Susanne war sehr jung und sehr unerfahren, vor allem was Männer betraf, aber sie hatte einen gesunden Menschenverstand. Sie fand zu ihrer inneren Ruhe zurück. Sie war mehr erbost, als sie ihren Vater kommen hörte.
Schnell lief sie zu ihm hinunter. »Wo warst du denn so lange, Paps?« fragte sie.
»Bei Dr. Norden«, erwiderte er ehrlich. »Mein Blutdruck macht mir zu schaffen. Jetzt geht es schon wieder. Bist du dir auch sicher, daß du die richtige Entscheidung getroffen hast, Susi?«
»Mir wäre es lieber, wir würden die Verlobung mit Mami feiern«, sagte sie. »In Königshäusern machen sie da auch Konzessionen.«
»Ich bin bloß Bauunternehmer«, brummte er. »Ganz geheuer ist es mir nicht, daß du eine Baronin wirst.«
»Du brauchst mich nicht mit dem Titel anzureden, Paps«, sagte sie. »Ich bleibe deine Susi. Aber ich bleibe auch Mamis Susanne. Sie wird mein Hochzeitskleid schneidern. Und ich habe nur einen Wunsch.«
»Welchen?«
»Daß ihr euch an meinem Hochzeitstag die Hände reicht und eure Feindschaft begrabt.«
»Es ist keine Feindschaft. Es sind unüberbrückbare Gegensätze, mein Kind«, sagte er ernst. »Wenn du erst mal verheiratet bist, wirst du auch merken, wie schwierig es ist, solche zu bewältigen. Aber wenn du nicht glücklich wirst, Susi, auf deinen Paps kannst du dich immer verlassen. Laß dich bloß nicht unterbuttern. Du bist schließlich auch wer.«
Susanne runzelte leicht die Stirn. »Ich wäre froh, wenn du in bezug auf Mami auch so gedacht hättest, Paps. Sie ist schließlich auch wer.«
Sie war die einzige, die das widerspruchslos sagen durfte. Wie tief es ihn auch getroffen hatte, daß Melanie sich von ihm trennte, niemals hatte er versucht, Mutter und Tochter zu trennen. Und vielleicht war es gerade diesem Umstand zu verdanken, daß Susanne von beiden das Beste mitbekommen hatte, daß sie ohne Zwang von jedem das nehmen konnte, was ihr nützlich war. Von ihm den kühlen Verstand, von Melanie das Temperament und die weibliche Selbstsicherheit, die durch Äußerlichkeiten unterstützt wurde.
»Mami wird es sich jedenfalls nicht nehmen lassen, zu meiner Hochzeit zu kommen«, sagte Susanne triumphierend.
»Und mit wem tritt sie auf?« fragte er grimmig.
»Mit der Fürstin Ravensport«, erwiderte Susanne. »Und die erscheint mit Sohn und Tochter. Mein zukünftiger Schwiegervater wird Augen machen, was wir zur Hochzeitsgesellschaft beitragen.«
»Du bist ein raffiniertes kleines Biest«, sagte er.
»Ich weiß, was ich will, genau wie du. Heute hatte ich ein Tief, aber das ist vorbei. Es werden sicher auch noch mehr von und zus kommen. Mami macht das schon.«
»Mami macht das schon«, wiederholte er entsagungsvoll. »Sie wird sich auch noch einen Baron angeln.«
»Recht geschieht es dir«, sagte Susanne. »Aber du bist mein Paps und bleibst es!«
*
Und dann fand das Festmahl zu viert statt. Ein wenig verblüfft war der Baron von Cordes schon, als er den großzügigen Bungalow betrat, der so exklusiv ausgestattet war, ohne aufdringlich zu wirken.
Erna und Franz walteten diskret ihres Amtes. Alles klappte wie am Schnürchen, und was aufgetafelt wurde, hatte selbst der Baron schon lange nicht mehr gesehen.
»Sie haben anscheinend Glück mit Ihrem Personal, mein lieber Dittmar«, sagte er jovial.
»Ein Flüchtlingsehepaar. Sie haben bessere Zeiten gesehen, aber sie sind glücklich, ein gutes Zuhause gefunden zu haben«, erwiderte Vinzenz Dittmar gelassen.
»Waren sie schon hier, als Sie noch mit Ihrer Frau zusammenlebten?« fragte der Baron anzüglich.
»Nein, sie waren Spätaussiedler aus Rumänien. Ich habe das große Los gezogen. Aber was Susannes Mutter betrifft, möchte ich sagen, daß sie zur Hochzeit anwesend sein wird.«
»Sie haben sich geeinigt?« fragte der Baron.
»Susanne hat das arrangiert. Die Fürstin Ravensport mit Sohn und Tochter haben ebenfalls zugesagt. Sie brauchen nicht zu fürchten, daß nur Bürgerliche uns die Ehre geben.«
Er konnte schon manchmal sehr sarkastisch sein. Vinzenz Dittmar dachte auch nicht einen Augenblick daran, vor dem Baron Cordes zu Kreuze zu kriechen. Er sah dazu nicht den geringsten Anlaß. Das Gespräch mit Dr. Norden hatte ihm zusätzlich den Rücken gesteift, und sein Blutdruck war durch das Medikament, das ihm Dr. Norden verabreicht hatte, auch gesunken.
»Die Väter unterhalten sich«, sagte Susanne zu Adrian. »Was bedrückt dich?«
»Du warst sehr kurz, als wir uns heute mittag verabschiedeten, Susanne«, sagte er.
»Ich hatte mich geärgert über diese Almassy«, gab sie unumwunden zu. »Das ist vorbei. Sie wird jedenfalls keine Einladung bekommen.«
»Mir kann das nur recht sein«, sagte er.
»War etwas zwischen euch?« fragte Susanne ganz gezielt.
Ihm stieg das Blut in die Stirn. »Wir kennen uns ziemlich lange«, erwiderte er, »und ich will auch nicht verheimlichen, daß mein Vater einmal an eine Verbindung zwischen diesen beiden Familien dachte.«
»So konservativ, wie er ist«, sagte Susanne leichthin. »Sie kleidet sich billig. Ich will damit nicht sagen, daß man aus Geldmangel von der Stange kaufen muß, aber man könnte dennoch einen besseren Geschmack zeigen. Nun, ich habe immerhin das Glück, daß meine Mutter eine bekannte Modeschöpferin ist, und mein Vater ein Bauunternehmer, der mir ein Schloß bauen würde, wenn ich es wünsche.«
Adrian wurde sehr blaß. »Warum betonst du das heute so, Susanne?« fragte er heiser.
»Um dir zu verstehen zu geben, daß ich mit einer Gräfin Almassy nichts gemein habe, in keiner Beziehung«, sagte sie aggressiv. »Ich habe nur eine zu gute Erziehung genossen, um mich in einem Restaurant mit ›Damen‹ anzulegen, und ich möchte es zur Bedingung machen, daß wir künftig keine Lokale aufsuchen, in denen ich so peinlichen Situationen ausgesetzt werde.«
»Es tut mir unendlich leid, Susanne«, sagte er stockend, »es war ein dummer Zufall.«
»Okay«, sagte sie leichthin.
Adrian war völlig aus dem Gleichgewicht gebracht, aber der Zorn, der sich in ihm aufstaute, entlud sich dann auf seinen Vater.
»Wenn du eine arrogante Bemerkung über Susanne machst, zu wem auch immer, dann kannst du sehen, wie du aus deinem Dilemma herauskommst«, sagte er. »Ich werde meinen Lebensunterhalt selbst verdienen können bei meinem Schwiegervater. Und falls die Almassys sich hinter dich stecken sollten, kannst du ihnen sagen, daß Tatjana erst einmal Benehmen lernen soll. Ich kusche nicht mehr, Vater.«
»Ich weiß überhaupt nicht, was das bedeuten soll«, murmelte der Ältere. »Ich habe mich mit Dittmar ausgezeichnet unterhalten. Zur Hochzeit wird sogar die Fürstin Ravensport kommen. Wie Susannes Mutter das fertiggebracht hat, weiß ich zwar nicht, aber es macht sie gesellschaftsfähig.«
»Ich glaube, daß dreißig Jahre, wenn nicht mehr, an dir spurlos vorübergegangen sind, Vater«, sagte Adrian. »Wir haben nur einen Titel, die anderen haben Erfolg und Geld. Aber ich pfeife jetzt auf den Titel. Susanne nimmt mich auch so. Und ich will keine andere Frau, das laß dir gesagt sein.«
Und mit einem lauten Krach warf er die Tür ins Schloß, bevor sein Vater noch etwas sagen konnte. Aber der lachte vergnügt in sich hinein und genehmigte sich noch einen Piccolo. Es lief alles viel besser, als er gedacht hatte. Er konnte ja nur hoffen, daß es mit dieser Heirat klappen wurde, denn Vinzenz Dittmar hatte ihm seine Pläne mit dem Grundstück am See entwickelt. Er hatte sich bereit erklärt, diese zu unterstützen, nachdem Vinzenz ihm gesagt hatte, daß er ihn am Gewinn beteiligen würde.
*
Nun wird Susanne heiraten, und sie wird auch nicht glücklich werden, dachte Melanie. Ich muß mich dazu aufraffen und mit Vinzenz ein ernstes Wort reden, bevor es zu spät ist.
Aber war es nicht schon zu spät? Susanne schwebte doch auf rosaroten Wolken, und letztlich würde sich der Zorn ihrer Tochter nur auf sie richten, wenn sie da einen Wurm hineinbrachte.
Also werde ich ein traumhaftes Brautkleid nähen lassen und selbst Hand dabei anlegen, dachte Melanie. Und ich werde alles tun, daß diesen arroganten Cordes die Augen übergehen. Solche erlauchte Gesellschaft wie ich werden sie nicht zusammenbringen, und schließlich sind es immer die Brauteltern, die die Hochzeit ausstatten.
Wenigstens das sollte ihr eine Genugtuung verschaffen, auch Vinzenz gegenüber. Auf die Fürstin Ravensport konnte sie sich verlassen, mit der lieben Heliane stand sie auf du und du.
Man konnte wohl sagen, daß Melanie Dittmar das Ziel, das sie sich gesetzt hatte, auch erreicht hatte. Vinzenz hatte umsonst gehofft, daß sie reumütig zurückkehren würde. Und er grollte, weil sie ihm das angetan hatte.
Mehrere Versuche hatte Susanne unternommen, um ihre Eltern zu versöhnen, aber da war sie bei ihrem Vater auf Granit gestoßen, obwohl er ihr sonst wahrhaft jeden Wunsch erfüllte.
Sie pendelte zwischen den Eltern hin und her, verteilte ihre Liebe aber gleichmäßig, machte aber doch ganz kleine Unterschiede. Der Paps tat ihr leid, weil er oft doch recht unglücklich wirkte, die Mami erregte nur ihre Bewunderung, weil sie so souverän ihr Leben meisterte und sich gesellschaftliches Ansehen geschaffen hatte.
Dies alles spielte für Susanne schon eine Rolle, aber sie hatte sich dennoch ihre mädchenhafte Natürlichkeit bewahrt, auch ihren gesunden Menschenverstand. Seit dieser Begegnung mit Tatjana von Almassy sah sie jedoch ihre Beziehung zu Adrian in einem etwas anderen Licht. Ja, sie ahnte, daß es doch so manche Konflikte geben könnte, doch sie konnte nur staunen, daß Adrian sich jetzt viel aufmerksamer zeigte, daß er sie jeden Tag treffen wollte. Er überraschte sie sogar mit der Nachricht, daß sein Vater vorgeschlagen hätte, das Treffen mit Melanie in seinem Hause zu arrangieren.
»Dafür ist es zu spät«, sagte Susanne. »Meine Mutter hat bereits alles vorbereitet. Sie hat auch die Fürstin Ravensport eingeladen.«
Das allerdings war für Baron Aribert ein Grund, keine Unpäßlichkeit vorzuschützen. Er fand es sehr erstaunlich, daß eine Fürstin Ravensport mit einer einfachen Melanie Dittmar, die er spöttisch als Näherin bezeichnet hatte, so gut bekannt war.
Und so war das Wochenende herangerückt. Susanne war schon nachmittags zu ihrer Mutter gefahren, die eine herrliche Dachterrassenwohnung ihr eigen nannte, die eine noch exklusivere Ausstattung hatte als Vinzenz Dittmars Haus.
Melanie hatte für diesen Abend für Susanne und sich Traumkleider arbeiten lassen, von so schlichter Eleganz, daß dem Baron die Augen übergehen sollten.
Adrian hatte dem Abend mit einiger Aufregung entgegengeblickt. Er hatte Melanie bisher nur einen kurzen Besuch im Atlier abgestattet, natürlich in Begleitung von Susanne. Die Wohnung kannte auch er noch nicht.
Seinem Vater gingen tatsächlich die Augen über, nicht nur über diese kostbar eingerichtete Wohnung, sondern auch über Melanies Erscheinung, die man auch fürstlich nennen konnte.
Neben ihr wirkte die echte Fürstin farblos. Allerdings konnte man sie auch nicht schön nennen. Sie war kleiner als Melanie und rundlich, hatte helles graublondes Haar und sehr helle Haut. Aber sie war eine humorvolle Frau, der es Spaß machte, den Baron Aribert in manche Verlegenheit zu bringen. Und sie hatte mit Melanie auch einiges ausgetüftelt, was beide Cordes’ in Unruhe versetzte.
»Ja, da dachte ich, daß Susannchen meine Schwiegertochter werden würde«, sagte sie mit einem verschmitzten Lächeln, »aber nun ist der junge fesche Adrian meinem schwerfälligen Hubertus zuvorgekommen.«
Susanne geriet in gewaltige Verlegenheit, denn sie wußte, daß Hubertus sein Herz längst verloren hatte, aber sie schaltete schnell und merkte am Augenzwinkern der Fürstin, daß diese sich eines ihrer Späßchen erlaubte.
Und gelassen fuhr die Fürstin fort: »Zur Hochzeit wird die ganze Familie Ravensport erscheinen. Unserer lieben Freundin Melanie können wir diese Bitte doch nicht abschlagen.«
»Ich freue mich darüber sehr«, sagte Susanne rasch.
»Wir wissen diese Ehre zu schätzen«, beeilte sich der ältere Cordes zu sagen.
»Meine Tochter Annette freut sich schon darauf, Susannes Brautjungfer zu sein, aber Sie werden sich aus Ihrem Bekanntenkreis noch eine zweite dazu ausersehen haben.« Hoffentlich treibt die gute Claire es nicht auf die Spitze, dachte Melanie da besorgt.
»Ich wüßte wirklich nicht, wen wir da bitten könnten«, sagte nun Adrian.
»Vielleicht dachtest du an die Gräfin Almassy«, sagte Susanne da anzüglich.
»Aber nein!« widersprach er sofort.
»Das wäre auch nicht angebracht«, sagte die Fürstin. »Sie erfreut sich wahrhaft keines guten Rufes. Der Name allein macht es nicht.« O ja, sie konnte sehr spitz sein, und der Baron fiel von einer Verlegenheit in die andere.
»Wir werden alles noch überlegen«, sagte Melanie. »Es wäre mir nur sehr lieb, wenn Sie mir bald eine Liste der Gäste geben würden, die Sie einzuladen wünschen, Herr Baron.«
So hatte es sich Aribert nicht gedacht. Er sah sich ganz hübsch in die Enge gedrängt.
»Ich lebe ja sehr zurückgezogen«, sagte er reserviert, »aber Adrian wird sicher einige Freunde einladen. Gestatten Sie mir bitte die Frage, ob nicht Herr Dittmar die Hochzeit ausstatten wollte.«
»Susanne ist auch meine Tochter. Ich denke, wir werden uns einigen«, erwiderte Melanie. »Da Susanne die Mitgift von ihrem Vater bekommt, wird mir erlaubt sein, die Hochzeit auszustatten. Es ist ein wenig kompliziert, das mag Sie stören, Herr Baron.«
Es hatte ihn freilich gestört, aber um nichts in der Welt wollte er das jetzt zugeben. Und über die Mitgift sollte schon gar nicht gesprochen werden. Doch so weit ging Melanie dann doch nicht.
Susanne wollte über Nacht bei ihrer Mutter bleiben. Adrian fragte, ob er sie dann zu einem Ausflug abholen dürfe.
»Ich habe Melanie und Susanne schon zu mir eingeladen«, warf die Fürstin rasch ein. »Aber es würde mich freuen, wenn Sie mitkommen würden.«
»Wenn ich nicht störe«, sagte Adrian stockend.
»Aber nein. Bei uns geht es ganz unkonventionell zu. Wir gehen mit der Zeit«, sagte Claire hintergründig. »Es darf gespielt und gelacht werden.«
Nun, genügend kalte Duschen hatte Baron Aribert bekommen. Er war recht schweigsam auf der Rückfahrt.
»Ich bin sehr froh, daß der Hochzeitstermin schon festgesetzt ist«, sagte er, als sie zu Hause angekommen waren. »Hubertus könnte eine ernsthafte Konkurrenz sein.«
»Davon hatte ich keine Ahnung«, sagte Adrian düster. »Ich glaube auch nicht, daß Susanne sich für ihn interessiert hat.«
»Habe ich meine Sache gut gemacht?« fragte die Fürstin lächelnd.
»Hubertus hat sich doch nie für mich interessiert«, sagte Susanne verlegen. »Er hat doch Rosemarie.«
»Aber der alte Cordes hat das Zittern gekriegt«, freute sich Claire. »Du liebe Güte, der erstarrt ja noch in Etikette. Eine fröhliche Jugend hat Adrian wohl nicht gehabt. Aber ich muß sagen, daß er mir besser gefällt, als ich dachte.«
Susanne legte den Kopf zurück. »Ich heirate ihn, weil ich ihn liebe, nicht weil er ein Baron ist«, sagte sie.
Der Fürstin lag es auf der Zunge zu sagen, daß sie dann froh sein könne, die Tochter eines reichen Vaters zu sein, aber sie unterließ es.
»Ein bißchen eifersüchtig darf er ruhig werden«, meinte sie. Und dagegen hatte auch Susanne nichts einzuwenden.
*
Der Sonntag zeigte sich von seiner besten Seite. Ein wolkenloser Himmel, strahlender Sonnenschein und ein leichter, frischer Wind verlockten auch die Familie Norden zu einem Ausflug.
Ein einsamer Sonntag stand Vinzenz Dittmar bevor, und das behagte ihm gar nicht.
Ich werde Susanne jetzt ganz verlieren, dachte er trübsinnig. Und das finanziere ich auch noch.
Und weil er nichts Besseres zu tun wußte, faßte er den Entschluß, das Seegrundstück zu inspizieren, durch das die Verbindung zwischen Adrian und Susanne eigentlich erst zustande gekommen war. Baron Cordes hatte sich zum Verkauf entschließen müssen, um sich einigermaßen über die Runden zu bringen. Interessenten hatte es genug gegeben, aber keiner hatte den Preis zahlen wollen, den er forderte.
Aber dann hatte Adrian den Bauunternehmer Dittmar aufgesucht, und dabei hatte er Susanne kennengelernt. Ja, so hatte es angefangen.
Und da war nicht nur das Seegrundstück, sondern es gab auch noch einige Wiesen und Felder, die aus Mangel an Arbeitskräften nicht mehr bestellt werden konnten.
Vinzenz Dittmar hatte das große Geld gemacht, weil er der Zeit und ihren Gegebenheiten immer voraus gewesen war. Er hatte den besagten guten Riecher für erfolgreiche Unternehmungen.
Es war ihm ganz willkommen gewesen, daß Susanne sich Hals über Kopf in Adrian verliebt hatte. Von sich aus hätte er die Verbindung doch nicht forciert, aber gewundert hatte es ihn auch, daß selbst der alte Cordes keinen Widerspruch erhob. Nun wußte er ja warum. Cordes stand vor dem Nichts. Er war kein Geschäftsmann, und er hatte anscheinend auch die falschen Berater gehabt.
Wer diese waren, wußte Vinzenz Dittmar inzwischen auch, und er konnte es sich ausrechnen, daß diese den Baron kräftig übers Ohr hauen wollten.
Es handelte sich um den Freiherrn von Kettelau und den Gründstücksmakler Arno Steffens, der Vinzenz wegen krummer Geschäfte wohlbekannt war. Sie hatten Cordes eingeredet, daß die Wiesen und Felder niemals zum Bauland deklariert werden würden.
Wenn Vinzenz Dittmar jetzt Zweifel kamen, dann nur deshalb, ob man nicht auch Susanne als Mittel zum Zweck betrachtete. Und ihm war auch der Gedanke gekommen, ob Melanie diesbezüglich nicht doch den besseren Riecher hatte.
Dieser Gedanke war ihm gekommen, als Susanne ihn am Morgen angerufen hatte, um ihm zu sagen, daß sie bei der Fürstin Ravensport eingeladen wären.
Und er marschierte jetzt allein durch die Gegend, am See entlang.
Was hier entstehen sollte, würde einmalig sein. Er hatte die Pläne im Kopf. Er hegte keinen Zweifel, daß sie genehmigt würden. Er setzte sich auf einen Baumstumpf und genoß den herrlichen Blick, und dabei wurde ihm ein wenig wohler.
Doch da vernahm er leise Stimmen. »Das ist das Grundstück, Tatja«, sagte eine Männerstimme. »Damit hat sich Dittmar den adligen Schwiegersohn nämlich erkauft.«
Vinzenz kochte schon innerlich, aber er war nicht mehr so impulsiv wie früher. Er hatte es auch gelernt, diplomatischer zu werden. Melanie hatte früher immer an ihm bemängelt, daß er zu schnell und zu heftig reagierte, wenn er sich angegriffen fühlte.
»Ich werde schon dafür sorgen, daß sie keine Freude an ihm hat«, sagte die helle Frauenstimme mit einem höhnischen Lachen. »Er soll sie nur richtig ausnehmen, und dann sind wir am Drücker, Brüderchen. Wenn ich deiner Unterstützung sicher sein kann, brauchen wir auch nicht lange zu warten. Jetzt werden wir den guten Aribert aufsuchen und ihn weichklopfen, damit wir zur Hochzeit eingeladen werden.«
Die Stimmen entfernten sich. Vinzenz blieb ruhig sitzen. Einen dankbaren Blick schickte er zum Himmel empor.
»Meinst es doch nicht übel mit mir, lieber Gott«, brummte er vor sich hin, als er sich langsam erhob. »Der Herr Baron wird mich noch kennenlernen. Dem wird seine Arroganz noch vergehen. Mal sehen, was mein zukünftiger Schwiegersohn sagt, wenn ich ihnen die Daumenschrauben ansetze.«
Dann wollte es der Zufall, daß er die Familie Norden traf, die sich ebenso wie er anschickte, in dem hübsch gelegenen Seerestaurant »Ulmenhof« eine Kaffeepause einzulegen.
Die Nordens hatten noch einen freien Tisch entdeckt. Vinzenz hielt vergebens Umschau.
»Hallo, Herr Dittmar, nehmen Sie doch hier Platz«, rief ihm Daniel Norden zu. »So ganz allein unterwegs?«
»Das kommt davon, wenn man die Tochter teilen muß«, murmelte Vinzenz. »Ja, wenn Sie gestatten, eine so reizende Familie, da kann einem das Herz aufgehen.«
»Hast du keine?« fragte Anneka sogleich mitleidvoll. Süß sah sie wieder aus in ihren Kniehosen und dem Trachtenjanker, und ganz das Ebenbild ihrer bezaubernden Mutter war sie jetzt schon.
»Freut mich, Sie auch mal wiederzusehen, Frau Dr. Norden«, sagte Vinzenz und küßte ihr die Hand.
»Hast auch keine Bazillen?« fragte Felix, und damit brachte er alle zum Lachen.
Es sollte für Vinzenz Dittmar doch noch ein paar fröhliche Stunden geben an diesem Tag, der ihn so trübsinnig gestimmt hatte. Und er dachte daran, wie schön es wäre, so lebhafte, reizende Enkel zu haben, wie es die Norden-Kinder waren. Und wie schön es auch gewesen wäre, wenn Melanie ihn nicht verlassen hätte.
Aber als sie sich dann verabschiedet hatten, mußte er doch wieder an das Gespräch denken, das er belauscht hatte.
*
Auf dem Schlößchen Ravensport war es fröhlich zugegangen. Zurückhaltend war anfangs nur Adrian gewesen, aber als Hubertus für eine Stunde verschwunden war und dann mit einem aparten jungen Mädchen zurückkam, taute auch er auf.
Das Mädchen hieß Beatrice von Degen und verbreitete sogleich heiterste Laune.
»Hubs hat gesagt, daß ihr möglicherweise noch eine Brautjungfer brauchen könntet«, erklärte sie ohne lange Vorrede. »Ich wäre gern bereit, wenn ihr nichts Besseres findet.«
Es herrschte wirklich ein unkonventioneller Ton auf Schloß Ravensport, davon hatte sich Adrian längst überzeugen können.
»Mich würde es freuen«, sagte Susanne, aber sie sah Adrian an.
»Es wäre reizend. Dann brauchen wir nur noch einen Brautführer für Rosmarie«, sagte er.
»Den könnte ich schon bringen, falls Mama einverstanden ist«, erklärte Rosmarie.
»Du meinst Robin?« fragte die Fürstin. »Nun, wenn er nicht ausgerechnet in Jeans erscheint, würde Melanie wohl einverstanden sein. Ich habe nicht das letzte Wort, Rosmarie.«
Melanie lachte. »Aber ihr helft alle sehr hübsch mit. Wenn du dich dann noch des Barons annehmen würdest, Claire?« Das schwierigste Problem war ja noch nicht gelöst.
»Der wird natürlich dein Tischherr sein«, meinte Claire lächelnd, »und ich werde mich neben den guten Vinzenz placieren, falls er nicht schon anders entschieden hat.«
Susanne blickte errötend auf. »Ich glaube nicht, daß Paps darüber nachdenkt. Ich weiß nicht, wer von euren Freunden kommt, Adrian.«
»Von mir aus niemand«, erwiderte er. »Ich habe keine Freunde.«
»Jetzt hast du welche«, sagte Hubertus in seiner ruhigen Art.
»Dafür bin ich euch sehr dankbar«, sagte Adrian leise. »Warum sollten wir zur Hochzeit auch Leute einladen, die uns völlig gleichgültig sind.«
Melanie sah ihn überrascht an, Claire horchte auf. Sie ergriff das Wort. »Das finde ich auch«, sagte sie. »Und nun genug davon. Genießt den schönen Tag.«
Rosmarie blieb bei den beiden Müttern sitzen und blinzelte ihnen schelmisch zu, als die zwei Paare entschwanden.
»Adrian scheint darauf zu brennen, allein mit Susi zu sein«, sagte sie. »Aber so skeptisch brauchst du nicht zu sein, Melanie. Er hat bloß eine etwas verkorkste Erziehung genossen. Bei dem Vater ja kein Wunder. Mama hat uns schon erzählt, was er für ein Hagestolz ist.«
»Reden wir jetzt mal darüber, was die Brautjungfern tragen wollen«, schlug Melanie ablenkend vor. »Schließlich will der Salon Melanie Ehre einlegen.«
»Sag nur, daß wir die Kleider gestellt bekommen«, rief Rosmarie aus.
»Das gehört doch dazu«, sagte Melanie. »Mein Verflossener soll doch einmal sehen, was bei mir produziert wird. Also überlegen wir mal. Viel Zeit haben wir ja nicht mehr «
Sie dachte jetzt jedenfalls nicht mehr daran, daß diese Hochzeit doch nicht zustande kommen würde, aber sie ahnte nicht, was Adrian jetzt Susanne sagen wollte und dann auch sagte.
»Es ist besser, wenn ich dir alles sage, Susanne«, fing er stockend an. »Du hättest wirklich eine bessere Partie machen können, als mich zu nehmen.«
»Wieso denn das?« fragte sie unbefangen.
»Hubertus«, sagte er rauh. »Seine Mutter hat es doch gestern gesagt.«
»Und jetzt hast du seine zukünftige Frau kennengelernt«, meinte sie lächelnd. »Zweifelst du, daß er sie liebt?«
»Sie ist sehr nett, aber…«
»Kein Aber, Adrian. Die liebe Claire hat nur gescherzt. Sie wollte anscheinend deinen Vater ein bißchen auf den Arm nehmen. Ich verstehe mich gut mit Hubs, aber er hat das Glück gehabt, sich wenigstens in eine ›von‹ zu verlieben. So hätte es dein Vater für dich wohl auch lieber gesehen. Willst du das andeuten?«
»Ich möchte dir sagen, daß ich dich liebe, Susanne«, flüsterte er. »Aber ich will dir auch sagen, daß mein Vater dieser Verbindung auch nur zustimmte, weil dein Vater uns vor dem Ruin gerettet hat. Du sollst das wissen. Ich möchte, daß richtige Klarheit zwischen uns herrscht.«
Sie sah ihn nachdenklich an. »Du willst mir zu verstehen geben, daß auch für dich die materielle Seite dieser Liaison, so nennt man es doch wohl in euren Kreisen, maßgeblich war«, sagte sie bebend.
»Darf ich es dir erklären, Susanne?« fragte er gepreßt.
»Bitte«, sagte sie kühl.
»Ich sagte meinem Vater, daß Vinzenz Dittmar eine reizende Tochter hat. Ich sagte es eigentlich ohne jeden Hintergedanken, weil es mir so zumute war. Du kennst meinen Vater inzwischen. Ich dachte niemals daran, daß er positiv reagieren würde. Aber dann geschah das Unbegreifliche. Dann heirate sie doch, sagte er, und wir sind aus dem Dilemma heraus. Er sagte auch, daß es dein Vater sich schon etwas kosten lassen würde, einen Baron zum Schwiegersohn zu bekommen.«
»Und warum erzählst du mir das jetzt und gerade heute, Adrian?« fragte Susanne.
»Weil ich dich liebe, Susanne.«
»Nicht, weil die Ravensports zufällig mit Mami befreundet sind?«
»Daran habe ich nicht gedacht«, erwiderte er erblassend. »Gerade daran nicht. Ich möchte, daß du dich entscheidest, ob du trotzdem noch meine Frau werden willst, Susanne, ohne grandiose Hochzeit, ohne deinen reichen Vater im Rücken. Daß wir irgendwo, ohne Geld, irgendwo ein gemeinsames Leben beginnen könnten. Ich würde dir gern beweisen, daß ich arbeiten kann. Ich möchte nur, daß unser gemeinsames Leben ehrlich beginnt. Wenn du mich wirklich liebst, so, wie ich dich liebe, könnten wir es beweisen.«
»Jetzt muß ich aber wirklich erst mal gründlich nachdenken«, sagte sie staunend. »Du willst alles aufgeben?«
»Meinem Vater würde es ganz gut tun, wenn er erfahren würde, daß ich dich will und nicht das Geld deines Vaters.«
»Aber wie stellst du dir das vor, Adrian? Ich muß ehrlich gestehen, daß ich kein Leben in Armut verbringen möchte, da ich nun mal Vater und Mutter habe, die beide sehr betucht sind. Und du kannst mir auch so beweisen, wie ehrlich du es meinst.«
»Ich möchte, daß mein Vater eine Lektion bekommt, die seinen Hochmut zu Fall bringt. Natürlich gefällt es ihm jetzt, daß deine Mutter mit der Fürstin Ravensport befreundet ist, daß auf der Hochzeit sogar Hochadel vertreten sein wird. Er schwelgt in dem Hochgefühl, daß für ihn alles beim alten bleiben wird. Daß es noch viel besser ausschaut, als er sich ausgemalt hat. Und er meint, daß er mich genauso unter der Fuchtel behalten kann wie früher. Aber es wäre doch unser Leben, Susanne.«
»Es ist unser Leben«, wiederholte sie. »Und wie fangen wir es wirklich an, Adrian?«
»Ich weiß es noch nicht. Wir müssen es gemeinsam überlegen oder jeder für sich. Ich sage dir genau, wie es ist. Dein Vater kann mit einem Federstrich alles an sich bringen, was meinem Vater gehört. Ich bin sowieso ein armer Hund. Darüber mußt du dir auch klar sein. Aber die Wahrheit wollte ich dir nicht vorenthalten. Es liegt alles in deiner Hand, Susanne. Nur an einem darfst du nicht zweifeln: daß ich dich liebe, und daß ich nicht will, daß du dich getäuscht fühlst. Ich muß dir die Chance geben, die Verlobung zu lösen.«
Sie atmete tief durch. »Ich habe es ja geahnt, daß es Probleme gibt, aber ich habe gedacht, sie kämen durch diese Tatjana. Sag mir, was für eine Rolle sie in deinem Leben gespielt hat, Adrian.«
»Ihr Vater war ein Freund meines Vaters«, sagte er. »Ihr Onkel ist der Finanzberater von Vater. Ein Freiherr von Kettelau. Sie wollten uns verkuppeln, und wahrscheinlich war Tatjana damit auch einverstanden. Traust du mir einen so schlechten Geschmack zu?«
Sehr jung und verloren stand Susanne vor ihm. »Vier Wochen vor der Hochzeit«, seufzte sie. »Aber wie wäre es, wenn wir ausbrechen?«
»Ausbrechen?« wiederholte er fragend.
»Ich sage Paps, daß ich mir alles doch noch mal überlegen muß. Mami muß ich allerdings reinen Wein einschenken. Sie läßt sich nicht täuschen, aber sie macht bestimmt mit. Ich fahre irgendwohin, und wenn du mit deinem Vater klarkommst und immer noch der Meinung bist, daß ich mehr wert bin als Papas Geld, dann kommst du auch. Aber vielleicht hat er dann bereits eine andere Frau im Visier, die euer Hab und Gut retten könnte. Rosmarie zum Beispiel.«
Sie sagte es leichthin, aber doch nicht absichtslos. »Ideen hast du«, murmelte er.
»Ich bin die Tochter eines Bauunternehmers. Ich scheue kein Risiko«, erwiderte sie.
»Du traust mir nicht, Susanne«, sagte er gequält.
»Dann würde ich jetzt nicht mehr hier bei dir stehen«, sagte sie leise. »Ich liebe dich, Adrian, ich sage es noch einmal. Aber wenn ich erleben müßte, daß nichts davon bleibt, was mich so glücklich gemacht hat, gehe ich wirklich auf Nimmerwiedersehen. Das soll auch klar gesagt sein. Ich will nichts anderes als dich, aber dich will ich ganz und dafür wollte ich auch kämpfen.«
»Das brauchst du nicht, mein Liebstes«, sagte er leise. »Du darfst nie denken, daß ich nur tue, was mein Vater will.«
»Davor hatte ich schon ein bißchen Angst«, gab sie zu.
»Ich möchte nicht mit ihm unter einem Dach wohnen.«
»Das möchte ich auch nicht«, sagte er. »Und wenn mein Vater es will, wird er sich schnellstens nach einer neuen Bleibe umsehen müssen.«
Sie sah ihn forschend an. »Darauf würdest du es ankommen lassen, Adrian?«
»Gib mir die Chance, es dir zu beweisen, Susanne.«
»Dann werde ich noch heute mit meinem Vater sprechen.«
»Und ich mit meinem«, sagte Adrian.
»Wo treffen wir uns morgen?« fragte sie mit einem schelmischen Lächeln.
»Wo du willst.«
»Wir haben ein Häuschen in Tirol. Ich werde Paps sagen, daß ich mich dorthin zurückziehen will, um alles noch mal zu überdenken. Ich werde dort auf dich warten.«
Er nahm sie in die Arme und küßte sie. »Ich danke dir, Susanne«, sagte er leise.
*
»Nun, was habt ihr so Ernstes besprochen?« fragte Melanie.
»Sieht man es mir an, daß es ernst war, Mami?« fragte sie.
»Du bist sehr nachdenklich.«
»Vielleicht habe ich heute zum ersten Mal ganz richtig gespürt, daß Adrian mich liebt«, erwiderte Susanne. »Dennoch haben wir beschlossen, uns bis zur Hochzeit überhaupt nicht mehr zu sehen. Ich werde nach Tirol fahren.«
»Aber es gibt doch noch so viel zu besprechen, Susi«, widersprach Melanie.
»Das wirst du schon alles allein arrangieren und meine Maße für das Brautkleid sind dir wohlbekannt.«
»Bist du ganz sicher, daß du ihn heiraten willst?« fragte Melanie nachdenklich.
»Ihn oder keinen, Mami. Du brauchst keine Sorge zu haben. Die Hochzeit findet bestimmt statt.«
»Und was wird Vinzenz sagen, wenn du dich in die Einsamkeit zurückziehen willst?«
»Ich komme mit Paps gut aus und frage mich manchmal, warum du nicht auch mit ihm auskommen konntest.«
»Ich wäre mit ihm ausgekommen, wenn er mir gewisse Freiheiten eingeräumt hätte. Aber ich wollte nicht nur von seinem Geld leben, nicht das Gefühl haben, daß er nur für mich so schuftet.«
»Nach eurer Scheidung hat er noch mehr geschuftet, Mami.«
»Für dich. Damit es dir gutgeht. Damit du es dir letztlich auch leisten kannst, einen bankrotten Adligen zu heiraten«, platzte Melanie heraus.
»Gut, daß du es so sagst, Mami. Vielleicht sollten wir die vornehmen Hochzeitsfeierlichkeiten abschreiben, mit denen du dir ja auch nur eine Genugtuung verschaffen willst.«
»Wie kannst du das sagen!« brauste Melanie auf. »Das tue ich doch nur für dich.«
»Nicht auch, um dieser Gesellschaft zu beweisen, daß wir auch was sind? Mir kommt es nicht darauf an. Ich liebe Adrian, und er liebt mich. Und vielleicht war ich wirklich lange genug die verwöhnte Tochter. Ihr beide, du und Paps, wolltet euch doch immer gegenseitig überbieten, um eine Prinzessin heranzuzüchten. Es scheint so, als sei Adrian bereit, mehr für mich aufzugeben, als ich für ihn.«
»Was kann er schon aufgeben«, sagte Melanie. »Dein Vater hat doch schon alles bezahlt.«
»Und wenn ich ihm heute abend das genauso sage, kann er Adrian und seinen Vater vor die Tür setzen. Nämlich dann wird er es tun, wenn ich ihm erkläre, daß Adrian mich unter diesen Vorraussetzungen nicht heiraten will.«
»Unter welchen wohl sonst?« fragte Melanie.
»Unter der Voraussetzung, daß wir uns lieben und auf unsere Väter keine Rücksicht nehmen, nicht auf den reichen und nicht auf den adelsstolzen.«
»Das fällt dir spät ein, Susi«, sagte Melanie.
»Du warst ein Dutzend Jahre mit Paps verheiratet, bis dir eingefallen ist, daß du nicht von ihm abhängig sein willst. Wir wollen nicht von unseren Eltern abhängig sein.«
Solche Wahrheiten hörte Melanie nicht gern, aber sie begriff endlich auch, daß Susanne kein kleines Mädchen mehr war, daß sie tatsächlich wußte, was sie wollte.
»Also gut, reden wir deutsch«, sagte sie. »Wovon wollt ihr leben, wenn ihr ohne Hilfe anfangen wollt?«
»Wir können beide Geld verdienen. Wie habt ihr denn angefangen, du und Paps?«
»Immerhin war dein Vater immer ein tüchtiger Mann«, sagte Melanie.
»Freut mich zu hören, daß du es zugibst. Ich glaube, daß Adrian auch ein tüchtiger Mann ist.«
»Warum ist dann alles in den Graben gegangen?«
»Weil sein Vater das Sagen hatte. Und er brauchte bisher wirklich niemandem zu beweisen, was in ihm steckt.«
»Aber dir will er es beweisen«, sagte Melanie spöttisch.
»Du hast es erfaßt, Mami«, sagte Susanne.
»Auf das Ergebnis bin ich gespannt«, murmelte Melanie. »Wenn du ihn schon so liebst, rede ich dir nicht drein, aber wozu dann dieser Blödsinn mit der Trennung?«
»Es ist kein Blödsinn«, sagte Susanne. »Du kannst ja Paps fragen, wie Adrian sich verhält.«
»Und das werde ich, mein Kind«, sagte Melanie aggressiv.
»Zügele dein Temperament, Mami. Paps ist sehr diplomatisch geworden«, sagte Susanne anzüglich.
»Jedenfalls bin ich stolz auf euch. Ihr habt es beide weit gebracht, und ich habe davon auch profitiert. Keiner von euch hat je verlangt, daß ich mich selbst auch mal beweise. So leicht mache ich es meinen Kindern wirklich nicht.«
Melanie war sprachlos. Sie hatte dann viel Zeit, über diese Worte nachzudenken.
*
»Guten Abend, Paps«, begrüßte Susanne ihren Vater, der vor dem Fernsehapparat saß und eine Weinflasche neben sich stehen hatte. »Mußt du den Quatsch sehen, oder können wir miteinander reden?«
»Es war niemand da, mit dem ich reden konnte«, brummte er.
»Jetzt bin ich da«, sagte Susanne.
»Zurückgekehrt aus der vornehmen in unsere bescheidene Welt«, sagte er sarkastisch.
»Na, gar so bescheiden ist sie nicht und wir haben den Pleitegeier wohl nicht im Nacken.«
»Wie kommst du darauf?« fragte er erschrocken.
»Ich habe nachgedacht, Paps. Ich will es jetzt genau wissen.«
»Was?«
»Ob Adrian mich auch dann heiraten wird, wenn du den Besitz kassierst, ohne meine Wenigkeit als Gegengabe zu präsentieren.«
Entsetzt sah er sie an. »Wie kannst du so reden und denken, Susanne! Ich will doch nur dein Glück. Ich weiß, daß du Adrian liebst, und ich schätze diesen jungen Mann.«
»Aber nicht seinen Vater. Sei doch ehrlich, Paps. Der alte Baron hat das Geschäft mit dir gemacht, das Geschäft seines Lebens. Aber Adrian hat damit nichts zu tun.«
»Er will ja in mein Unternehmen eintreten, Susi«, sagte Vinzenz Dittmar rauh.
»Als was?«
»Als Repräsentant, das habe ich ihm angeboten.«
»Der Baron von Cordes, und wahrscheinlich wirst du es sehr gern sagen, daß er dein Schwiegersohn ist. Gib ihm eine andere Chance, Paps.«
»Ich verstehe überhaupt nichts mehr.«
»Ich werde es dir erklären. Ich liebe Adrian.«
»Das weiß ich ja. Meinst du, ich würde irgend jemand großzügig aus der Misere helfen? Nein, dazu habe ich mein Geld zu hart verdient. Ich will dein Glück.«
»Dazu kannst du eher beitragen, wenn du Adrian eine wirklich reelle Chance gibst, Paps. Leider bin ich ja so verwöhnt, daß ich nicht weiß, wie ich selbst Geld verdienen sollte, obgleich ich das gerne lernen will. Aber du kannst Adrian eine Arbeit geben, mit der er ehrliches Geld verdienen kann. Und seinem Vater kannst du sagen, daß ich es mir nochmals überlegen will, ob ich Adrian heiraten werde.«
»Das willst du?«
»Ich werde mich in die Einsamkeit unseres Ferienhauses zurückziehen und alles überdenken.«
»Obgleich der Hochzeitstermin schon festgesetzt ist?«
»Schon manche Hochzeit ist nicht zustande gekommen«, sagte Susanne leichthin.
»Damit habe ich wirklich nicht gerechnet!« stöhnte er. »Hast du auch mit deiner Mutter darüber gesprochen?«
»Ja.«
»Und was sagt sie?«
»Sie wird selber mit dir reden. Was Adrian betrifft, so kann ich dir schon sagen, daß er wahrscheinlich eben jetzt seinem Vater erklären wird, daß er mich nicht heiratet.«
»Das ist eine Schweinerei, und du verlangst, daß ich ihm eine Chance gebe?«
»Er will mich ja heiraten, aber das Abkommen, das die Väter getroffen haben, akzeptieren wir nicht. Setz den Baron Aribert aus dem Haus. In deiner grenzenlosen Großzügigkeit kannst du ihm ja auch noch ein Zehrgeld für die nächsten zwei Jahre geben. Aber er soll mal von seinem hohen Thron heruntersteigen.«
Vinzenz starrte seine Tochter an. »Und du meinst, daß Adrian damit einverstanden wäre?«
»Genau das meine ich«, sagte Susanne. »Welche Klausel gibt es in eurem Abkommen?«
»Davon verstehst du doch nichts«, sagte er.
»Heraus mit der Sprache, Paps. Ich will es wissen.«
»Ich zahle am Tag nach der Hochzeit«, erwiderte er stockend.
»Und wenn die Hochzeit nicht zustande kommt?«
»Dann kann er sich einen anderen Geldgeber suchen. Bist du nun zufrieden?«
»Ich bin dir viel wert«, sagte Susanne ruhig. »Etwas zuviel, Paps, denn verkaufen wollte ich mich nie. Oder besser gesagt, verkaufen lassen, denn es ist ja dein Geld!«
»Für wen habe ich denn gearbeitet? Zuerst für deine Mutter und dann nur für dich. Und ewig werde ich nicht leben. Mein Gott, ich weiß doch, wie vernarrt du in Adrian warst, und ich verstehe nicht, warum es plötzlich anders ist.«
»Weil Adrian mich genauso liebt wie ich ihn. Das ist es, Paps, und niemand soll denken, daß er die Bürgerliche nur nimmt, weil ihr Vater Geld hat. Ich bin nicht in ihn vernarrt. Ich liebe ihn.«
In dem markanten Gesicht ihres Vaters arbeitete es. »Wann willst du dich in die Einsamkeit zurückziehen?« fragte er.
»Morgen.«
»Dann tue es und überlaß alles andere mir. Aber wenn du dich in deinem Adrian getäuscht hast, wird er kein Bein mehr auf die Erde bringen, daß schwöre ich dir, so wahr ich Vinzenz Dittmar heiße.«
»In solchem Fall würde ich dir sogar dankbar sein, Paps«, sagte Susanne.
*
Die Aussprache zwischen Vater und Sohn Cordes verlief ganz anders.
»Da bist du ja«, wurde Adrian empfangen. »Dann können wir ja noch die Liste für die Hochzeitsgäste durchsprechen. Ich habe sie zusammengestellt.«
»Du hast dich also doch entschlossen, einige deiner Freunde einzuladen, Vater«, sagte Adrian erstaunt.
»Deiner und meiner Freunde. Sie werden zusagen, wenn sie hören, daß die Ravensports kommen. Allerdings können wir Tatjana und ihren Bruder Maximilian nicht ausschließen und auch nicht Kettelau.«
»Sehr aufschlußreich«, sagte Adrian. »Wer hat dich bearbeitet, Vater? Ich nehme an, daß es Tatjana war. Für ihre Mutter hattest du ja auch schon immer sehr viel übrig. Sie wird natürlich auch kommen. Aber lassen wir das, vielleicht kommt es nicht zur Hochzeit.«
»Bist du übergeschnappt?« brauste der Baron auf. »Du weißt doch ganz genau, was das für uns bedeuten würde. Dittmar hat uns bereits in der Hand.«
»Und ich will nicht, daß Susanne denkt, ich würde sie nur deshalb heiraten. Ich liebe sie«, sagte Adrian.
»Liebe, fang doch nicht damit an. Unsere Existenz, unser Ruf steht auf dem Spiel. Wir sind am Ende, wenn du jetzt einen Rückzieher machst.«
»Dieses Risiko gehe ich ein. Und du wirst erleben, wie interessant du für die Almassys noch bist, wenn du keinen anderen Geldgeber findest. Ich habe dieses elende Geschäft satt. Und diese Liste kannst du dir hinter den Spiegel stecken. Ich würde niemals dulden, daß Susanne brüskiert wird.«
»Darf ich fragen, was du tun willst?« fragte der Baron herablassend.
»Das, was du nie getan hast, und wozu ich auch nicht erzogen wurde, Vater. Ich werde arbeiten. Ich werde mich genauso emporarbeiten wie Vinzenz Dittmar, vor dem ich Hochachtung habe. Und du kannst dich mit den Almassys und Kettelaus zusammentun.«
»Und deine heißgeliebte Susanne zieht anscheinend Hubertus von Ravensport vor«, höhnte sein Vater. »So etwas habe ich schon geahnt.«
»Deiner Phantasie sind keine Grenzen gesetzt«, sagte Adrian. »Sieh zu, wie du mit Dittmar klarkommst. Ich fahre morgen weg.«
»Das kannst du nicht. Du mußt mit Dittmar verhandeln. Du mußt wenigstens noch herausschlagen, was möglich ist«, sagte der Ältere erregt.
»Es ist dein Geschäft«, sagte Adrian hart. »Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Unsere Wege trennen sich.«
»Du mußt Susanne heiraten. Ich habe doch nichts gegen sie, auch nicht gegen ihren Vater oder ihre Mutter. Gestern war doch alles in Ordnung, Adrian!« stieß der Baron hervor.
»Gestern war gestern, und heute ist heute. Es kann durchaus sein, daß die Hochzeit stattfindet, aber deine Freunde werden dabei ganz bestimmt nicht anwesend sein. Und du wahrscheinlich auch nicht, wenn du dich bis dahin nicht sehr geändert hast.«
»Adrian, du bist der letzte Cordes«, stieß sein Vater hervor. »Bedenke, was es mich an Überwindung gekostet hat, in diese Heirat einzuwilligen. Du kannst uns doch jetzt nicht blamieren.«
»Wer wollte denn wen blamieren?« fragte Adrian. »Diese Gästeliste verrät doch genug. Dazu hat man dich doch erpreßt. Ich frage mich nur womit? Wenn du mir darauf eine ganz ehrliche Antwort gibst, könnte es möglicherweise eine Verständigung zwischen uns geben.«
»Man ist alten Freunden doch verpflichtet«, sagte der Baron unsicher. »Ich fühle mich Tatjanas Mutter viele Jahre freundschaftlich verbunden.«
»War das nicht etwas mehr, Vater?« fragte Adrian eisig. »Du hast doch gehört, wie sich die Fürstin Ravensport über Tatjana geäußert hat.«
»Sie hat eine spitze Zunge.«
»Nun, die Einladungen kannst du vergessen«, sagte Adrian heftig.
»Darf ich vielleicht erfahren, was deinen Meinungsumschwung herbeigeführt hat?«
»Das darfst du. Ich liebe Susanne und will ihre Achtung nicht verlieren. Es gibt keinen anderen Grund.«
»Und dafür setzt du alles aufs Spiel, was unser Leben ausmacht? Du riskierst, daß wir alles verlieren?«
»Vielleicht solltest du dich fragen, was du in all den Jahren deines Lebens getan hast, um das zu erhalten, was dein Leben angeblich ausmacht. Warum ist es denn soweit gekommen?«
Und nach diesen Worten verschwand er. Er verbrachte eine unruhige, fast schlaflose Nacht, und als er es am nächsten Morgen gegen zehn Uhr versuchte, Susanne telefonisch zu erreichen, sagte ihm Erna, daß das gnädige Fräulein verreist sei.
Diese Titulierung gebrauchte Erna nur dem jungen Baron gegenüber. Sonst war es das Fräulein Susanne, für das sie alles zu tun bereit war. Sie hätte auch geschwindelt, wenn man es von ihr verlangt hätte, aber Susanne war tatsächlich schon am Morgen weggefahren.
Auch Vinzenz Dittmar hatte das Haus bald verlassen, aber er war nicht zu seinem Büro gefahren, sondern zur Praxis Dr. Nordens. Auch er hatte sich einen Plan zurechtgelegt. Was er da gestern auf seinem Ausflug erlauscht hatte, machte ihm schwer zu schaffen. Susanne hatte er davon nichts gesagt.
Er hatte sich etwas ausgedacht, um Zeit zu gewinnen, und die brauchte er jetzt, um herauszufinden, wie Adrian sich verhalten würde.
Dr. Norden war ziemlich überrascht, als Vinzenz ihm erklärte, daß er sich überhaupt nicht wohl fühle und sich deshalb entschlossen habe, sich so bald wie möglich einer klinischen Untersuchung zu unterziehen.
Dr. Norden sah eine solche zwar nicht als zwingend an, aber das sagte er nicht. Ein paar Tage Ruhe konnten Dittmar wahrhaftig nicht schaden. Er sah übernächtigt aus und sorgenvoll.
»Ja, dann packen Sie am besten gleich ein Köfferchen und begeben sich in die Behnisch-Klink«, sagte er. »In drei bis vier Tagen wissen wir dann ganz genau, wo es hapert. Solange wird es wohl auch mal ohne Sie gehen.«
»Das muß es wohl«, erwiderte Vinzenz, aber was er wirklich bezweckte, verriet er nicht. Das sollte Dr. Norden erst später erfahren.
Dr. Behnisch kam aber sehr bald zu der Überzeugung, daß dieser Vinzenz Dittmar ein ganz raffinierter Bursche war, denn kaum war ihm ein Zimmer zugewiesen worden, verlangte er schon, daß seine Frau verständigt würde, daß es ihm gar nicht gut gehe und er sie dringend zu sprechen wünsche.
Melanie fiel aus allen Wolken, als ihr dies mitgeteilt wurde.
Sollte es ihm so zugesetzt haben, daß Susanne sich selbst eine Bedenkzeit eingeräumt hatte? Hatte es gar Streit zwischen ihnen gegeben?
Jedenfalls wurde auch Melanie in eine Unruhe versetzt, die ihr jede Konzentration nahm. Sie machte sich sofort auf den Weg zur Behnisch-Klinik. Vinzenz hatte nach ihr gerufen. Es mußte schlimm um ihn stehen, wenn er das tat. Und genau diese Reaktion hatte Vinzenz Dittmar erreichen wollen.
Melanie würde rücksichtsvoll sein, wenn sie einen schwachen kranken Mann sah. Sie würde seiner Bitte Folge leisten, und er brauchte nicht zu ihr zu gehen, um den Eindruck zu erwecken, daß er zu Kreuze kriechen würde.
Ja, er hatte sich das gut überlegt und sich dabei auch eingestanden, daß er sich der Situation, die Susanne herausgefordert hatte, nicht gewachsen zeigte.
Melanie, die es nie für möglich gehalten hatte, daß Vinzenz krank werden könnte, bestürmte zuerst Dr. Behnisch mit aufgeregten Fragen.
»Ich kann gar nichts sagen, bevor die Untersuchungen nicht abgeschlossen sind«, erklärte der Arzt zurückhaltend. »Der Bluthochdruck gibt zu denken.«
»Er hat sich aufgeregt, ganz bestimmt hat er sich schrecklich aufgeregt«, sagte Melanie besorgt.
Vielleicht kommen diese beiden Kampfhähne dadurch wieder zusammen, dachte Dr. Behnisch, und meinte dazu, daß dies durchaus möglich sei.
»Er wird sicher mit Ihnen darüber sprechen«, meinte er mit einem unterdrückten Lächeln. »Es wäre nur nicht gut, wenn neue Aufregungen dazu kämen.«
»Ich werde ihn wie ein rohes Ei behandeln«, versprach Melanie. »Unter seinem dicken Fell steckt nämlich eine sehr empfindsame Seele.« Sie errötete bei diesen Worten und Dr. Behnisch blickte ihr schmunzelnd nach, als sie zu dem Krankenzimmer eilte.
Vinzenz setzte eine ganz entsagungsvolle Miene auf, als sie das Krankenzimmer betrat, aber man konnte sagen, daß er sich wirklich sehr elend fühlte, denn plötzlich wurde ihm ganz bewußt, welch ein Tor er gewesen war, sich von dieser Frau zu trennen und nicht den kleinsten Versuch zu machen, sie wieder für sich zu gewinnen. Schöner denn je erschien sie ihm, und wie sehr hatte er sie geliebt. Mit niemandem hatte er sie teilen wollen.
»So sehen wir uns wieder, Vinzenz«, sagte Melanie leise. »Ich bin sehr bestürzt. Ist Susannes Vorhaben schuld an diesem Zusammenbruch? Warum ist sie weggefahren, wenn es dir so schlecht geht? Das finde ich nicht richtig. So weit dürfte ihr Trotz nicht gehen.«
»Ich mache ihr keinen Vorwurf, Melanie. Sicher war es ein vernünftiger Entschluß, sich noch einmal auf Herz und Nieren zu prüfen. Immerhin ist diese Verbindung ja unter merkwürdigen Umständen zustande gekommen.«
»Aber sie liebt ihn, Vinzenz. Ich weiß, daß sie ihn liebt.«
»Sie liebt ihn, aber liebt er sie? Das ist doch das Problem. Ich muß dich um deine Hilfe bitten, Melanie, da ich jetzt nicht dazu in der Lage bin, sachliche Entscheidungen zu treffen. Es könnte ja sein, daß mein Herz einfach nicht mehr mitmachte, und dann könnte man leichtes Spiel mit Susanne haben.«
»Red jetzt nicht solchen Unsinn, Vinzenz«, sagte Melanie. »Du wirst von einem ausgezeichneten Arzt betreut. Du bist überarbeitet, das ist alles. Du hast dir doch auch nie Ruhe gegönnt.«
»Aber es ist ein Schreckschuß vor den Bug«, sagte er leise. »Man beginnt nachzudenken, Melanie. Man denkt über das nach, was man versäumt hat, über das, was man besser unterlassen hätte, und auch darüber, ob es sich gelohnt hat, reich zu werden. Ich bin dir sehr dankbar, daß du gekommen bist, denn ich möchte dich bitten, mir dabei zu helfen, daß unser Kind vor der bitteren Erkenntnis bewahrt wird, nur ihres Geldes wegen geheiratet zu werden.«
»Susanne ist kein Dummchen, sie weiß, was sie will«, sagte Melanie. »Man unterschätzt sie. Du siehst nur deine Alleinerbin in ihr, aber sie hat eine vernünftige Mutter.«
»Darauf baue ich ja«, sagte er. »Ich habe dich als Alleinerbin eingesetzt. Du wirst Adrians Vater erklären, daß sie keinen Cent bekommt, wenn sie Adrian heiratet. Du wirst ihm sagen, daß ich gestern ein Gespräch belauscht habe, das eine gewisse Tatja mit ihrem Bruder führte, und daß aus diesem hervorging, daß man unsere Susanne nur als ein Handelsobjekt betrachtet.«
Melanie hatte schon aufbegehren wollen, als er immer »du wirst« sagte, aber nun horchte sie auf.
»Das mußt du mir genau erzählen, Vinzenz«, sagte sie. »Aber reg dich bitte nicht auf. Ich will dich nicht beerben. Unsere Susanne braucht den Vater ebenso wie die Mutter.«
Sie griff nach seiner Hand, die jetzt tatsächlich zitterte, und als er sie dankbar anblickte, sagte sie: »Du bist ein schlauer Fuchs, Vinzenz, aber da es um Susannes Glück geht, werde ich mich für deine Pläne einspannen lassen.«
Ja, sie hatte ihn wieder einmal durchschaut, aber sie konnte ihm nicht böse sein. Er war jetzt ziemlich verlegen und suchte nach Worten, aber sie ließ ihn nicht zappeln. »Dann erzähle mal«, forderte sie ihn auf. »Zu schwach wirst du ja wohl nicht sein.«
»Immerhin beginnt man nachzudenken, wenn der Arzt ernsthaft warnt«, sagte er. »Es sind Warnzeichen.«
»Die Mahnung, sich etwas mehr Freizeit und Entspannung zu gönnen«, sagte sie nachsichtig.
»Mit fünfzig kann man sich noch nicht zur Ruhe setzen«, sagte er.
»Aber übertreiben braucht man es auch nicht«, sagte Melanie. »Gut, nehmen wir es als einen Schreckschuß. Und nun zu deinen Überlegungen.«
Da bekam sie dann jedoch etwas zu hören, was ihr wieder einmal klar machte, warum Vinzenz so erfolgreich geworden war. Er durchdachte alles bis ins kleinste. Aber es wurde ihr auch bewußt, daß er Susanne abgöttisch liebte.
»Ich soll also für dich die Kastanien aus dem Feuer holen«, sagte sie mit einem unergründlichen Lächeln.
»Nicht für mich, für Susanne. Du kennst mich doch, Melanie. Ich gehe dem Baron an den Kragen, wenn er dumme Reden schwingt. Du hast ihn doch kennengelernt.«
»Und ich habe dich überhaupt nicht verstanden, daß du Susanne verkuppeln wolltest, um an den Besitz zu kommen.«
»Susanne liebt Adrian«, sagte er leise.
»Ja, das weiß ich inzwischen auch, und anscheinend beruht die Zuneigung auf Gegenseitigkeit. Aber den Verstand hat Susanne nicht verloren. Anscheinend ist sie durch diese Tatjana von Almassy auch hellhörig geworden.«
Seine Augenbrauen schoben sich zusammen. »Du kennst den Namen?« fragte er heiser.
»Ich denke, daß es sich um die gleiche Person handelt. Tatja – Tatjana, die Meinung von meiner Freundin Claire über sie ist unzweideutig. Ich werde schon herausfinden, welches Intrigenspiel da getrieben wird und welche Rolle der stolze Aribert dabei spielt. Was Adrian betrifft, so habe ich meine Meinung über ihn geändert. Er ist ein anständiger Mensch. Wir werden ja sehen, was die beiden aus ihrer Ehe machen.«
»Du glaubst also, daß es zu einer Heirat kommt?« fragte er staunend.
»Ja, davon bin ich überzeugt, wenngleich diese unter etwas anderen Voraussetzungen zustande kommen wird. Nun erhole dich mal schön, damit wir bei der Hochzeit als versöhntes Elternpaar auftreten. Was aber nicht heißen soll, daß ich meinen eigenen Lebensbereich aufgebe, lieber Vinzenz«, fügte sie ironisch hinzu.
»Es hätte doch alles anders kommen können, Melanie«, sagte er seufzend.
»Wie denn? Unsere Interessen gehen zu weit auseinander«, erklärte sie ruhig.
»Aber wir haben doch auch mal eine Liebesheirat geschlossen.«
»Wobei dein Motto war, daß das Weib dem Manne untertan sein soll. Man entwickelt die eigene Persönlichkeit erst später. Vielleicht wird das bei Susanne auch so sein, obgleich ich den Eindruck habe, daß sie schon jetzt einen starken Willen entwickelt und Adrian momentan noch der Schwächere ist. Aber Heirat ist kein Pferdekauf und auch keine Lebensversicherung. Gehen wir es also ganz nüchtern an.«
»Ich bin dir jedenfalls dankbar, daß du gleich gekommen bist und mir deine Hilfe nicht versagst«, sagte er.
»Ich tue es für Susanne, für unsere Tochter, die ich nicht weniger liebe als du. Damit das klar ist«, fügte sie hinzu. »Und ich möchte dir auch sagen, daß ich es immer kindisch fand, daß du jedes Gespräch, jedes Zusammentreffen mit mir vermieden hast.«
»Ich habe nicht begriffen, warum es soweit kommen mußte«, sagte er bockig. »Und außerdem dachte ich auch, daß ein anderer Mann im Spiel ist.«
»Der Mensch denkt, und Gott lenkt«, sagte Melanie lächelnd. »Gute Besserung weiterhin, in jeder Beziehung!«
»Wirst du mich wieder besuchen, Melanie?« fragte er kleinlaut.
»Ich glaube nicht, daß du lange in der Klinik bleiben mußt«, meinte sie anzüglich, »aber du weißt ja, wo ich zu finden bin. Ich werde dich anrufen, wenn ich mit dem Baron gesprochen habe.«
*
Das wollte sie bald tun, aber nicht sofort, denn zuerst fuhr sie zu Dr. Norden. Wenn sie es auch nicht zugeben wollte, so machte sie sich jetzt doch Sorgen um Vinzenz’ Zustand. Nicht so sehr um seinen physischen als um seinen psychischen. Wenn ihm mal etwas so unter die Haut ging, konnte es schon in ihm zehren. Und daß er sie dann auch noch gebeten hatte, Susanne ja nichts davon mitzuteilen, daß er in der Klinik sei, verriet ihr, daß er damit auf keinen Fall bezweckt hatte, sie umzustimmen. Seiner Tochter wollte er die Freiheit der Entscheidung lassen, die er ihr einmal versagt hatte.
Stur waren wir damals beide, dachte sie auch in schönster Selbsterkenntnis. Aus einer Mücke haben wir einen Elefanten gemacht.
Wie viele Ehen mochten wohl auseinandergehen, weil beide Partner eigensinnig auf ihren Standpunkten beharrten, anstatt mit gegenseitiger Toleranz versuchten, die Konflikte aus der Welt zu schaffen.
Dann dachte sie an die Kommentare, die Susanne zu der Trennung gegeben hatte, und sie mußte unwillkürlich lächeln. So wäre es jedenfalls besser, als wenn sie sich ständig in den Haaren lägen wie andere Eltern, hatte sie erklärt. Und sie fände es auch toll, daß beide so tüchtig wären. Sie wäre aber wohl nicht einverstanden gewesen, wenn jeder sich einen anderen Partner gesucht hätte. Auch darüber dachte Melanie nach. Chancen hätten sie ja wohl beide genügend gehabt, aber es war die Liebe zu Susanne gewesen, die sie sich nicht hatte verscherzen wollen, die solche Überlegungen zunichte machten.
Dr. Norden war gerade eben im Begriff, sich auf den Heimweg zu machen, als Melanie nun in der Praxis erschien.
Donnerwetter, sieht sie blendend aus, war sein erster Gedanke. Dittmar muß es ja ewig bereuen, daß er es zum Bruch kommen ließ.
»Ich komme nicht als Patientin, lieber Dr. Norden«, sagte Melanie lächelnd. »Ich möchte von Ihnen nur wissen, was Vinzenz wirklich fehlt. Aber bitte, ganz ehrlich.«
»Der Streß, der hohe Blutdruck, mancherlei Sorgen, die ihn wohl plagen mögen«, erwiderte Dr. Norden. »Auf die leichte Schulter darf man das nicht nehmen. Ich bin ganz froh, daß er sich der Durchuntersuchung unterzieht. Ich habe ihm solche schon mehrmals empfohlen.« Und Dr. Norden hielt es in diesem Fall auch angebracht, alles ein bißchen ernster klingen zu lassen, als er es selbst betrachtete.
»Sie wollen sagen, daß es tatsächlich zu ernsten Folgen kommen könnte?« fragte sie erschrocken.
»Wenn zuviel auf einmal auf einen Mann einstürmt, der seine Kräfte überschätzt hat, kann es ganz plötzlich zu einem Kollaps kommen«, erklärte Dr. Norden, und das meinte er ohne Übertreibung.
»Also zusätzlichen Aufregungen darf er nicht mehr ausgesetzt werden«, sagte Melanie bestürzt. »Dann schützt er seine Beschwerden nicht nur vor.«
»Das auf keinen Fall, Frau Dittmar. Er hat sich seit der Scheidung keinen Urlaub gegönnt.«
»Vorher auch nicht. Das hat mich ja auf die Palme gebracht. Wir hatten überhaupt kein richtiges Familienleben. Und wenn wir wirklich mal einen kurzen Urlaub planten, kam bei ihm bestimmt etwas dazwischen.«
»Und Sie, haben Sie sich Urlaub gegönnt?« fragte Dr. Norden nachdenklich.
»Bei mir ist es doch etwas anderes. Ich habe mit schönen Dingen zu tun, ich komme mit vielen Menschen zusammen und habe einen anregenden Freundeskreis. Sie sehen ja, daß ich wohlauf bin. Ich kann abschalten, wenn der Arbeitstag zu Ende ist, und das kann Vinzenz nicht. Kaum steht ein Projekt, ist er schon bei einem anderen, oder gar bei mehreren gleichzeitig. Und Häuser bauen bringt mehr Ärger mit sich, als hübsche Kleider zu schaffen. Wie gefällt Ihnen übrigens das Kleid Ihrer Frau?«
»Es ist bezaubernd. Und nun wird das Brautkleid für Susanne geschneidert, wie ich hörte.«
»Es wird geschneidert, darauf können Sie sich verlassen, wenn auch manche Ereignisse anderes vermuten lassen. Ich möchte Sie nur bitten, mir Bescheid zu geben, wenn bei Vinzenz sich etwas wirklich Ernstzunehmendes herausstellt, denn dann wird er ganz bestimmt niemanden davon etwas wissen lassen.«
Wie gut sie ihn kannte, wie sie ihn durchschaute! Es ließ darauf schließen, daß er ihr noch immer nicht gleichgültig war.
*
Susanne war rasch an ihrem Ziel angelangt. Irgendwie war es ihr jetzt doch ein wenig unheimlich, dieses Wagnis eingegangen zu sein. Das Haus lag ziemlich einsam, und wenn Adrian nun nicht Wort hielt und sich dem Willen seines Vaters unterwarf, standen ihr trübe Tage bevor.
Die Reitbergers, die das Haus besorgten, hatten sie auch ganz betroffen angeschaut, als sie den Schlüssel holte.
»Ganz allein san s’ kommen?« hatte Frau Reitberger gesagt. »Ist dös dem Herrn Vater denn recht?«
»Ich bin jetzt erwachsen, liebe Frau Reitberger«, hatte Susanne darauf mutig geantwortet. »Außerdem bekomme ich noch Gäste.«
»Ich mein’ ja nur, daß Sie net allein im Haus sein sollten, Fräulein Susanne«, sagte die Frau besorgt. »Nachschauen kommen wir schon, und Ordnung halten tu’ ich auch, aber jetzt gibt es auch viel auf dem Hof zu tun.«
»Sollte es mir langweilig werden, komme ich helfen«, sagte Susanne munter.
Von ihrer Verlobung und bevorstehenden Hochzeit wußten die Reitbergers zum Glück noch nichts, sonst hätten sie sich wohl noch mehr gewundert.
»Die jungen Leut’ heutzutag’«, brummte der Reitberger-Alois, als Susanne zum Haus hinauffuhr, das am Hang lag und einen herrlichen Blick über das Tal bot.
»Gut, daß mir bloß Buben haben«, brummte seine Frau. »Da braucht man net so achtgeben. So was Hübsches, wie das Susannerl, tät ich nicht allein herumlaufen lassen.«
»Die Stadtleut’ denken anders«, meinte der Reitberger. »Wenn sie mag, können wir ihr ja die Lina schicken.«
Aber das hätte Susanne gewiß nicht gewollt, denn lange blieb sie nicht allein. Viel schneller als sie dachte, stand Adrian vor der Tür.
Sie konnte es erst gar nicht fassen, aber dann flog sie ihm um den Hals, und so zärtlich hatte sie ihn noch nie geküßt.
»Du bist gekommen! Du hast es wahr gemacht!« jubelte sie.
»Hast du daran gezweifelt?« fragte er.
»Ein bißchen schon«, sagte sie leise. »Wie hast du es deinem Vater erklärt?«
»Das ist nicht mit ein paar Worten zu sagen, Susanne. Er wird daran ganz hübsch zu knabbern haben.«
Gar so wichtig war das jetzt auch nicht für sie. Adrian war da, er bewies ihr seine Liebe. Dies allein zählte!
»Ja, dann werden wir uns mit Lebensmitteln eindecken«, sagte sie fröhlich. »Und schauen müssen wir, daß es die Reitbergers nicht spitz kriegen, daß ich allein mit einem Mann im Haus bin. Sie könnten das unmoralisch finden.«
»Und du betrachtest es nicht so?« fragte er neckend.
»Ich bin doch nicht von gestern«, sagte sie schelmisch. »Wir sind verlobt, wir wollen heiraten, und bisher hat man uns ja noch keine Chance gegeben, es auszuprobieren, wie wir auskommen, wenn wir unter einem Dach hausen.«
Ihm war es, als fiele eine Zentnerlast von seinen Schultern. Ihre bezaubernde Natürlichkeit befreite ihn von der Beklemmung, daß sie ihn einer kritischen Prüfung unterziehen wolle, und daß es ihr nur darauf angekommen wäre, ihn auf die Probe zu stellen, ob er wirklich kommen würde.
»Du bist wirklich allein hier?« fragte er.
»Was denkst du denn? Wen hätte ich denn mitnehmen sollen? Einen Anstandswauwau?« fragte sie lachend.
»Und was sagt dein Vater?« fragte er zögernd.
»Paps hat doch keine Ahnung. Er würde es auch nicht für möglich halten, daß du deinen gestrengen Vater im Stich läßt.« Sie lachte fröhlich. »Jetzt machen wir es uns gemütlich, fern von allem Trara, frei von aller Etikette.« Dann aber sah sie ihn doch skeptisch an. »Oder wolltest du gleich heute wieder zurückfahren?«
»Die Absicht habe ich nicht. Vater soll allein ausbaden, was er sich eingebrockt hat, und dein Vater wird ihn wohl ganz hübsch in die Zange nehmen.«
»Das kann schon möglich sein, Adrian«, sagte Susanne nachdenklich. »Er wird einiges zu hören bekommen.«
»Es wird gut sein, wenn er mal von seinem hohen Roß heruntersteigen muß.«
*
Und das mußte der Baron Aribert, als Melanie bei ihm erschien. Sie hatte sich natürlich telefonisch angemeldet, denn umsonst wollte sie den Weg nicht machen. Und aus seiner Stimme hatte sie entnommen, daß er sehr verunsichert war.
Melanie entging nichts, als sie das Gutshaus vor sich liegen sah. Die Spuren des Verfalls waren nur notdürftig übertüncht. Sie überlegte jedoch schon, was man aus diesem Bau machen konnte, und da mußte sie unwillkürlich lächeln, denn ganz bestimmt hatte Vinzenz auch schon solche Gedanken gehabt.
Ein zittriges männliches Faktotum, das anscheinend auch schwerhörig war, geleitete sie in den Salon.
Der Herr Baron käme sogleich, wurde ihr mitgeteilt, aber der ließ sie noch warten. Nun, sie war darüber nicht böse. Sie konnte sich umschauen.
Waren die Räume auch sehr renovierungsbedürftig, so verrieten sie doch noch etwas von dem Glanz vergangener Zeiten. Das Mobilar war kostbar, die Gemälde hatten auch ihren Wert. In den Vitrinen entdeckte Melanie Porzellan, das ihr helles Entzücken erregte.
Neben dem Salon lag der große Wohnraum. Melanie hatte keine Hemmungen, durch die halboffene Tür zu treten und sich auch dort umzuschauen. Viel zu düster war der Raum, aber was konnte man auch daraus machen!
»Sie schauen sich schon um, gnädige Frau«, ertönte die Stimme des Barons hinter ihr.
»Ich habe mir die Freiheit genommen«, erwiderte Melanie mit einem charmanten Lächeln. »Die Tür stand offen. Ich habe mir bereits durch den Kopf gehen lassen, was man aus diesem Haus machen kann. Ich bin bereit, Ihnen einen angemessenen Preis dafür zu zahlen.«
»Sie? Und wie kommen Sie darauf, daß ich diesen Besitz veräußern will?« fragte er herablassend.
»Ich denke, es wird Ihnen nichts anderes übrig bleiben«, erwiderte sie spöttisch. »Die Heirat wird nicht zustande kommen. Meine Tochter hat sich überzeugen lassen, daß die Voraussetzungen für sie demütigend wären. Die geschäftlichen Abmachungen, die mein Mann mit Ihnen getroffen hat, sind hinfällig geworden, abgesehen von dem Seegrundstück, das er bereits bezahlt hat.«
»Sie reden von Ihrem geschiedenen Mann«, sagte er heiser.
»Na gut, mein geschiedener Mann«, sagte Melanie leichthin. »Getrennt von Tisch und Bett, aber nicht in finanzieller Hinsicht. Sie werden ja schon festgestellt haben, daß wir beide recht geschäftstüchtig sind. Ich habe das Kapital, das mein Mann mir bei der Scheidung hätte auszahlen müssen, in der Firma belassen und bin seither selbstverständlich auch am Zugewinn beteiligt. Da wir nur eine Tochter haben, sollte sie selbstverständlich einmal alles erben. Mein Mann ist plötzlich erkrankt, und wir sind heute übereingekommen, Susanne zu enterben, falls sie Ihren Sohn heiraten will. Allerdings haben einige Umstände sie bereits veranlaßt, ins Auge zu fassen, die Verlobung zu lösen.«
»Welche Umstände?« fragte der Baron rauh.
»Da wäre zuerst einmal das Benehmen einer gewissen Tatjana von Almassy meiner Tochter gegenüber zu erwähnen.«
»Davon weiß ich nichts«, sagte der Baron unsicher.
»Hinzu kommt, daß mein Mann, oder mein geschiedener Mann, wenn Sie das betont wissen wollen, gestern ein Gespräch zwischen Tatjana von Almassy und ihrem Bruder zufällig belauschte, als er am See spazieren ging. Ich kann Ihnen den Wortlaut wiedergeben.«
»Das darf ich wohl erwarten«, sagte der Baron steif.
»Mit dem Grundstück hat sich Dittmar den adligen Schwiegersohn erkauft, sagte der Mann, und besagte Tanja erwiderte, daß sie dafür sorgen würde, daß Susanne keine Freude daran hätte. Wörtlich sagte sie: Er soll sie nur richtig ausnehmen, und dann sind wir am Drücker, Brüderchen. Wenn ich deiner Unterstützung sicher sein kann, brauchen wir nicht lange zu warten. Und jetzt werden wir den guten Aribert aufsuchen und ihn weichklopfen, damit wir zur Hochzeit eingeladen werden.«
Ächzend war der Baron in einen Ledersessel gesunken. »Das ist zuviel, das ist wirklich zuviel!« stöhnte er und griff an seine Brust. »Das ist ungeheuerlich.«
»Fragen Sie sich, bei wem die Schuld liegt«, sagte Melanie.
»Aber Adrian ist fortgegangen. Er hat mich im Stich gelassen. Er hat mir gesagt, daß er Susanne liebt. Er hat doch mit Tatjana nichts zu schaffen. Sie kennen sich von Kindhert an. Ja, es war mal meine Idee, daß die beiden heiraten sollten, aber Adrian hat mir schon klar und deutlich zu verstehen gegeben, wie er zu Susanne steht. Sie müssen das richtigstellen. Adrian will Susanne doch beweisen, daß er sie nicht wegen dieser Abmachungen heiraten will.«
Wie ein zitterndes Häufchen Unglück saß er da, nicht mehr fähig, den gewohnten herrischen Ton anzuschlagen.
»Und wie wollen Sie beweisen, daß Sie Ihrem Sohn Entscheidungsfreiheit lassen?« fragte Melanie etwas kühl.
»Was soll ich denn tun? Er ist doch nicht mehr da. Er hat das Haus heute morgen tatsächlich verlassen, das ist die Wahrheit. Er hat kein Wort mehr mit mir gesprochen.«
Melanies Gedanken überstürzten sich. Er ist fort, Susanne ist fort, sollten sie das verabredet haben? Aber es stieg kein Groll in ihr empor. Sie lächelte.
»Ich mache Ihnen einen Vorschlag, Herr Baron. Sie übereignen den Besitz Ihrem Sohn, mit allen Verbindlichkeiten selbstverständlich. Er soll beweisen, ob er einen Ausweg aus dem Dilemma findet.«
»Und was soll ich tun? Wohin soll ich denn gehen?« fragte er tonlos.
»Ich denke, daß mein Mann bereit sein wird, Ihnen entgegenzukommen. Sie haben doch früher auch gern in südlichen Gefilden gelebt, wie ich hörte. Vielleicht überlegen Sie sich das. Aber möglicherweise hält Adrian jetzt nach einer anderen reichen Partie Ausschau«, fügte sie dann hintergründig hinzu.
»Das tut er bestimmt nicht«, stieß der Baron hervor, der langsam seine Fassung zurückgewann. »Ihm ist es gleichgültig, was aus unserem Besitz wird.«
»War es Ihnen nicht auch einmal gleichgültig, als Sie lieber in der Welt herumreisten und das Geld mit vollen Händen ausgaben, Herr Baron?« fragte Melanie anzüglich. »Von nichts kommt nichts. Man darf sich nicht zu sehr darauf verlassen, daß der Sohn mit einer reichen Partie rettet, was der Vater aufs Spiel gesetzt hat. Es mag ja Verrückte geben, die sich einen Adelstitel für viel Geld kaufen, aber wir gehören nicht dazu. Susanne hat sich in Ihren Sohn verliebt, und ihr Vater kann ihr eben keinen Wunsch abschlagen. Ich bin da anders.«
»Das haben Sie mir zur Genüge bewiesen«, sagte er nun. »Aber Sie werden auch noch zu spüren bekommen, daß Sie nicht alles erreichen, was Sie sich in den Kopf setzen. Ich habe noch Freunde. Mich zwingt man nicht so leicht in die Knie.«
»Dann halten Sie sich mal hübsch an Ihre Freunde«, sagte Melanie eisig. Und ehe er es sich versah, war sie grußlos gegangen.
»Der Adel sitzt im Gemüt, nicht im Geblüt«, sagte sie, als sie davonfuhr, und sie dachte nicht mehr daran, was man aus diesem Haus machen könnte. Darin könnte wohl doch kein Glück gedeihen, ging es ihr nur flüchtig durch den Sinn.
*
Probleme gab es auch bei anderen. Da war der Professor Wilfried Emmrich, der in Kürze seinen siebzigsten Geburtstag feiern sollte. Die Gästeliste stand schon lange fest.
»Schade«, sagte Lore Emmrich, »Anne und Johannes Cornelius können nicht kommen. Sie haben Hochbetrieb.«
»Dann werden wir uns gestatten, ein paar Wochen auf der Insel der Hoffnung zu kuren, liebe Lore«, sagte der Professor. »Jetzt bin ich Privatmann und kann mir die Zeit aussuchen.«
»Schön wäre es ja«, sagte Lore. »Aber wir können jetzt nicht weg, Friedl.«
»Warum nicht? Wir werden mit Daniel und Fee sprechen. An meinem Siebzigsten können sie mir keine Bitte abschlagen, und ein Plätzchen findet sich für uns auf der Insel immer.«
»Darum geht es doch nicht«, sagte sie leise. »Ich mache mir Sorgen um Dotty.«
»Warum?«
»Sie ist so eigenartig in letzter Zeit. Sie trifft sich auch nicht mehr mit Susanne.«
»Vielleicht haben sie sich verkracht«, sagte Professor Emmrich. »Bei den jungen Mädchen passiert doch so was schnell mal. Da könnte auch ein Mann dahinterstecken.«
Er war kein Mann, der sich Probleme schuf. Er hatte derer genug bewältigen müssen in seinem Beruf als Neurologe. Er hatte in zweiter Ehe, im Alter von achtundvierzig Jahren, seine Assistentin, die dreiundzwanzig Jahre jünger war als er, geheiratet, und sie hatten es beide nie bereut. Seine erste Ehe war kinderlos gewesen, und so war es sein größtes Glück, als ihm Lore die Tochter Dorothee schenkte.
»Sprich doch mal mit Susannes Mutter, Lore«, sagte er. »Du läßt doch dein Festkleid bei ihr schneidern. Sie scheint doch eine sehr vernünftige Frau zu sein. Wir könnten sie ja auch noch einladen, sie und ihre Tochter.«
»Ich wollte ja Susanne einladen, aber Dotty hat gesagt, daß Susi jetzt mit einem Baron herumspinnt. Du kennst ja ihre Ausdrucksweise.«
»Ich finde nichts dabei. Ich kenne doch meine Studenten. Meine Güte, obgleich ich siebzig werde, ich bin immer gut mit der Jugend ausgekommen. Warum sollte ich nicht auch mit Dotty zurechtkommen, wenn sie Probleme hat? Wo steckt sie denn wieder?«
»Das weiß ich eben nicht. Sie ist tagsüber fast nie mehr zu Hause.«
»Und warum hast du mir das nicht früher gesagt, Lore?«
»Weil ich mit ihr vorher reden wollte, aber man kann mit ihr nicht reden. Vielleicht leidet sie darunter, daß sie in letzer Zeit so zugenommen hat.«
»Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich fand, daß sie sehr gesund aussieht.«
»Nur, weil sie nicht mehr mager ist. So seid ihr Männer«, sagte Lore. »Aber sicher ist es Kummerspeck. Ich muß jetzt sowieso zur Anprobe zu Melanie. Ich werde sie mal fragen, was sich zwischen Susi und Dotty getan hat. Sie wird es mir schon nicht übelnehmen. Wenn Dotty inzwischen heimkommen sollte, sei nett zu ihr, Friedl.«
»Bin ich doch immer. Oder etwa nicht?« fragte er.
»Vielleicht solltest du einen etwas väterlicheren Ton anschlagen.«
»Das habe ich bewußt vermieden, Lore. Schließlich könnte ich den Jahren nach ihr Großvater sein.«
»Sie liebt dich. Sie sieht nicht den Großvater in dir. Ist doch auch Unsinn. Sie wollte dich nie enttäuschen.«
»Hat sie doch auch nicht. Daß sie nicht studieren will, nehme ich ihr doch nicht übel, und daß sie kein Interesse für die Herren Doktoren zeigt, die ihr ständig präsentiert werden, auch nicht. Sie soll sich ihres Lebens freuen und sich einen Mann suchen, mit dem sie glücklich wird, wie ich mit dir.« Er legte den Arm um sie und drückte ihr einen innigen Kuß auf die Wange. »Verpaß jetzt aber deinen Termin zur Anprobe nicht. Das Kleid muß fertig werden. Wenn Dotty kommt, werde ich väterlich mit ihr reden, mein Schatz.«
Lore verließ das Haus mit gemischten Gefühlen. Weit hatte sie es nicht bis zu Melanie, doch diese strahlte auch nicht die Ruhe und Heiterkeit aus wie sonst.
Melanie mußte sich entschuldigen, daß die Anprobe nicht fertig geworden sei. »Ich hatte gestern den ganzen Tag mit Familienangelegenheiten zu tun, und wenn ich nicht da bin, läuft es hier einfach nicht so. Aber das Kleid wird bestimmt fertig.«
»Augenblicklich liegt mir daran nicht soviel«, sagte Lore. »Wenn Sie ein paar Minuten Zeit haben, hätte ich gern mal mit Ihnen über Dotty gesprochen, Melanie. Sie war früher doch viel mit Susanne beisammen.«
»Ja, wenn dann die Männer in Erscheinung treten, lockert sich das immer ein bißchen«, meinte Melanie arglos. »Aber ab und zu sehen sie sich doch.« Sie sah Lore forschend an. »Haben Sie etwas dagegen, daß Dottys Freund sich sein Studium als Taxifahrer verdient, Lore?« fragte sie zögernd. »Wollten Sie meine Meinung darüber hören?«
Ein heißer Schrecken durchfuhr Lore, aber niemals hätte sie zugegeben, daß sie von einem Taxifahrer nichts wußte.
»Ja, ich würde gern Ihre Meinung hören, Melanie«, sagte sie stockend.
»Ich finde es gut, wenn junge Leute nicht davor zurückschrecken, sich ihr Studium zu erarbeiten. Viele, die alles von zu Hause bekommen, faulenzen doch die meiste Zeit herum. Und dann kommen sie bloß auf dumme Gedanken. Dieser Jürgen ist doch anscheinend ein sehr netter Mensch.«
Lore entschloß sich, die Wahrheit zu sagen. »Leider haben wir ihn noch nicht kennengelernt. Vielleicht geht Dotty von der Voraussetzung aus, daß wir ihn nicht akzeptieren würden«, sagte sie leise.
»Ja, sie hat wohl mal solche Andeutung zu Susanne gemacht, und dann hat sie sich wohl deshalb noch mehr zurückgezogen, weil Susanne sich ausgerechnet in einen Baron verliebt hat. Glauben Sie nur nicht, daß dies ohne Konflikte abgehen würde, Lore.«
»Ich verstehe nicht, daß Dotty kein Vertrauen zu uns hat«, sagte Lore niedergeschlagen. »Wir sind doch keineswegs engstirnig.«
»Es kann ja auch sein, daß besagter Jürgen erst in Erscheinung treten wollte, wenn er mit dem Studium fertig ist. Und Dotty könnte meinen, daß Sie schon einen Mann für sie augesucht haben. Machen Sie sich darüber keine Gedanken. Die jungen Mädchen sind viel selbständiger, als wir es waren. Und wenn die Eltern sich einmischen, werden die Probleme meist größer.«
»Wir wollen doch nur, daß sie nicht unglücklich wird«, sagte Lore leise. »Sie ist unser ganzes Glück. Ich weiß, daß viele sagen, daß Kinder keine alten Eltern haben sollten, aber Dotty hat es bisher nie so empfunden. Ich habe nur Angst, daß sie unter einen unguten Einfluß gerät. Könnte Susanne sich nicht mal ein bißchen um sie kümmern?«
»Susanne geht auch gerade in sich«, sagte Melanie mit einem flüchtigen Lächeln. »Sie ist in unserm Berghaus in Tirol. Da war Dotty doch auch schon mal mit uns. Vielleicht wäre es der richtige Ort für zwei Freundinnen, um sich mal wieder auszusprechen.«
Lore ließ ihren Blick in die Ferne schweifen. »Sie wissen ja, daß uns ein großer Tag bevorsteht, und es soll kein Schatten darauf fallen. Mein Mann freut sich auf den Ruhestand. Er möchte mit uns eine große Reise machen, endlich einmal frei von allen Verpflichtungen. Wenn allerdings schon ein Mann in Dottys Leben eine so beträchtliche Rolle spielt, von der wir keine Ahnung hatten…«
»Dann lassen Sie Dotty ihre freie Entscheidung, Lore«, sagte Melanie. »Sie ist erwachsen.«
Lore nickte. »Und Sie kann ich nicht überreden, doch zu unserem Fest zu kommen?« fragte sie leise.
»Für acht Damen haben wir die Kleider dafür angefertigt«, erwiderte Melanie, »und nicht alle denken so wie Sie und Frau Norden. Man wäre wohl pikiert, wenn die Schneiderin auch erscheinen würde. Und außerdem habe ich jetzt auch einige private Sorgen.«
»Und ich habe Sie mit meinen solange aufgehalten.«
»Das macht nichts. Wir sehen uns dann morgen?« fragte Melanie.
Geistesabwesend nickte Lore. Auch Melanies aufmunternder Blick konnte sie im Augenblick nicht in zuversichtlichere Stimmung versetzen. Sie überlegte, ob sie offen mit Dotty sprechen sollte oder ob sie abwarten mußte, bis diese selbst ihre Probleme klarlegte. Aber vielleicht wollte sie noch abwarten, bis die Geburtstagsfeierlichkeiten vorbei waren. Lore Emmrich war eine kluge, besonnene Frau. Sie sagte nichts, als sie Dotty zu Hause antraf, und das junge Mädchen gab sich die erdenklichste Mühe, eine heitere Miene zu zeigen.
»Nun, wie wird dein Kleid, Mutti?« fragte sie.
»Sehr hübsch«, erwiderte Lore.
»Und was hört man von Susanne?«
»Sie hat sich nach Tirol zurückgezogen.«
»Jetzt? Es wird doch schon darüber geredet, daß sie heiratet.«
»Vielleicht gibt es da Probleme. Melanie hat so etwas angedeutet.«
»Es ist immer besser, wenn man vor der Hochzeit Erfahrungen sammelt, als später«, warf Professor Emmrich ein. »Scheidungen sind heutzutage teuer. Und ein Mädchen, das ein reiches Erbe antreten wird, sollte doppelt vorsichtig sein. Das gilt auch für dich, Dotty.«
Lore konnte nichts dagegen sagen. Es war sicher der falsche Zeitpunkt für eine solche Bemerkung, denn sie sah, daß Dotty ganz blaß wurde.
Aber dann fragte Wilfried Emmrich schon: »Warum hast du Susanne eigentlich nicht eingeladen, Dotty?«
»Sie geht doch ohne ihren Baron nirgendwo hin, und ich kann ihn nicht leiden. Er ist mir zu arrogant«, erwiderte Dotty unwillig.
Der Professor lachte leise auf. »Vielleicht ist Susanne auch schon dahintergekommen, nachdem die erste Verliebtheit verraucht ist. Ich halte nichts von den vornehmen Nichtstuern, die sich nur ein gemachtes Nest aussuchen.«
»Sei nicht ungerecht, Friedl, wir kennen diesen jungen Mann nicht«, mahnte Lore.
»Von mir werdet ihr so was bestimmt nicht erleben«, sagte Dotty aggressiv. Dann zog sie sich in ihr Zimmer zurück.
»Habe ich was Falsches gesagt, Lore?« fragte der Hausherr. »Dotty ist jetzt ja überempfindlich.«
»Vielleicht hat sie sich in einen armen Burschen verliebt«, meinte Lore beiläufig.
»Dann könnte sie doch darüber reden. Arm sein bedeutet ja nicht ein Mitgiftjäger zu sein. Und meistens verliebt man sich nicht nur einmal, wenn man jung ist.«
Am nächsten Morgen erschien Dotty nicht am Frühstückstisch. Lore ging hinauf zu ihr, um nach ihr zu sehen, aber sie fand das Zimmer leer. Auf dem Bett lag ein Zettel.
Seid bitte nicht böse. Ich will Euch keinen Kummer bereiten, aber ich muß etwas in Ordnung bringen. Ich habe Euch sehr lieb. Eure Dotty.
Lore mußte es ihrem Mann schonend beibringen, aber er regte sich nicht auf. »Sie kommt zurück, Lore. Ich kenne unsere Tochter«, sagte er.
*
Ahnungslos, was sich in München so tat, hatten Susanne und Adrian schon zwei wunderschöne Tage verbracht. Frei von allem Zwang, konnten sich ihre Gefühle richtig entfalten. Susanne lernte jetzt einen ganz anderen Adrian kennen, und sie war unendlich glücklich in dieser Zweisamkeit.
Es gab kein Telefon, das sie stören konnte, es gab keine Verpflichtungen, denen sie nachkommen mußten. Sie sprachen nur über ihre Zukunft, und Susanne gewann die Überzeugung, daß es Adrian sehr ernst meinte, wenn er sagte, daß er sich eine Stellung suchen wolle.
»Aber die bekommst du doch bei Paps«, meinte sie. »Übertreiben wir es doch nicht, Adrian. Eine Starthilfe kannst du dir schon geben lassen.«
»Warten wir erst mal ab, wie deine Eltern jetzt denken, mein Liebes«, sagte er.
»Sie werden sich vielleicht den Kopf zerbrechen, wo du stecken könntest«, sagte sie verschmitzt, »aber Mami wird schon eine Ahnung haben. Ich muß sie jetzt doch mal anrufen, um zu erfahren, was sich getan hat.«
»Und ich kann nicht ein paar Wochen hier verbringen, Susi. So schön es auch ist, ich muß daran denken, Geld zu verdienen.«
Susanne hörte gar nicht richtig zu. Lauschend hob sie den Kopf und wurde unruhig.
»Du, da kommt ein Auto, Adrian.«
»Ich kann mich aber nicht in Luft auflösen und meinen Wagen auch nicht, mein Schatz.«
»Brauchst du auch nicht.« Sie war ans Fenster getreten. »Das ist Dotty! Mein Gott, da scheint was passiert zu sein. Wie sieht sie bloß aus! Laß mich erst allein mit ihr sprechen.«
»Gern, sie mag mich sowieso nicht.«
»Wie kommst du denn darauf?« fragte Susanne hastig.
»Das spürt man doch.«
Susanne eilte hinaus. »Dotty«, rief sie, »wie kommst du hierher?«
Dotty starrte auf die beiden Wagen. »Du bist nicht allein. Ich will nicht stören«, sagte sie.
»Red nicht solchen Unsinn. Du bist da, und wir können miteinander reden.«
»Aber es darf niemand wissen, Susi«, sagte Dotty leise.
»Ich bin doch keine Klatschbase. Wer hat dir verraten, wo ich bin?«
»Mutti hat es von deiner Mami erfahren. Sie scheinen Sorgen ausgetauscht zu haben. Aber es weiß niemand, daß ich hierhergefahren bin. Ich weiß, daß ich mich dumm benommen habe, aber du warst immer meine einzige Freundin, Susi, und ich brauche einen Rat.«
»Wenn ich dir helfen kann? Ist es wegen Jürgen?«
»Nur indirekt. Ich bekomme ein Baby, er weiß es nicht. Er würde mich natürlich heiraten, aber wovon sollen wir denn leben? Ich habe mich entschlossen, einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu lassen und wollte dich fragen, ob du mir das Geld leihen kannst. Ich kann es Jürgen nicht sagen, erst recht nicht meinen Eltern. Vatis siebzigster Geburtstag steht doch vor der Tür und soll gefeiert werden.«
»Ganz groß, wie ich weiß«, sagte Susanne. »Der Salon Melanie hat Hochkonjunktur.«
»So etwas würde ich auch gern machen«, sagte Dotty geistesabwesend, »aber meine Eltern wollen ihr einziges Kind noch so gerne um sich haben. Wie mache ich es nur richtig, Susi?«
»Es kommt doch nur darauf an, ob du Jürgen wirklich liebst«, sagte Susanne mit einer Selbstverständlichkeit, zu der sie vor ein paar Tagen wohl noch nicht fähig gewesen wäre.
»Natürlich liebe ich ihn, und wir wollen später ja auch heiraten, aber jetzt steckt er gerade im Examen. Taxifahren kann er jetzt auch nicht, die Zeit würde ihm fehlen. Und wenn ich ihm sage, daß ich schon im dritten Monat bin, verliert er vielleicht die Nerven.«
»Oder freut sich«, sagte Susanne. »Jetzt mal ganz mit der Ruhe, Dotty. Ein Kind läßt man doch nicht einfach umbringen. Ich würde es nicht tun, unter keinen Umständen. Natürlich werde ich dir helfen, aber nicht so. Haben deine Eltern Jürgen inzwischen kennengelernt?«
»Nein, er wollte erst das Studium hinter sich haben. Ob er dann gleich eine Stellung findet, ist die Frage.«
»Das haben wir gemeinsam«, sagte Susanne schelmisch. »Mein Zukünftiger sucht auch eine Stellung.«
Fragend sah Dotty sie an. »Mit wem bist du hier?«
»Mit Adrian natürlich«, erwiderte Susanne. »Er behauptet zwar, du könntest ihn nicht leiden, aber du mußt ihn ja erst mal richtig kennenlernen. Das mußte ich auch, um ihm ganz zu vertrauen.«
»Aber er ist ein Baron«, flüsterte Dotty.
»Meinst du, daß einem das was nützt, wenn man kein Geld hat und wenn man nicht will, daß man als Mitgiftjäger angesehen wird? Mir wäre es jetzt lieber, er wäre Student und Taxifahrer.«
»Jetzt übertreibst du aber«, sagte Dotty.
»Studiert hat er ja, aber eingebracht hat es ihm bisher noch nichts. Sein Vater hat ihn über den Ernst der Lage nie aufgeklärt. Aber was reden wir jetzt darüber. Man wird dich suchen.«
»Ich habe den Eltern einen Schrieb hinterlassen«, sagte Dotty.
»Und Jürgen?«
»Er hockt hinter seiner Examensarbeit. Ich dachte, es würde sich schnell erledigen lassen. In Salzburg soll man da nicht so pingelig sein.«
»Ich weiß darüber nicht Bescheid, Dotty«, sagte Susanne ernst. »Ich würde es auch nicht tun, und ich werde mich auch bemühen, damit du es nicht tust. Ich denke mir, daß du es schrecklich bereuen könntest. Nun weine doch nicht gleich. Ich will dir ja helfen. Und mit meiner Mami können wir darüber auch offen reden. Wenn deine Eltern dich vor die Tür setzen, was ich nicht glaube, sorge ich schon für dich und das Baby. Darauf kannst du dich verlassen.«
»Wenn du aber doch selber Sorgen hast?«
»Ach was, die räume ich schon aus dem Weg. Du kommst jetzt mit rein und ißt mit uns.«
»Nein, du hast mir versprochen, daß es unter uns bleibt.«
»Kann es doch auch. Aber du sollst Adrian mal richtig kennenlernen, und dann wirst du mich verstehen. Wir haben jetzt auch Ehe geprobt.« Ihre Stimme sank zum Flüstern herab. »Und vielleicht bekomme ich auch ein Baby. Ich hoffe es jedenfalls sehr. Und du wirst mit deinem Jürgen zu unserer Hochzeit kommen.«
»Um euch zu blamieren?«
»Mein Gott, was du alles denkst! Ich werde mit deinen Eltern reden. Die sind doch ganz pfundig.«
»Aber Vati ist eine andere Generation«, sagte Dotty.
»Er denkt jünger als mancher Vierzigjährige. Und sie lieben dich, Dotty. Ich weiß es doch. Warum bist du nur so verzagt? Jürgen ist doch kein Tagedieb und auch kein Jobber. Er wird wohl auch eines Tages Professor sein, so ernst, wie er sein Studium nimmt. Ich habe dich nicht verstanden, daß du dich verkrochen hast, aber du hättest früher schon mal ernsthaft mit mir über deine Probleme reden sollen.«
»Ich dachte nicht, daß du mich verstehst. Du hast dich in anderen Kreisen bewegt, Susi«, sagte Dotty leise. »Wir sind in ganz verschiedene Richtungen gelaufen.«
»So ein Schmarrn. Wir haben uns beide verliebt. Na ja, es mag so ausgesehen haben, daß mir der Titel imponiert, aber das war es nicht. Es ist Adrian, wie es für dich Jürgen ist. Wie heißt er eigentlich mit dem Nachnamen?«
»Richter, schlicht und einfach Richter.«
»Emmrich-Richter, nomen est omen, Dotty. Die zweite Silbe eures Namens ist seine erste.«
»Danach kann man doch nicht gehen. Sein Vater war Maurer.«
»Na und, mein Großvater hat auch so angefangen«, sagte Susanne. »Und was wird Jürgen?«
»Hochbauingenieur.«
»Na, da hat er doch die allerbesten Chancen, Paps gibt ihm bestimmt eine Stellung.«
»So war es nicht geplant, Susi«, sagte Dotty.
»Nein, du hast geplant, dir das Kind nehmen zu lassen, und wenn du das tust, brauchst du nie mehr zu mir zu kommen, das sage ich ernsthaft. Dafür gebe ich auch kein Geld. Das sollen Frauen tun, die keine andere Chance haben, die vor allem keinen Mann haben, von dem sie geliebt werden, aber auch die bereuen oft ihren Entschluß. Kopf hoch, Dotty, jetzt sind wir wieder die alten Freundinnen wie früher. Nur sollst du keine Vorurteile mehr gegen Adrian haben, nur weil er adlig ist.«
Dottys Miene hellte sich auf. »Meinst du wirklich, daß es auch so in Ordnung kommen kann?« fragte sie leise.
»Spätestens wenn das Baby da ist«, erwiderte Susanne lächelnd. »Aber ich halte deine Eltern für viel zu vernünftig, um die Tür zuzuschlagen.«
Und dann nahm sie Dottys Arm und zog sie ins Haus. Adrian erhob sich. »Hallo, Dotty«, sagte er.
»Hallo«, sagte sie leise. »Ich konnte nicht wissen, daß Sie hier sind.«
»Kannst ruhig du sagen«, meinte er.
»Dotty wollte mir die Einsamkeit vertreiben«, sagte Susanne lächelnd, »aber nun weiß sie Bescheid.«
»Du kannst ihm ruhig die Wahrheit sagen, Susi. Ich will nicht, daß du meinetwegen Heimlichkeiten hast.«
»Ich bin nicht neugierig«, sagte Adrian. »Irgendwann werde ich es schon mal erfahren. Jetzt verzehren wir unsere Spaghetti.«
»Und dann muß ich zur Post und telefonieren, Adrian«, sagte Susanne. »Ich denke, wir werden doch bald wieder nach München zurück müssen.«
»Nicht meinetwegen«, widersprach Dotty. »Ich fahre noch irgendwohin.«
»Du fährst nicht irgendwohin. Wenn dein Jürgen ein paar Tage nichts von dir hört, dreht er durch und versiebt seine Examensarbeit. Mir würde es auch so gehen, wenn ich nicht wüßte, wo Adrian steckt.«
»Ich habe ihm geschrieben, daß ich für einige Zeit zu einer Tante fahre«, sagte Dotty.
»Aber du weißt nicht, was er sich dabei denkt!«
*
Jürgen Richter dachte sich allerhand, als er den kurzen Brief bekam. Er dachte falsch.
Sie hat es ihren Eltern gesagt, und sie haben ihr die Tür gewiesen, waren seine Gedanken. Auf seine Arbeit konnte er sich nicht mehr konzentrieren. Er überlegte. Dann zog er seine besten Sachen an, die allerdings auch nicht gerade die neuesten waren und machte sich auf den Weg zu Professor Emmrich. Mit der Straßenbahn, der S-Bahn und dann noch ein gutes Stück zu Fuß erreichte er schließlich das abgelegene Haus in einem stillen Vorort. Ich liebe dich, Jürgen, ich werde immer nur dich lieben, hatte Dotty geschrieben, und diese Worte trieben ihn hierher.
Bis zu dieser Stunde waren Wilfried und Lore Emmrich nur von sorgenvollen Gedanken um ihre Dotty bewegt gewesen. Wo kann das Kind sein, warum ist es gegangen, warum hat sie sich uns nicht anvertraut, das war alles, was sie denken konnten.
Und nun läutete es, und ein fremder junger Mann stand vor der Tür, in einem grauen Anzug, der weit an seinem hageren Körper hing, mit einem blassen, übernächtigten Gesicht, in dem. graue Augen Lore ängstlich anblickten.
»Mein Name ist Jürgen Richter«, sagte er stockend. »Ich möchte gern wissen, was mit Dotty ist.«
Lore hörte eigentlich nur den Namen«? Jürgen, und sie blickte in ein schmales, blasses kluges Gesicht.
Melanie hatte den Namen Jürgen erwähnt. Sie atmete jetzt ganz tief durch.
»Bitte, treten Sie ein, Herr Richter«, sagte sie. »Wir würden auch gern wissen, wo unsere Tochter ist.«
»Hat es meinetwegen Streit gegeben?« fragte er verlegen. »Ich würde das gern richtigstellen.«
»Leider haben wir bis heute von einer Existenz keine Ahnung«, sagte Lore, »aber mein Mann wird auch gern hören wollen, warum das so ist.«
Dann standen sich auch die beiden Männer gegenüber, musterten sich kritisch und reserviert, aber dann sagte Wilfried Emmrich: »Nehmen Sie bitte Platz.«
»Ich möchte lieber stehen«, sagte Jürgen. »Ich möchte Ihnen erklären, daß ich schuld bin. Ich habe Dotty gesagt, daß sie erst von mir sprechen soll, wenn ich das Examen geschafft habe, aber wenn sie weg ist, schaffe ich es nie.«
»Nun mal langsam«, sagte Professor Emmrich. »Um was für ein Examen handelt es sich?«
»Ich studiere an der Technischen Hochschule. Ich will Hochbauingenieur werden. Nebenbei mußte ich mir meinen Lebensunterhalt verdienen.«
»Als Taxichauffeur«, warf Lore ein.
»Dann hat Dotty es also doch erzählt«, sagte Jürgen.
»Nein, das hat mir eine liebe Bekannte erzählt. Eine wirklich liebe Bekannte«, sagte Lore.
»Ich verstehe überhaupt nichts«, sagte ihr Mann. »Warum hat es Dotty uns verschwiegen?«
»Du hast es eben gehört, Lieber. Dieser junge Mann wollte nicht in Erscheinung treten, bevor er nicht sein Staatsexamen gemacht hat«, sagte Lore ruhig. »Aber nun setzen Sie sich, Herr Richter, und trinken Sie mit uns Tee. Dabei läßt es sich besser reden.«
»Ich stamme doch aus sehr bescheidenen Verhältnissen, und ich wollte nicht, daß Dotty über uns spricht, bevor ich nicht etwas zu bieten habe. Wenigstens ein abgeschlossenes Studium.«
»Man soll es nicht glauben«, sagte Wilfried Emmrich seufzend, »diese Jungen heutzutage sind manchmal pingeliger als wir Alten. Habt ihr euch deshalb etwa gar in die Haare gekriegt?«
»Nein, überhaupt nicht«, stammelte Jürgen verlegen.
»Dann verstehe ich nicht, warum Dotty verschwunden ist«, sagte der Professor, »aber Ruhe bewahren, Lore. Wenn sie sich nicht mit ihrem Herzallerliebsten gestritten hat, wird sie auch heimkehren.«
»Ich will Dotty ja heiraten«, sagte Jürgen, »aber erst muß ich eine Stellung haben. Ich wollte nicht, daß Sie denken, daß ich mich in ein gemachtes Nest setzen will.«
»Anstand scheint wieder Mode zu werden«, sagte Lore mit einem versteckten Lächeln. »Der junge Baron bricht aus, um nicht in so schmählichen Verdacht zu geraten, und dieser Jürgen Richter will erst mit einem bestandenen Examen um die Hand unserer Tochter anhalten. Was sagst du dazu, Friedl?«
Er blinzelte ihr zu. »Was soll ich sagen? Wahrscheinlich muß man erst in die reifen Jahre geraten, um mutig eine Frau zu fragen, ob sie das Leben mit einem teilen will. Junger Mann, jetzt reden wir mal ganz offen miteinander. Sie haben also die Absicht, unsere Tochter zu heiraten.«
»Ich liebe Dotty«, erwiderte Jürgen. »Wir haben oft darüber gesprochen, daß wir später mal heiraten wollen. Ich muß nur erst eine gute Stellung finden, damit sie nicht allzuviel entbehren muß.«
»Sie haben also vorausgesetzt, daß wir nicht einverstanden sind und sie von uns nichts mehr bekommt.«
»Ich will nicht, daß sie etwas annimmt, und Dotty will es auch nicht. Leider habe ich nur ein möbliertes Zimmer.«
»Das Dotty aber anscheinend schon genau kennt«, sagte Wilfried Emmrich schmunzelnd. »Wenn man kein Geld hat, muß man sich ja irgendwo unterhalten können.«
Jürgen sah ihn verblüfft an. »Sie scheinen sehr verständnisvoll zu sein, Herr Professor«, sagte er.
»Glauben Sie, zu unserer Zeit war das anders? Liebe Güte, da mußte man sich nur hüten, daß einem die Bude nicht gekündigt wurde. Aber immerhin bin ich Neurologe und weiß, wieviel Komplexe oder Schlimmeres dadurch entstehen, daß Gefühle unterdrückt oder geleugnet werden, daß Heimlichkeiten Schuldgefühle zur Folge haben können und so eine Kette ohne Ende entsteht. Dotty hat wahrhaftig keinen Grund gehabt, uns Ihre Bekanntschaft vorzuenthalten.«
»Dotty trifft keine Schuld«, sagte Jürgen. »Ich habe immer gesagt, daß ich es nicht will, und ich dachte, daß sie es nun doch gesagt hat und genau das eingetroffen sein könnte, was ich befürchtet habe.«
»Und nun sitzen Sie hier, und Dotty ist fern«, sagte der Professor.
»Ich mache mir Sorgen«, murmelte Jürgen. »Sie hat Angst vor dem Alleinsein und hängt doch so sehr an Ihnen, und ich wollte ganz gewiß nicht, daß es zu Differenzen kommt.«
»Dazu ist es auch nicht gekommen. Ich kann über euch nur den Kopf schütteln«, sagte Lore.
»Ich bin sehr streng erzogen worden«, erklärte Jürgen. »Dotty ist überhaupt das erste Mädchen, für das ich mich interessiert habe.«
»Hoffentlich wird es dann dabei bleiben«, brummte der Professor. »Nun, ich denke, daß meine Tochter zumindest meinen Geburtstag nicht vergessen wird, und dann werden wir der erlauchten Gesellschaft eine Verlobung verkünden. Was meinst du, Lore, das wäre doch der Hammer.«
»Wir sollten es den jungen Leuten überlassen, mein Lieber«, sagte sie lächelnd.
»Ich habe doch nicht mal einen dunklen Anzug«, sagte Jürgen ganz kleinlaut. »Nein, das will ich auch nicht. Ich möchte wirklich nur wissen, wo ich Dotty finden kann.«
»Da sind wir augenblicklich überfragt«, sagte Lore. »Aber vielleicht habe ich sie selbst animiert zu diesem Ausflug, da ich ihr erzählte, daß ihre Freundin Susanne sich in die Einsamkeit zurückgezogen hat. Ja, das könnte es sein! Sie ist bestimmt zu Susi gefahren.«
»Und wo ist das?« fragte Jürgen wie elektrisiert.
»Irgendwo in Tirol«, erwiderte Lore, »aber schön sitzen bleiben, Jürgen Richter. Zu gewissen Zeiten ist es gar nicht gut, wenn der Mann der Frau nachläuft. Dotty wird sich sicher bald melden.«
Und kaum hatte sie es ausgesprochen, läutete das Telefon. »Laß mich, Friedl«, sagte Lore und eilte schon zum Apparat. »Du, Susi?« rief sie aus. »Das ist aber eine Überraschung! Ja, ich höre… Natürlich triffst du uns an. Morgen vormittag? Freilich sind wir zu Hause. War Dotty bei dir? Was, sie ist noch da? Na, dann sag ihr mal, daß sie sehnsüchtig gesucht wird von einem gewissen Jürgen Richter, mit dem wir uns schon angefreundet haben. Bis morgen dann.«
»Warum hat Dotty nicht selbst mit dir gesprochen?« fragte Wilfried Emmrich.
»Sie schläft. Im Haus ist kein Telefon. Susanne hat von der Post aus angerufen. Morgen kommt sie.«
»Dotty nicht auch?« fragte Jürgen hastig.
»Vielleicht kommt sie zuerst zu Ihnen«, sagte Lore lächelnd. »Nun, ich bin jedenfalls sehr gespannt, worüber Susanne mit uns sprechen will.«
»Vielleicht haben wir Dotty doch falsch erzogen«, meinte Wilfried Emmrich nachdenklich.
»Nein, bestimmt nicht«, warf Jürgen ein. »Dotty spricht nur liebevoll von ihren Eltern. Sie will Ihnen nur keinen Kummer bereiten.«
»Das hat sie nie getan«, sagte Lore, »und ich denke, daß Sie auch ganz gut mit uns auskommen werden. Aber die Zukunftspläne werden wir erst erörtern, wenn sie da ist.«
»Und als Hochbauingenieur steht Ihnen die Welt doch offen«, gab der Professor seinen Kammentar dazu. »Einen besseren Beruf hätten Sie sich doch gar nicht aussuchen können. Warum schafft ihr euch eigentlich Probleme, wo gar keine vorhanden zu sein brauchten?«
»Mein Vater war Maurer«, sagte Jürgen. »Dotty und ich kommen aus zwei verschiedenen Welten.«
»Jemine, ich dachte immer, wir leben in einer Welt«, sagte Professor Emmrich kopfschüttelnd. »Aber ich bin trotz reifen Alters immer noch wißbegierig und lerne gern auch andere Welten kennen! Und jetzt bleiben Sie auch zum Abendessen. Mal sehen, was unsere Dotty sagt, wenn sie uns einig vorfindet.«
*
In Anbetracht der Umstände behielt es Susanne lieber für sich, was Lore über Jürgen Richter gesagt hatte. Aber so konnte sie am nächsten Morgen voller Zuversicht die Rückreise antreten.
Als sie Frau Reitberger den Hausschlüssel zurückbrachte, wurde sie von dieser kritisch und freundlich zugleich gemustert.
»Gehört der junge Mann nun zu Ihnen, Susanne, oder zu dem andern Fräulein?« fragte sie, ihre Neugierde kaum noch leugnen zu können.
»Es handelt sich um meinen Verlobten, Frau Reitberger, Baron Adrian Cordes. Und in ein paar Wochen wird er mein Mann sein.«
»Jesses, Maria und Josef!« rief Frau Reitberger aus. »Dann werden Sie eine gnädige Frau Baronin!«
»Ob ich gnädig werde, ist nicht gewiß«, erwiderte Susanne lachend, »aber glücklich werde ich bestimmt.«
»Na, siehst, ist bei den Stadtleut’ auch nicht anders als bei uns«, meinte der Reitberger gemächlich.
»Deutlicher brauchst net werden, Alois«, fiel sie ihm ins Wort. »Schließlich wird unser Fräulein Susanne eine Baronin.«
»Na und«, brummte er. »Ein Baron ist auch bloß ein Mann. Und a Katz im Sack kauft keiner gern.«
Mit drei Autos fuhren sie zurück. Susanne voran, Adrian in der Mitte, Dotty hinterher. Aber sie paßten schön auf, damit sie sich nicht aus der Sichtweite verloren. Und kurz vor München stärkten sie sich noch in einem Dorfgasthof bei einem opulenten Frühstück.
»Ich bringe Dotty jetzt erst mal zu Dr. Norden. Der soll feststellen, ob alles in Ordnung ist«, erklärte Susanne. »Du fährst zu Mami, Adrian, und sagst ihr Bescheid. Von ihr wirst du auch erfahren, was sich sonst getan hat.«
»Zu Befehl, Allerliebste«, sagte er und drückte ihr einen Kuß auf die Wange.
Dotty hegte keinen Zweifel mehr, daß bei den beiden alles stimmte, und sie fand Adrian auch keineswegs mehr arrogant. Auch er hatte seine Probleme gehabt und hatte sie noch, wenn auch andere als sie.
So viel Mut hatten ihr Susanne und Adrian gemacht, daß sie jetzt den Kopf wieder oben trug.
»Vor Dr. Norden brauchst du keine Angst zu haben, Dotty. Er ist wahnsinnig nett und sympathisch«, sagte Susanne. »Wir kennen ihn schon lange. Und dann kannst du gleich zu deinem Jürgen fahren. Inzwischen habe ich mit deinen Eltern gesprochen.«
Dotty fiel ihr um den Hals. »Ich war schön blöd, Susi«, flüsterte sie.
»Welch wahres Wort«, lachte Susanne. »Das rede ich dir bestimmt nicht aus.«
Dr. Norden kam gar nicht dazu, mit Susanne zu sprechen. »Ich vertraue Ihnen nur meine beste Freundin an, lieber Dr. Norden«, sagte sie, und schon war sie wieder an der Tür. »Wir sehen uns später.«
Und er dachte, daß sie schleunigst zu ihrem Vater in die Klinik wolle. Was sollte er sonst auch denken. Aber Susanne war schon auf dem Wege zu den Emmrichs, noch immer ahnungslos, daß ihr Paps sich in die Klinik zurückgezogen hatte.
*
Insgeheim hatte Lore Emmrich gehofft, daß Dotty auch kommen würde. Sie machte sich jetzt ernsthafte Sorgen um ihre Tochter, als Susanne sagte, daß sie Dotty zu Dr. Norden gebracht hätte. Eine ganz gute Einleitung wäre das, meinte Susanne, denn leicht fiel es ihr nicht, Dottys Eltern den wahren Sachverhalt zu erklären. Ihnen schien keine Ahnung zu kommen.
»Wie Sie schon wissen, haben wir Jürgen Richter kennengelernt, Susanne «
»Wir haben auch nichts gegen ihn«, warf Professor Emmrich rasch ein. »Er ist doch ein sympathischer Mensch und macht einen zuverlässigen Eindruck. Dotty braucht keinen Widerstand von uns zu fürchten.«
»Auch nicht, wenn sie ein Baby bekommen würde?« fragte Susanne nun noch deutlicher.
Zwei Augenpaare waren auf sie gerichtet, staunend, fragend und fassungslos.
»Ein Baby?« kam es mühsam über Lores Lippen.
»Nun, so was soll schon mal passieren«, erklärte Professor Emmrich da schnell gefaßt. »Deswegen ist sie also so mollig geworden. Wir dachten, es wäre Kummerspeck.«
Susanne lachte leise. Diese Reaktion gefiel ihr. Dann sagte Lore: »Und deshalb wollte sie fort von zu Hause?«
»Sie wollte einiges überdenken«, sagte Susanne ernst. »Ob es richtig sei, das Kind zu bekommen, ob es für Jürgen jetzt nicht eine Belastung wäre, und sie konnte ja auch nicht sicher sein, ob Sie Verständnis dafür aufbringen würden.«
Da geschah etwas, was Susanne zu Tränen rührte. Professor Emmrich nahm seine Frau in die Arme.
»Ich erlebe es noch, Lore«, sagte er leise. »Ich kann mich noch an einem Enkelchen freuen. Das ist das schönste Geburtstagsgeschenk. Hoffentlich geht nur alles gut. Wir müssen uns gleich um Dotty kümmern. Sie darf sich doch nicht aufregen. Ruf bei Dr. Norden an, daß wir sie abholen.«
Und ohne zu zögern, eilte Lore zum Telefon. Susanne ging auf den Professor zu und drückte ihm die Hände.
»Sie sind wundervoll«, sagte sie leise und tief bewegt.
»Sie aber auch, Susanne, daß Sie sich so eingesetzt haben für unsere Dotty. Es würde uns sehr freuen, wenn Sie auch zu unserem Fest kommen würden. Jetzt haben wir ja doppelten und dreifachen Grund zu feiern.«
»Wir telefonieren noch miteinander«, sagte Susanne. »Jetzt habe ich noch manches mit meinen Eltern zu besprechen. Vielleicht bekomme ich sie ja doch mal an einen Tisch.«
Lores Gesicht hatte wieder Farbe bekommen, und ihre Augen leuchteten.
»Wir können Dotty bei Fee Norden abholen«, sagte sie bebend.
»Sie sind mit den Nordens persönlich bekannt?« fragte Susanne überrascht. »Das wußte ich gar nicht.«
»Sie werden auch zur Geburtstagsfeier kommen«, erklärte Lore hastig. »Kommen Sie doch auch, Susanne, und überreden Sie Melanie «
»Wenn ich meinen Verlobten mitbringen darf?« fragte Susanne.
»Aber sicher. Ist alles wieder in Ordnung?« fragte Lore.
»In allerbester Ordnung, jedenfalls was Adrian und mich angeht.«
»Ihrem Vater geht es ja hoffentlich auch wieder besser«, sagte Lore.
Jetzt wurde Susanne blaß. »Was ist mit Paps? Ich habe keine Ahnung«, flüsterte sie erregt.
»Dann tut es mir leid, daß ich so damit herausplatze«, sagte Lore. »Aber es ist nichts Schlimmes. Er ist in der Behnisch-Klinik.«
Nun hielt sich Suanne nicht eine Minute länger auf. Für sie gab es jetzt nichts Wichtigeres als ihren Paps.
Zehn Minuten später betrat sie das Krankenzimmer. Vinzenz Dittmar fiel die Zeitung aus den Händen.
»Wo kommst du denn her?« fragte er verblüfft. »Du solltest doch nicht benachrichtigt werden.«
»Wurde ich doch auch nicht«, erwiderte Susanne. »So ganz nebenbei erfahre ich auch, daß du in der Klinik bist. Was machst du denn nur für Geschichten?«
Sie war sehr bemüht, ihre Sorge nicht zu zeigen, und in Anbetracht der Tatsache, wie besorgt man um ihn war, hätte Vinzenz ganz gerne noch ein paar Tage in der Klinik verbracht.
»Ich faulenze nur«, sagte er. »Wegen des Blutdrucks habe ich mich untersuchen lassen. Melanie war indessen so freundlich, mit dem Baron zu verhandeln.«
»Soso, du wolltest dich drücken, Paps«, sagte Susanne. »Du bist durchschaut.«
»Melanie kann das viel besser. Sie ist diplomatischer als ich. Ich hätte mich auch zu sehr aufgeregt, und Aufregungen schaden mir.«
»Wir werden dich zur Kur schicken, damit du zur Hochzeit fit bist«, erklärte sie energisch.
»Die Hochzeit findet statt?« staunte er. »Ich denke, Adrian ist ausgerückt?«
»Das hatten wir gemeinsam geplant.«
Seine Augen verengten sich. »Ihr wart zusammen?« fragte er.
»Nun krieg mal keinen moralischen Koller, Paps. Nimm dir ein Beispiel an Professor Emmrich. Der freut sich, daß Dotty ein Baby bekommt.«
Jetzt riß Vinzenz die Augen auf. »Willst du damit etwa sagen, daß du auch eins bekommst?« fragte er ganz atemlos.
»Nein, das will ich nicht sagen, aber du brauchst nicht den Moralprediger zu spielen, wenn ich mit Adrian mal ein paar Tage allein bin. Es wurde höchste Zeit, daß wir uns richtig kennenlernten. Dann weiß man doch wenigstens, was einen in der Ehe erwartet. Jetzt sucht sich Adrian eine Stellung, und ich denke, wenn du eine Kur machst, könnte er sich die ersten Lorbeeren verdienen.«
»Er versteht doch gar nichts vom Baugeschäft. Stell dir das nicht so einfach vor.«
»Nun, man könnte ihm einen tüchtigen Ingenieur zur Seite stellen, der zufällig auch eine Stellung braucht. Architekten habt ihr ja, und das Büropersonal ist auch eingespielt. Adrian will kein Marionettendasein führen, wie du es ihm wohl zugedacht hast. Du mußt ihm doch wenigstens die Chance geben, zu beweisen, was er kann.«
»Oder nicht kann«, brummte Vinzenz.
»Das wird sich herausstellen.«
»Und was hast du von einem Ingenieur geredet?«
»Dottys zukünftiger Mann macht gerade sein Staatsexamen.«
»Und hat keinerlei Praxis«, sagte Vinzenz.
»Bring mich bitte nicht auf die Palme, Paps. Du hast auch mal angefangen. Und wenn ein Verlust eintreten sollte, kannst du den dann von meinem Erbteil abziehen.«
»Ich hatte beschlossen, dich zu enterben«, sagte er.
»Die Idee hatte ich doch auch«, sagte Susanne lässig. »Wie hat eigentlich mein reizender Schwiegervater reagiert?«
»Frag deine Mutter«, brummte er. »Sie hält das Heft bereits fest in den Händen und sagt, daß ich mich um nichts zu kümmern brauche.«
»Mami besucht dich?« fragte Susanne fassungslos.
»Jetzt bist du platt«, grinste er. »Ich hätte mich schon längst mal in eine Klinik legen sollen. Da erfährt man am besten, was man seinen Lieben wert ist.«
»Du bist ein Drückeberger«, spottete Susanne. »Denke nur nicht, daß ich dich bedaure. Dafür ist Mami gut genug, dir die Schwierigkeiten aus dem Wege zu räumen.«
»Das darfst du nicht sagen, Susi, das nicht«, begehrte er auf. »Melanie ist viel verständnisvoller als du, und du weißt genau, daß ihr keine andere Frau das Wasser reichen kann.«
»Aber den ersten Schritt hättest du nie getan«, sagte Susanne vorwurfsvoll.
»Ich habe ihn doch getan«, widersprach er.
»Du hast dich in die Klinik gelegt, um ihr Mitgefühl zu erregen. Da ist sie natürlich weich geworden.«
»Mir ging es wirklich nicht gut. Du kannst doch die Ärzte fragen.«
»Das werde ich auch tun, lieber Paps, und ich werde dafür sorgen, daß du dich schonst, darauf kannst du dich verlassen!«
Er griff nach ihrer Hand. »Nun erzähle doch mal, was mit Dotty ist«, lenkte er ab.
»Das wirst du schon noch erfahren. Jedenfalls bekommt sie ein Baby, und ich hoffe, daß sie jetzt sehr glücklich ist, weil sie sehr verständnisvolle Eltern hat, die nicht ein bißchen stur sind. Ich fahre jetzt zu Mami. Am Nachmittag besuche ich dich.«
»Ich werde nach Hause gehen«, sagte er.
»Das wirst du nicht. Ich werde ein sehr ernstes Gespräch mit Dr. Behnisch führen, darauf kannst du dich verlassen. Jetzt werde ich auch mal ein bißchen das Heft in die Hand nehmen…«
Nun konnte er nachdenken, aber dazu hatte er ja wirklich genügend Zeit!
*
Melanie war über Adrians Erscheinen ebenfalls überrascht gewesen, aber sie beruhigte sich schnell wieder, als er ihr erklärte, daß er bei Susanne gewesen sei.
»Und wo ist sie?« fragte Melanie.
»Bei Dottys Eltern. Wegen Dotty sind wir nämlich so früh zurückgekommen.«
Melanie fand es fast komisch, aber plötzlich konnten sie völlig normal und ungezwungen miteinander reden. Was denn mit Dotty sei, fragte auch sie. Adrian erzählte es ein wenig verlegen.
»Ach du liebe Güte«, seufzte Melanie. »Und das vor seinem Siebzigsten.«
»Es wird schon in Ordnung gehen«, sagte Adrian stockend. Melanie warf ihm einen schrägen Blick zu. »Gibt es bei euch auch solche Neuigkeiten?« fragte sie dann anzüglich.
»Das sollten Sie nicht gleich denken«, erwiderte Adrian irritiert.
»Nicht gleich«, meinte Melanie mit leisem Lachen. »Meinst du nicht, daß wir zum Du übergehen sollten, Adrian?«
»Wenn du es mir so charmant anbietest?« Ganz spontan umarmte er sie und küßte sie auf beide Wangen. »Es freut mich, Melanie.«
Susanne hat gleich seine beste Seite entdeckt, dachte Melanie. Er gefiel ihr immer besser.
»Deinem Vater habe ich ganz schön eingeheizt«, bemerkte sie beiläufig, während sie zwei Gläser Champagner einschenkte. Das gehörte auch zu dieser Stunde. »Und mein Mann ist auch nicht zu kurz gekommen. Da legt er sich doch einfach in die Klinik, dieser Feigling.«
»Er ist in der Klinik?« fragte Adrian erschrocken.
»Nichts Schlimmes, nur der Blutdruck, aber das fiel ihm im richtigen Augenblick ein, um mich für seine Zwecke einzuspannen. Mir blieb es dann nämlich überlassen, dem Baron mitzuteilen, daß Susanne keinen Cent bekommen wird, wenn sie dich heiratet.«
»Das ist gut«, rief Adrian aus. »Das ist sogar sehr gut. Aber er wird bald erfahren, daß wir heiraten. Der Termin bleibt.«
»Aber die Woche Bedenkzeit, die ich ihm gab, ist bald um. Und glaube nur ja nicht, daß er aufgibt. Zuerst sah es so aus, aber dann ist ihm wohl in den Sinn gekommen, daß er sich von einer bürgerlichen Schneiderin nicht in die Knie zwingen lassen darf. Es steht also so: Das Seegrundstück ist in unseren Besitz übergegangen und bezahlt. Aber davon hat er nichts, weil die Hypotheken damit abgedeckt werden mußten.«
»Und das Haus und die Grundstücke?« fragte Adrian.
»Ich habe ihm den Vorschlag gemacht, alles dir zu überschreiben, aber er glaubt an gute Freunde, die ihm helfen.«
»Wir haben keine guten Freunde. Es ist aber durchaus möglich, daß sich ein paar raffinierte Leute alles für ein Butterbrot unter den Nagel reißen, und ihn dann vor die Tür setzen.«
»Dann kümmere du dich darum. Du kennst ihn besser«, sagte Melanie. »Ich weiß eh’ nicht mehr, wo mir der Kopf steht, denn die Kleider für die Geburtstagsfeier von Professor Emmrich müssen fertig werden, und dein lieber Schwiegervater hat mich ganz hübsch in Atem gehalten. Aber er ist ein guter Kerl, was immer man auch gegen ihn haben mag, Adrian. Stoß ihn nicht vor den Kopf. Nimm die Chance wahr, die dir geboten wird. Du kannst ja nichts dafür, daß du so konservativ erzogen wurdest. Bei euch ist die Zeit stillgestanden, das wurde mir bewußt, als ich dieses Haus betrat. Und was könnte man daraus machen!«
Wieder bekamen ihre Augen einen schwärmerischen Ausdruck. »Es gefällt dir?« fragte Adrian verwundert. »Dieser alte düstere Bau? Ich hänge daran wahrhaftig nicht.«
»Du siehst ihn nur so, wie du ihn kennst, wie er dasteht. Ich sehe ihn, wenn er umgestaltet wäre. Das nennt man Kreativität, lieber Adrian. Und weil ich sie besitze, hatte ich beruflichen Erfolg. Leider machte mein Sinn für Neuschöpfungen und Veränderungen auch vor meinem Mann nicht halt. Ich meinte, auch ihn ummodeln zu können, aber das gelang mir nicht. Er ist eine zu starke Persönlichkeit, aber es ist mir erst bewußt geworden, seit ich selbst mich entfalten konnte. Ich mag ihn wieder. Gemocht habe ich ihn ja immer, wenn ich ehrlich sein will, aber jetzt können wir auch wieder miteinander reden. Er hat sich einen Sohn gewünscht, Adrian. Werde sein Sohn. Paß dich ruhig ein bißchen an für den Anfang. Einen besseren Lehrmeister wirst du nirgendwo finden. Glaube mir das. Einen besseren Rat kann ich dir nicht geben.«
»Es klingt anders, als der Schwiegersohn von Vinzenz Dittmars Gnaden zu sein, wenn du es so sagst, Melanie. Aber ich möchte vor allem Susannes Mann sein, und ein Mann, vor dem sie auch Achtung hat. Du hast eine wundervolle Tochter.«
»Und Vinzenz ist ihr Vater. Was immer uns auch auseinandergebracht hat, sie hat Vater und Mutter, und wir lieben sie. Wir wollen beide, daß sie glücklich wird.«
»Und sie ist glücklich, Mami«, ertönte da Susannes Stimme. Ganz leise hatte sie die Tür geöffnet, und ge-lauscht hatte sie auch. Aber was sie erlauscht hatte, mußte sie ja glücklich machen!
Sie flog ihrer Mutter an den Hals, dann wechselte sie in Adrians Arme über. Wie glücklich sie war, daran konnte es keinen Zweifel geben.
»Und was ist jetzt mit Dotty?« fragte Melanie.
»Sie wird jetzt ihren Eltern in die Arme sinken«, sagte Susanne lachend. »Alles okay. Der liebe Professor ist selig, Großvater zu werden.«
*
Tränen waren geflossen bei diesem Wiedersehen! Heiß strömten sie über Dottys blasses Gesicht, verstohlen wischte sie sich Lore von den Wangen, und auch Wilfried Emmrich konnte es nicht verhindern, daß seine Augen feucht wurden.
Fee Norden freute sich riesig. Auch sie hatte eine Flasche Sekt geöffnet. Werdende Mütter durften sich das köstliche Naß ruhig mal genehmigen, und ein solcher Augenblick konnte mehr bedeuten als ein großes Fest.
»Und der arme Jürgen büffelt«, sagte Professor Emmrich schmunzelnd, als die Gläser aneinander klangen.
»Darf ich gleich zu ihm fahren, Vati?« fragte Dotty.
»Ich halte es für besser, wenn wir ihn zu uns holen«, erwiderte er. »Ich habe mir gestern seine Bude angeschaut. Da kann man doch nicht ruhig arbeiten. Dieser Krach, diese verpestete Stadtluft. Und ein anständiges Essen muß er ab und zu auch mal bekommen. Den dunklen Anzug zur Geburtstagsfeier mußt du ihm aber aufschwatzen, Dotty.«
Und während Dotty ihren Vater sprachlos anblickte, wandte der sich an Fee. »Das wird dann auch gleich die Verlobungsfeier werden, liebe Fee. Und ich denke, daß gleich nächsten Monat die Hochzeit folgen wird.«
»Aber ohne Aufsehen, Vati«, sagte Dotty leise.
»Wie ihr es wünscht. Inzwischen wird ja auch Susanne heiraten, wie wir hörten.«
»Und da soll ich noch Brautjungfer sein«, meinte Dotty.
»Guter Gott, was ziehst du da an!« rief Lore aus.
»Diese Frauen«, seufzte Professor Emmrich.
»Ob Melanie noch ein Kleid einplanen kann?« fragte Lore.
»Ich könnte ja notfalls aushelfen«, warf Fee ein. »Ich habe noch ein Kleid im Schrank hängen, das ich nur einmal getragen habe, als Anneka unterwegs war. Das hat auch Melanie gemacht. Es würde Dotty gut zu Gesicht stehen.«
»Ich würde sowieso nicht einen Haufen Geld ausgeben für ein Kleid, das ich nur einmal tragen kann«, sagte Dotty. »Jürgen hat nichts für Feste übrig, und sparen müssen wir auch. Eine Wohnung ist viel wichtiger.«
»Wo wir ein so großes Haus haben«, wagte der Professor einen Widerspruch.
Dottys Augen wurden ganz weit. »Du würdest das wollen, Vati?« stammelte sie.
»Eine größere Freude könntet ihr uns gar nicht machen«, sagte Lore. »Aber über all das können wir später sprechen. Fee muß sich auch um ihre Kinder kümmern…«
Die drei hielten sich zwar zurück, wenn Besuch im Hause war und ernste Gespräche geführt wurden, aber ihre Geduld war auch nur begrenzt, und nun hatten sie im Garten einen kleinen Vogel entdeckt, der aus dem Nest gefallen war, und da mußte die Mami helfen.
»Gut, daß du in dein Nest zurückfindest, meine Kleine«, sagte Professor Emmrich zu Dotty, »und für deinen Jürgen ist auch Platz darin.« Und so konnte auch Dotty an diesem Tage vollkommen glücklich sein, denn bald schon konnte sie Jürgen in die Arme sinken.
*
Grollend, vergrämt und mit der ganzen Welt unzufrieden, wanderte indessen Baron Aribert rastlos in seinem einstmals so prächtigen Heim umher. Er nahm die Spuren des Verfalls nicht wahr, er hatte diese einfach niemals wahrnehmen wollen. Er hatte auch nie, wie Melanie, darüber nachgedacht, was man aus diesem Haus, diesen Räumen machen könnte. Er hatte nichts dazu getan, es zu erhalten, und er hatte nichts aus seinen Fehlern gelernt. In seinen Augen war nur Adrian schuld, wenn sie auch dies noch verloren.
Und dann stand Adrian plötzlich wieder in der Tür. Die düstere Miene seines Vaters hellte sich auf.
»Da bist du ja wieder«, sagte er. »Du hast es dir anders überlegt.«
»Ich bin gekommen, um mit dir zu sprechen«, sagte Adrian ruhig. »Um dich vor weiteren Dummheiten zu bewahren.«
»Wage es nicht, in diesem Ton mit mir zu sprechen«, fuhr ihn der Ältere an.
»Du wirst mir zuhören, ob du willst oder nicht. Ich denke nicht daran, die Suppe allein auszulöffeln, die du uns eingebrockt hast. Wer von deinen guten Freunden ist denn bereit, dir zu helfen? Das möchte ich gern wissen, Vater.«
»Du hast also schon mit ihr gesprochen, mit dieser überheblichen, dreisten Person, die mir Vorschriften machen will, mir, einem Cordes! Die so tut, als wäre ich nichts, gar nichts.«
»Und was bist du?« fragte Adrian. »Du hast von einem Namen gezehrt, der einmal Glanz hatte. Und ich muß mich damit abfinden, den Namen zu tragen. Allerdings kann ich jetzt auch durch die Heirat den Namen meiner Frau annehmen. Und wenn ich das will, kannst du daran nichts ändern.«
Der Baron lachte blechern auf. »Sie wollen doch den Namen kaufen«, sagte er tonlos, »nur das wollen sie doch.«
»Da irrst du gewaltig. Du hast dich in diese Wahnidee verrannt. Du hast die letzten Jahre, als es immer mehr bergab ging, nur damit verbracht, eine Frau für mich zu suchen, die Rang, Namen und auch noch Geld hat. Aber du hast keine gefunden. Diese Generation ist klüger, weitsichtiger. Sie hängt nicht mehr an der verblassenden Tradition. Sie weiß, daß man sich jeden Tag aufs neue bewähren und behaupten muß, wenn man es zu etwas bringen, oder das Ererbte erhalten will. Und bevor wir weitersprechen, Vater, ein Wort vorab: Wenn du Melanie oder Vinzenz Dittmar mit einem Wort beleidigst, ist es restlos aus zwischen uns. Dann helfe ich dir keinen Schritt weiter.«
»Wie willst du mir denn überhaupt helfen«, murmelte der Baron tonlos. »Wo soll ich denn bleiben, wenn man mich von hier verjagt?«
»Vielleicht bei der Gräfin Almassy«, sagte Adrian spöttisch. »Aber in der kleinen Mietwohnung wird kaum Platz für dich sein. Das hätte dir doch ein Beispiel sein können, wie schnell man alles verlieren kann. Und was hat dir denn dein lieber Freund Kettelau geboten, um alles in Bausch und Bogen an sich zu bringen, um dann ein glänzendes Geschäft damit zu machen? Gebrauch doch mal deinen Verstand, sofern er dir nicht ganz abhanden gekommen ist. Vinzenz Dittmars Weitsicht hat dich doch nur vor dem größten Verlust bewahrt.«
»Weil er seine Tochter mit dir verheiraten wollte, nur deshalb.«
»Weil Susanne sich tatsächlich und unbegreiflicherweise in mich verliebt hatte«, sagte Adrian. »Ja, zuerst dachte ich auch, daß sie nur darauf aus wäre, Baronin Cordes zu werden, aber inzwischen habe ich sie kennengelernt, ganz genau kennengelernt. Und ich werde dieses wundervolle Mädchen heiraten, Vater.«
»Unter welcher Bedingung?« fragte der Ältere.
»Die dir Melanie bereits genannt hat. Du überschreibst den Besitz auf mich, selbstverständlich mit allen Verbindlichkeiten. Du bekommst eine Wohnung gestellt und monatlich zweitausend Euro für deinen Lebensunterhalt. Wenn du es ablehnst, bekommst du gar nichts, und hier kannst du auch nicht mehr bleiben. Du kannst aber alles, was wertvoll ist, verkaufen und dir damit noch ein hübsches Polster schaffen. Ich denke, daß an die zweihunderttausend Euro dabei herauskommen.«
»Was seit Generationen in unserem Besitz ist?« fragte der Baron erregt. »Jetzt muß ich dich fragen, ob du den Verstand verloren hast!«
»Ich werde dir eine Liste bringen, was Herzöge, Fürsten und andere Adlige, sogar Könige verkauft haben, um überleben zu können«, sagte Adrian ruhig.
»Wie habe ich dich erzogen«, murmelte der Baron.
»Falsch, ganz falsch hast du mich erzogen. Ich bin ja jetzt erst erwachsen geworden. Ja, ich war dir ein gehorsamer Sohn. Ich wußte nicht, was hier vor sich geht. Du hast mir nie Einblick in die Bücher gestattet. Du hast mich immer behandelt wie einen dummen Jungen, und weil ich so erzogen wurde, wagte ich auch keinen Widerspruch. Doch damit ist es vorbei. Und nun bist du an der Reihe. Rede, handele!«
Mit steifen Knien und unsicheren Schritten ging der Baron auf die Wand zu, an der das Bild des ersten Baron von Cordes hing. Ein Raubritter war er gewesen. Aus dem Süden war er gekommen und hatte hier eine Fürstentochter gefreit. Als Adrian ein Kind gewesen war, hatte ihm das gewaltig imponiert. Aber niemals, bis zum heutigen Tage nicht, hatte er erfahren, daß sich hinter dem Bild ein Safe befand.
Die knochigen Finger des Barons tasteten über den Rahmen, und schon öffnete sich dieser wie eine Tür.
Der Baron lehnte sich mit ausgebreiteten Armen vor die Öffnung, als wolle er verteidigen, was sich darin befand.
»Nun sollst du erfahren, warum ich dieses Haus nicht verlassen will, mein Sohn«, sagte er. »Hilf mir, die Truhe herauszuheben. Ich kann es nicht allein.«
Adrian trat näher. Die Truhe war nicht sehr groß und aus Eichenholz, aber sie war schwer. Er brauchte viel Kraft, um sie auf den Boden zu heben, denn sein Vater hatte zu wenig, um das Gewicht auszugleichen.
Der Baron ging zum Schreibtisch und holte ein Schlüsselbund. Vier eiserne Schlösser mußten geöffnet werden, bis der Deckel sich heben ließ, und dann schloß Adrian die Augen, weil sein Vater zu kichern begann, denn obenauf erkannte Adrian das Bild seiner Mutter.
»Immer sind die Frauen der Cordes’ vor ihren Männern gestorben«, sagte der Baron theatralisch, »und immer wurde ihr Schmuck zu dem ihrer Vorgängerinnen gelegt. Das ist Tradition, mein Sohn. Zur Hochzeit hatte jede Cordes ein Diadem getragen, das vorher ihrer Schwiegermutter gehört hatte. Zur Geburt jeden Kindes bekam sie einen Ring, aber wenn sie starb, wurde auch der Schmuck, den sie im Laufe ihres Lebens geschenkt bekam, in diese Truhe gelegt. Aber niemals hat eine Bürgerliche ein Stück davon gesehen.«
Dann kniete er nieder und begann in den einzelnen Kästen zu wühlen. Perlen und Diamantcolliers verstreute er auf dem Teppich, Rubine und Saphire funkelten auf schwerem Gold.
»Du besitzt das und hast alles sonst verkommen lassen«, flüsterte Adrian fassungslos. »Das ist ein Vermögen, Vater. Damit hättest du alles retten können.«
»Nicht ein Stück wird verkauft. Niemand hat das getan. Es bleibt da, wo es ist, und deshalb werde ich dir alles überschreiben. Jetzt weißt du, warum ich es tue. Aber du wirst nicht diese Bürgerliche heiraten.«
»Du bist krank, Vater«, sagte Adrian, »aber dir ist wohl nicht zu helfen. Ich werde Susanne heiraten. Ich verzichte auf alles. Ich will sie nicht überleben, damit dieser Wahnsinn weitergetrieben wird. Und sie wird von all dem auch nichts haben wollen. Du kannst damit machen, was du willst. Hier hat es wahrscheinlich noch nie eine glückliche Frau gegeben, aber ich will, daß Susanne glücklich wird.«
»Du kannst doch nicht mit der Tradition brechen, Adrian!« stöhnte der Baron.
»Doch, das kann ich. Ich habe ein Recht auf mein Leben. Ich weiß jetzt, was du vorhattest. Ich sollte Susanne nur heiraten, damit der Besitz erhalten bleibt, und dann hättest du mit Hilfe von Tatjana alles getan, um sie wieder von mir zu trennen. Mein Gott, wie erbärmlich bist du. Verkauf dieses Zeug, und bezahle deine Schulden damit. Ich möchte nicht wissen, wieviel Frauentränen an diesem Schmuck kleben.«
Er ging zur Tür, und dort drehte er sich noch einmal um. Sein Vater kniete noch immer zwischen den verstreute Schmuckstücken am Boden, aber plötzlich warf er die Arme hoch und fiel rückwärts. Kein Laut war dabei über seine Lippen gekommen.
Es ist meine Schuld, dachte Adrian, als er zurückging und neben dem Bewußtlosen niederkniete. Er fühlte den Puls, aber der war nur ganz schwach. Er ging zum Telefon und wählte eine Nummer.
»Ich bitte dringendst um den Notarzt«, sagte er, als eine Stimme sich meldete. Er gab hastig die Adresse durch und legte den Hörer auf, dann ging er ganz mechanisch zu seinem Vater zurück, sammelte den Schmuck ein und schloß die Truhe. Er drückte auch das Bild an die Wand zurück. Die Truhe stand jetzt genau darunter, aber er sah das Bild seiner Mutter, das unter dem Arm seines Vaters lag. Er vermeinte, das irre Kichern zu vernehmen, und ein eiskalter Schauer rann ihm über den Rücken. Er steckte das Bild in seine Jackentasche, und da wurde schon geläutet.
Joseph hatte es natürlich nicht gehört, aber die Köchin Zenta kam angelaufen. Sie schlug die Hände klagend ineinander, als die Sanitäter die Trage ins Haus brachten. Sie war so alt und wunderlich wie Joseph, und Adrian hatte plötzlich das Gefühl, als sei das Haus ein einziges Grab.
»Was sollen wir denn jetzt tun«, jammerte Zenta.
»Ich komme zurück«, erwiderte Adrian, und doch hatte er den Wunsch, dieses Haus nie mehr betreten zu müssen.
*
Adrian war dem Krankenwagen nachgefahren, aber er hatte keine Annung, daß es die Behnisch-Klinik war, vor der dieser hielt.
Der Fahrer sprang heraus und sagte: »Es ist die nächste Kiinik, und Sie wollen doch sicher eine Privatklinik, Herr Baron.«
Adrian nickte wortlos, aber seine Augen wurden weit, als jetzt Susanne aus der Tür trat.
»Adrian, was ist?« rief sie entsetzt.
»Mein Vater ist zusammengebrochen«, erwiderte er rauh. »Wieso bist du hier?«
»Paps liegt doch hier, aber er wird morgen entlassen. Was ist mit deinem Vater?«
Geistesabwesend blickte Adrian an ihr vorbei. »Was ist das für ein seltsamer Zufall!«
»Was ist mit dir?« fragte sie ängstlich.
»Ich bin schuld, daß es soweit gekommen ist«, mumelte er. »Aber mir kommt es vor, als sei es nur ein böser Traum. Er ist wahnsinnig, sie müssen alle wahnsinnig gewesen sein, Susanne. Ich kann dich nicht heiraten, es wäre ein Frevel.«
»Willst du mir nicht sagen, was geschehen ist, Adrian?« fragte sie, sich zur Ruhe zwingend.
»Ich kann es nicht, jetzt nicht. Ich müßte wenigstens jetzt Mitleid mit ihm haben und vermag es nicht. Ich wollte doch nur, daß du glücklich wirst. Aber die Cordes bringen Unglück, Susanne.«
»Wir fahren jetzt heim, und du wirst dich beruhigen, Adrian«, sagte sie, tapfer die aufsteigenden Tränen unterdrückend.
»Ich muß mich doch erkundigen, was mit ihm ist«, sagte er gequält. »Man wird es erwarten.«
»Ich kenne die Ärzte, ich werde mich erkundigen«, sagte sie. »Setz dich, Adrian. Möchtest du etwas trinken?«
»Du bist so lieb, viel zu lieb und viel zu schade für einen Cordes«, flüsterte er.
»Ich liebe dich, und daran wird sich nichts ändern«, sagte sie leise, aber sehr bestimmt. Dann holte sie ihm ein Glas Wasser.
Sie setzte sich neben ihn und nahm seine Hand. »Später kannst du mir alles erzählen, Adrian. Ich frage jetzt Dr. Behnisch, was mit deinem Vater ist.«
Sie erfuhr, daß es ein Herzinfarkt war. Jenny Behnisch sagte es ihr.
»Er muß schon lange Herzbeschwerden gehabt haben«, erklärte die Ärztin. »Es ist nicht der erste Infarkt. Aber wahrscheinlich ist der vorhergegangene leichter verlaufen.«
»Wird er überleben?« fragte Susanne.
»Das kann man jetzt noch nicht sagen. Es stürmt jetzt ziemlich viel auf Sie ein, Fräulein Dittmar.«
»Es wäre schlimmer, wenn meinem Vater so etwas passiert wäre«, sagte Susanne leise. »Wenn etwas mit dem Baron ist, rufen Sie bitte mich an.«
Und das so kurz vor der Hochzeit, dachte Jenny Behnisch.
*
Franz und Erna sagten gar nichts mehr, als Susanne mit dem jungen Baron kam und sie ihn gleich zu ihrem Zimmer führte.
»Du legst dich jetzt erst mal hin, Adrian«, sagte Susanne energisch.
»Ich bin nicht krank. Ich muß es dir sagen, Susanne. Ich hätte gar nicht mit dir kommen dürfen.«
»Du tust geradeso, als wärest du an diesem Herzinfarkt schuld«, sagte sie.
»Das bin ich auch. Ich habe ihm einige Wahrheiten gesagt, die schlimm für ihn waren. Aber was ich erfahren habe, ist auch schlimm. Er ist nicht normal. Ich glaube, die Cordes’ waren alle nicht normal, und wenn du alles weißt, wirst du dankend darauf verzichten, den Letzten dieses Stammes zu heiraten.«
»Ich finde, daß du sehr normal bist«, erklärte sie.
»Es war gespenstisch«, flüsterte er. »Wie er da zwischen all den Juwelen saß… grauenhaft.«
»Juwelen?« fragte Susanne. »So rede doch, Adrian. Erzähle, was geschehen ist.«
Stockend begann er zu erzählen, und Susanne lauschte mit angehaltenem Atem.
»Er saß inmitten eines riesigen Vermögens, Susanne, und in seinen Augen brannte der Wahnsinn.«
»Oder nur die Angst, auch das zu verlieren, Adrian«, sagte sie nachdenklich. »Denk doch mal an die Kunstsammler. Sie geben auch ein riesiges Vermögen aus, wenn sie etwas haben wollen, und dann sperren sie es ein, keinem zugänglich, und denen ist es sogar egal, ob das Zeug geklaut ist oder nicht. So was billige ich nicht, Adrian, aber in bezug auf diesen Familienschmuck denke ich doch ein wenig anders. Nimm jetzt um Himmels willen nicht an, daß ich ihn haben will, aber ich sehe das so: Auch einfache Menschen hängen an gewissen Dingen, und die behüten und bewahren sie und möchten sie weitervererben. Ich weiß jetzt soviel über deinen Vater, daß mir klar ist, daß er nie eine richtige Beziehung zum Geld als Zahlungsmittel hatte. Als er jung war, hatte man eine ganz andere Einstellung.
Da gab es diese Standesunterschiede, Herren und Diener. Ich habe mich sehr viel damit befaßt, als ich dich kennenlernte, und viel darüber gelesen. Die Dittmars haben auch einen langen Stammbaum, aber sie waren immer Handwerker, bis Paps dann den Trend der Zeit erfaßte und aus dem, was er ererbt hatte, etwas machte. Aber dein Vater dachte wohl, es geht immer so weiter, und er bekam dann nicht mehr die treudienenden Arbeitskräfte, die alles in Schwung hielten und froh waren, ihr täglich Brot zu bekommen. Er sah dann alles unter seinen Fingern verrinnen, und nur etwas blieb ihm dann, wovon er sich nicht trennen wollte. Eigentlich ist das ein Zug an ihm, der mir außerordentlich sympathisch ist.«
»Der dir sympathisch ist?« staunte Adrian.
»Es gibt doch so viele, die alles vergeuden, denen nichts heilig ist.«
»Er hat aber in früheren Jahren auch munter drauflos gelebt, Susanne.«
»Als er noch bares Geld zur Verfügung hatte. Aber er hat bewahrt, was ihm wohl am wichtigsten erschien. Und das wollte er an dich weitergeben, damit du es auch bewahrst.«
»Aber du solltest es nicht bekommen, nicht meine bürgerliche Frau«, begehrte Adrian auf.
»Nun, vielleicht dachte er dabei, daß Paps schon genug von seinem Besitz hätte. Ich nehme das nicht so tragisch. Er war in einem desolaten Zustand, da redet man wohl manches daher. Wir können ja mal Professor Emmrich fragen, was er dazu meint.«
»So nüchtern siehst du das, Susanne?«
»Soll ich mich aufregen? Du hast dich doch schon genug aufgeregt. Ich kann es doch nicht hinnehmen, daß du erblich belastet sein sollst. Jeder Mensch hat seine Eigenheiten. Es
gibt Geizkragen und Verschwender, Arbeitstiere und Faulpelze, Großzügige und Kleinliche, es gibt Optimisten und Pessimisten. Ich gehöre zu den
Optimisten. Ich ärgere mich manch-
mal sehr, aber ich bin nicht nachtragend. Ich habe an dir gezweifelt,
Adrian, das gebe ich zu, aber nun zweifle ich nicht mehr. Wir werden alles gemeinsam durchstehen. Vielleicht kommt dein Vater doch noch zur Einsicht, wenn er die Krise überwunden hat.«
»Wenn er überlebt«, sagte Adrian leise.
»Er ist zäh«, sagte Susanne.
Ja, er war zäh, der Baron Aribert. Schon am Abend kam er zu sich und fragte nach seinem Sohn. Jenny Behnisch rief Susanne an, und sie begleitete Adrian zur Behnisch-Klinik. Sie wußte, daß sie die Stärkere war, daß Adrian sie brauchte. Und besser konnte sie ihm ihre Liebe auch nicht beweisen.
Vinzenz Dittmar hatte währenddessen schon von Dr. Jenny Behnisch gehört, was sich zugetragen hatte. Er wanderte in seinem Zimmer umher und dachte nach. Dann stand er lange Zeit in Gedanken versunken am Fenster. Er sah Adrian und Susanne vom Parkplatz herüberkommen, zog seinen Hausmantel an und ging ihnen entgegen.
»Du solltest schlafen, Paps«, sagte Susanne etwas stockend.
»Ein bißchen viel verlangt, bei allem, was mir durch den Kopf geht«, brummte er. Er drückte Adrian die Hand. »Wir haben deinem Vater wohl ein bißchen zu sehr zugesetzt. Ist er ansprechbar?«
Adrian nickte. »Man ließ mich rufen.«
»Dann sag ihm, daß er wohnen bleiben soll, aber er muß sich einverstanden erklären, daß das Haus renoviert wird. Für euch wird sich schon eine andere Bleibe finden lassen. Wir werden das in Ruhe überlegen.«
»Danke«, sagte Adrian, dann küßte er Susanne schnell auf die Stirn. »Du kannst dem Paps alles erzählen, Liebes. Ich komme dann nachher und hole dich.«
*
Das Gesicht des Barons schien nur aus Haut und Knochen zu bestehen, wie eine Maske lag es auf dem Kopfkissen.
»Ich weiß nicht, wie es passieren konnte«, flüsterte er schleppend. »Das Herz will nicht mehr, Adrian. Es ist müde.«
»Es wird schon wieder besser, Vater. Vinzenz läßt dir sagen, daß du wohnen bleiben kannst. Du wirst eine längere Kur machen, und dann wird das Haus renoviert. Du willst doch, daß es erhalten bleibt.«
»Ich werde es wohl nicht mehr brauchen. Du bist der letzte Cordes, Adrian, daran will ich dich erinnern. Du darfst den Namen nicht ablegen. Versprich mir, daß du es nicht tun wirst.«
»Ich verspreche es dir, Vater. Es sind harte Worte gefallen, aber…«
»Auch von mir«, fiel ihm der Kranke ins Wort. »Bring die Truhe in Sicherheit. Wenn ich nicht mehr bin, kannst du damit machen, was du willst. Eine neue Zeit ist angebrochen. Ich habe es endlich begriffen. Das wollte ich dir sagen.«
»Und vielleicht kommt nun eine bessere Zeit für dich, wenn du dich dem Fortschritt nicht mehr verschließt, Vater.«
»Ist es nicht schon zu spät? Ich habe zu viele Fehler gemacht. Meine törichte Einstellung…«
»Sprich nicht so viel. Du brauchst Ruhe.«
Da kam auch schon Dr. Behnisch mit einer Injektion.
»Jetzt soll unser Patient wieder schlafen«, sagte er freundlich. »Dann geht es morgen bestimmt gleich noch besser.«
Er nickte Adrian aufmunternd zu, und selbst auf dem eingefallenen Gesicht des Barons erschien ein schattenhaftes Lächeln.
»Ein optimistischer Doktor«, murmelte er. »Dann kommst du morgen wieder, Adrian?«
»Ja, gewiß, Vater. Schlaf gut.« Aber der Kranke war schon eingeschlafen.
»Wir können zuversichtlich sein«, sagte Dr. Behnisch.
»Sie wissen, wo ich zu erreichen bin. Vielen Dank für Ihre Bemühungen, Herr Doktor.«
Adrian ging zu Vinzenz Dittmars Zimmer. Der hatte inzwischen von Susanne erfahren, was sich zwischen Vater und Sohn Cordes getan hatte.
»Ein Haufen Juwelen«, brummte Vinzenz. »Totes Kapital.«
»Traditionsbewußtsein, Paps«, sagte Susanne.
»Guter Gott, und was hat man davon?«
»Du hängst doch auch an den alten, ererbten Dingen, an den Möbeln und Schnitzereien.«
»Aber ich schaue sie tagtäglich an und verschließe sie nicht. Das ist doch eine Marotte.«
»Es gibt auch Marotten, die schmerzhafter sind, Paps. Zum Beispiel, wenn sich zwei Menschen, die sich sehr gern haben, wegen läppischer Kleinigkeiten und aus Rechthaberei trennen.«
»Gib’s mir nur auch ordentlich. Hast ja recht. Solche Erkenntnisse kommen einem manchmal spät.«
»Jetzt wird sich unser Familienleben wohl hoffentlich soweit normalisieren, daß ihr euch nicht mehr aus dem Wege geht.«
»An mir soll es nicht liegen, Susi.«
Dann kam Adrian. Erwartungsvoll sahen ihn beide an. »Dr. Behnisch ist zuversichtlich. Vater hat auch ganz klar gesprochen. Können wir jetzt noch hinausfahren, Susanne? Ich muß etwas in Sicherheit bringen.«
»Nehmt mich doch gleich mit«, bat Vinzenz.
»Das könnte dir so passen«, widersprach Susanne. »Sei du nur froh, daß dein Blutdruck wieder herunter ist. Du hast mir versprochen, dich zu schonen.«
»Die Hochzeit muß doch jetzt wohl sowieso aufgeschoben werden«, wandte Vinzenz ein.
»Das steht noch nicht fest«, erklärte Adrian. »Vater wollte sich ja ohnehin mit Unpäßlichkeit entschuldigen. Man soll den Teufel nicht an die Wand malen. Das hat sich mal wieder bewahrheitet.«
»Morgen holen wir dich ab, Paps«, sagte Susanne tröstend. »Schlaf dich noch mal ordentlich aus.«
»Das kann ich in meinem Bett besser«, brummte Vinzenz.
Susanne tätschelte ihm lächelnd die Wange. »Wer A sagt, muß auch B sagen. Ich finde, daß die paar Tage dir sehr gut getan haben. Du siehst viel besser aus.«
*
»Es brennt Licht«, sagte Adrian betroffen, als sie das Gutshaus erreichten. »Das ist merkwürdig. Um diese Zeit sind Joseph und Selma doch längst im Bett.«
»Einbrecher?« flüsterte Susanne atemlos.
»Du bleibst hier«, sagte er. »Ich schleiche mich mal hinein.«
»Es kommt gar nicht in Frage, daß ich dich allein lasse«, sagte sie mutig. Und als sie dann leise die Diele betraten, vernahmen sie Selmas aufgeregte Stimme. »Das geht aber wirklich nicht, Herr Graf. Wir haben Ihnen doch gesagt, daß der Herr Baron in der Klinik ist. Sie können doch nicht einfach wertvolle Sachen mitnehmen.«
»Wir haben sie gekauft«, ertönte die Männerstimme. »Zetern Sie nicht, Selma. Bald wird hier alles verkauft sein.«
Mit grimmiger Miene stieß Adrian die Tür auf. »Wer behauptet das?« fragte er zornentbrannt.
Susanne sah zuerst Tatjana, deren Blick jetzt aber starr auf Adrian gerichtet war.
»Das ist ja interessant«, sagte der, »man ist sogar unter die Diebe gegangen. Ruf bitte die Polizei an, Susanne.«
»Wir holen nur, was wir gekauft haben«, zischte Tatjana, während ihr Bruder nach Worten rang.
»Und wovon, bitte, habt ihr etwas gekauft?«
»Es war so«, begann Selma schluchzend. »Sie wollten zum Herrn Baron, und da habe ich gesagt, daß er in der Klinik ist und Sie auch nicht da sind.«
»Und da wollte man die Gelegenheit nützen, einiges beiseite zu schaffen«, sagte Adrian verächtlich. »Mein Vater hat kein Stück verkauft bisher. Er konnte es gar nicht, weil er alles mir überschrieben hat. Siehst du, Susanne, nun lernst du diese feine Gesellschaft richtig kennen.«
»Ich muß doch sehr bitten, Adrian«, stieß Eduard Almassy hervor. »Wir haben berechtigte Ansprüche zu stellen. Aber darüber sollten wir uns besser allein unterhalten.«
»Vor Gericht«, sagte Adrian zornig. »Und wir werden sehen, was mein Vater dazu sagt.«
Susanne hatte nach dem Telefon gegriffen, aber nun sagte sie sarkastisch: »Vielleicht verlassen die feinen Herrschaften freiwillig das Haus.«
»Wir werden ja sehen, was dich ein gebrochenes Eheversprechen kosten wird, Adrian«, sagte Tatjana schrill. »Dein Vater…«
»Laß meinen Vater aus dem Spiel. Ich habe niemandem ein Eheversprechen gegeben, außer meiner Verlobten, also konnte ich auch keines brechen. Abmachungen, die mit meinem Vater getroffen wurden und die er wahrscheinlich längst bereut, gelten für mich nicht. Aber wie schon gesagt, können wir das vor Gericht klären lassen. Wenn ihr jetzt nicht sofort verschwindet, wird die Polizei geholt.«
Da zogen sie es doch vor, das Feld zu räumen. Tatjanas haßerfüllte Blicke ließen Adrian ebenso kalt wie Susanne. Selma rang schluchzend die Hände.
»Wo ist denn Joseph!« fragte Adrian.
»Er schläft doch. Er hört nichts. Und ich konnte doch nicht gehen und ihn wecken. Ich mußte doch hierbleiben.«
Ein Motor heulte auf. »Jetzt fahren sie weg«, sagte Adrian. »Den Wagen haben sie wohlweislich anderswo geparkt, sonst hätte ich ja gleich gewußt, mit wem wir es zu tun haben. Da siehst du, wie tief Menschen sinken können, auch wenn sie ein von vor dem Namen haben, Susanne. Aber ich habe meinem Vater das Versprechen geben müssen, den Namen nicht abzulegen.«
»Wolltest du denn das?« fragte Susanne bestürzt.
»Vielleicht wäre ich mit dem Namen Dittmar besser bedient«, erwiderte er.
Jetzt war Susanne erst einmal sprachlos, aber dann bewies sie wieder, wie schnell sie schalten konnte.
»Man kann auch beide Namen koppeln«, erklärte sie. »Adrian und Susanne Dittmar von Cordes klingt nicht übel.«
»Du bist umwerfend«, sagte er zärtlich, und dann hielt er sie lange fest in seinen Armen. Selma hatte sich leise zurückgezogen, aber später klopfte sie noch einmal schüchtern an und fragte, ob sie etwas bringen könne.
»Wir bedienen uns selbst, gehen Sie ruhig schlafen, Selma. Sie werden noch eine Belohnung bekommen für Ihr mutiges Auftreten.«
»Ich habe diese Leut’ nie gemocht«, brummte Selma. »Immer sind die falschen Leut’ hergekommen. Aber jetzt wird es wohl anders werden«, schloß sie hoffnungsvoll, mit einem wohlwollenden Blick auf Susanne.
Adrians Aufmerksamkeit galt jetzt der Truhe, die nicht mehr direkt unter dem Bild stand.
»Daran haben sie sich auch zu schaffen gemacht«, sagte er. »Gut, daß ich die Schlüssel eingesteckt habe. Willst du sehen, welchen Schatz die Cordes’ angesammelt haben?«
»Mein Schatz bist du«, sagte Susanne schelmisch. »Ich will keinen anderen.«
»Vater hat gesagt, daß ich damit machen kann, was ich will, wenn er nicht mehr lebt.«
»Dann wollen wir hoffen, daß er noch lange genug lebt, um selbst entscheiden zu können«, sagte sie, »und laß dir ja nicht einfallen, mir kostbaren Schmuck zu schenken, den wir dieser Sammlung auch einverleiben müssen.«
»Es beginnt eine neue Zeit für uns, Susanne. Auch Vater scheint es begriffen zu haben.«
Sie ging schon gedankenverloren durch die Räume. »Wieviel Werte«, sagte sie sinnend, »und von nichts wollte er sich trennen. Er wollte sogar eine bürgerliche Schwiegertochter in Kauf nehmen, um sich dies zu erhalten.«
»Und mir«, sagte Adrian, »das muß ich ihm zugute halten. Er hat nur nicht damit gerechnet, daß die Liebe stärker ist, die lebendige Liebe. Nicht die zu toten Dingen.«
»Er kann nicht aus seiner Haut heraus.«
»Die Fürstin Ravensport geht doch auch mit der Zeit«, sagte Adrian nachdenklich.
»Die Menschen sind verschieden, mein Schatz. Was machen wir nun mit der Truhe?«
»Wir stellen sie dorthin, wo sie immer stand, falls du so viel Kraft aufbringst, sie da hinaufzuhieven und ich den Mechanismus finde, der das Sesam öffne dich bedeutet.«
Das dauerte zwar ziemlich lange, aber er fand ihn, und Susanne riß die Augen weit auf.
»So was gibt es tatsächlich«, staunte sie. »Wenn ich in Romanen davon las, wünschte ich mir immer, daß wir auch so etwas haben könnten, aber Paps hat seine Stahlschränke. Ich finde das toll. Und davon hast du auch keine Ahnung gehabt?«
»Bis heute nicht. Da siehst du mal, wie die Cordes’ ihren Söhnen vertrauten. Es hätte ja auch sein können, daß Vater ganz plötzlich gestorben wäre. Dann hätte ich das nie erfahren. Das Geheimfach wäre dann wohl erst entdeckt worden, wenn das Haus abgerissen worden wäre.«
»Es wird nie abgerissen«, sagte Susanne. »Und bestimmt hätte sich ein Hinweis gefunden, daß es dieses Geheimfach und die Truhe gibt. Bei so viel Tradition denkt doch ein Cordes an alles.«
»Kluges Mädchen«, sagte er jetzt lächelnd.
»Ich habe einen sehr cleveren Vater, im Gegensatz zu dir«, sagte sie. »Ich habe dir doch schon gesagt, daß du keinen besseren Lehrmeister finden kannst.«
»Hoffentlich enttäusche ich ihn nicht.«
»Wenn du ein hoffnungsloser Fall wärest, hätte Paps niemals ja gesagt zu unserer Ehe, das darfst du glauben, Adrian. Ich bin ihm doch mehr wert als ein Seegrundstück und ein paar Wiesen und Felder, und der Name allein macht es auch nicht. Er mag dich.«
»Da habe ich aber wirklich Glück gehabt«, sagte Adrian. »Alles, was nicht gut war, werden wir vergessen.«
»Ganz schnell«, flüsterte sie. »Darin habe ich ein ganz besonderes Talent, liebster Adrian.«
*
Vinzenz war daheim, und im Befinden des Barons war eine erstaunliche Besserung eingetreten. Er war derzeit zufriedener und auch friedlicher als Vinzenz.
Der grollte, weil Melanie jetzt keine Zeit für ihn hatte. »Fang bloß nicht wieder an mit der Meckerei, Paps«, sagte Susanne warnend. »Mami muß die Kleider für Professor Emmrichs Fest fertigbringen. Die Zeit vergeht so schnell.«
Ja, das empfanden sie alle, und der große Tag stand schon vor der Tür. Melanie war nicht zu bewegen gewesen, die Einladung anzunehmen, und Lore hatte Verständnis für ihr Argument. Acht Kleider aus ihrem Salon würden vertreten sein, und die beiden schönsten waren die von Fee Norden und Lore. Die beiden hatten ja auch den besten Geschmack, aber Melanie konnte sich recht gut vorstellen, wie die anderen, die nie genau wußten, was sie eigentlich wollten, dann untereinander tuscheln würden. Es genüge, wenn Susanne und Adrian die Familie vertreten würden. Sie hatte sich für diesen Abend schon etwas anderes vorgenommen, und dabei steckte sie wieder einmal mit ihrer Tochter unter einer Decke.
»Du kannst deinem lieben Paps ja ein bißchen Dampf einlassen«, sagte sie. »Er soll jetzt mal den Weg zu mir finden. Du wirst das schon irgendwie deichseln, Kleines.«
»Er traut sich bloß nicht, Mami. Da ist er wie ein Schulbub. Er hat doch so wahnsinnigen Respekt vor dir, wie du alles so elegant über die Bühne bringst.«
»Bei deinem Schwiegervater scheine ich nicht den besten Tag gehabt zu haben«, sagte Melanie seufzend. »Er war von mir keineswegs beeindruckt.«
»Vielleicht zu sehr, aber bevor er etwas zugab, mußte er erst mal einen Herzinfarkt kriegen. Jetzt kommt
Adrian schon ganz gut mit ihm zurecht.«
»Bevor er dich nicht regelrecht kniefällig um Verzeihung bittet, bin ich zu keinem Zugeständnis bereit«, sagte Melanie.
»Stur wie immer«, sagte Susanne. »Ich bin da anders. Warum soll man sich und damit auch andern das Leben schwermachen. Eins habt ihr mit eurer Scheidung erreicht bei mir. Ich bin tolerant geworden. Aber ich bin auch nicht von dem Ehrgeiz besessen, unbedingt emanzipiert zu sein. Ich werde meinem Mann immer das Gefühl geben, daß er der Herr im Hause ist.«
»Adrian läßt sich ja auch von dir um den Finger wickeln. Das hätte ich niemals für möglich gehalten.«
»Gewußt wie«, sagte Susanne mit einem schelmischen Lachen.
»Soll es nun bei dem Hochzeitstermin bleiben?« erkundigte sich Melanie noch, als Susanne schon wieder enteilen wollte.
»Ich denke schon. Es könnte ja sein, daß es mir sonst so geht wie Dotty, und ich in mein Hochzeitskleid nicht mehr hineinpasse. Aber keine Aufregung, Mami, gar so schnell nimmt man nicht zu. Tschüs!«
»Susanne«, rief Melanie atemlos.
»Keine Zeit mehr, Mami. Trink ein Schlückchen Sekt.« So einfach war es bei ihr, und Melanie konnte nicht anders, sie mußte lachen. Daß ihr dabei die Tränen kamen, war nur darauf zurückzuführen, daß eine tiefe Rührung von ihr Besitz ergriff.
Dieses Kind, dachte sie, nie hat sie uns Sorgen bereitet, nie hat sie uns Vorwürfe gemacht. Ihr müßt wissen, was für euch gut ist, hat sie immer gesagt. Und so wird sie auch wissen, was für sie selbst gut ist. Und dann faßte sie einen heroischen Entschluß. Sie rief ihren Mann an.
Sie spürte, wie er den Atem anhielt, wie seine Stimme zitterte, als er ihren Namen aussprach.
»Ich will dir einen Vorschlag machen, Vinzenz«, sagte sie. »Wenn bei den Emmrichs das Fest steigt, könntest du doch mal zu mir kommen, wenn es dich nicht zuviel Überwindung kostet. Dann habe ich den Streß hinter mir, und wir könnten über die Hochzeit reden.«
»Ich komme gern, Melanie«, erwiderte er, nichts weiter. Die Freude schnürte ihm die Kehle zu. Als Susanne heimkam und beim Kaffeetrinken dann ganz beiläufig sagte: »Eigentlich könntest du Mami ja mal einen Anstandsbesuch machen, da sie dich ja auch nicht im Stich gelassen hat«, erwiderte er. »Nett, daß du mich daran erinnerst. Ich werde sie besuchen, wenn ihr auf dem Fest von Emmrich seid.«
»Und die Idee ist deinem weisen Haupt entsprungen?« scherzte sie ungläubig.
»Der Vorschlag kam von Melanie«, gab er ehrlich zu. »Es hat mich sehr gefreut. Ich will mich ja nicht aufdrängen. Es hätte ja auch sein können, daß sie mit euch geht.«
Mami muß es loswerden, daß sie Großmutter wird, ging es Susanne durch den Sinn, und sie lachte leise. »Warum lachst du?« fragte ihr Vater.
»Das wirst du ganz bestimmt von Mami erfahren. Gedulde dich noch den einen Tag, Paps.«
»Habt ihr etwas ausgeheckt? Mit mir könnt ihr es ja machen.«
»Ich möchte Mami nur die Freude nicht verderben, dein Gesicht zu sehen«, sagte Susanne. Und erst recht war sie auf Adrians Gesicht gespannt, aber ihm wollte sie es erst nach dem Fest sagen.
*
Da kam es dann so, wie Melanie es vorausgesehen hatte. Die Schönste war Fee, die Dezenteste und zugleich Vornehmste war Lore. Susanne und Dotty drängten sich nicht in den Vordergrund. Es wurde getuschelt, nachdem die Gratulationscour beendet war, aber dann verkündete Professor Emmrich die Verlobung seiner Tochter mit Jürgen Richter, und da gab es dann noch anderen Grund zum Tuscheln, als über die Roben der Damen. Und natürlich blieben dabei auch Susanne und Adrian nicht unbeachtet. Aber was machte es ihnen aus!
Sie freuten sich mit Dotty und Jürgen, und der taute doch tatsächlich auf und bewies, daß er auch Humor besaß. Er war überglücklich, daß er von seinen Schwiegereltern so herzlich aufgenommen worden war, und daß sie sich gemeinsam auf das Baby freuen konnten. Es wurde ein gelungenes Fest, und als sie heimwärts fuhren, fragte Adrian: »Ob deine Eltern auch so tolerant wären, wenn wir sie schon vor der Hochzeit mit einem Baby beglücken würden?«
»Das werden wir sehr bald erfahren, mein Schatz«, lachte Susanne. »Ich nehme an, daß dies das Gesprächsthema zwischen ihnen am heutigen Abend gewesen sein wird.«
Adrian begriff nicht gleich, aber Susanne machte es ihm auf die bezauberndste Art klar. Darin war sie ganz die Tochter ihrer Mutter. Auch Vinzenz begriff zuerst gar nicht, was sie meinte, als sie darüber sprach, daß sie ja nun bald Großeltern werden würden. Er hatte es genossen, bei Melanie zu sitzen, in dieser wunderschönen Wohnung, hatte sich wieder ganz einfangen lassen von ihrem Charme, und sie war gerührt gewesen, als er mit einem riesigen Rosenstrauß gekommen war und dann ganz schüchtern ein schmales Etui neben ihren Teller gelegt hatte. Eine wunderschöne Armbanduhr hatte sie darin vorgefunden.
»Damit du weißt, was die Glocke geschlagen hat«, sagte er schwerfällig. Ein Charmeur war er ja nie gewesen, aber sie hatte derer genug kennengelernt seit ihrer Scheidung und wußte seine Aufrichtigkeit jetzt doppelt zu schätzen.
»Wir sind klüger und älter geworden, Vinzenz«, sagte sie mit einem weichen Lächen, »und wenn wir nun bald Großeltern werden, sollten wir uns vertragen. Es wäre doch nicht gut, wenn unser Enkelkind auch hin und her gerissen würde. Es hat ja nur ein Großelternpaar.«
»Es ist schön, daß du so denkst, liebe Melanie.« Er schöpfte tief Atem. »Darf ich hoffen, daß du zu mir zurückkehrst?«
So hatte sie es eigentlich nicht gemeint, aber sie brachte es jetzt nicht fertig, ihn vor den Kopf zu stoßen.
»Wir könnten uns arrangieren«, sagte sie diplomatisch. »Meinen Salon möchte ich schon noch einige Zeit behalten. Das Geschäft läuft gerade so prächtig, und wir müssen ja dem Baron wieder auf die Beine helfen. Und schließlich müssen wir auch an unsere Enkel denken, Vinzenz «
Liebe Güte, begreift er denn nicht, dachte sie dabei. Aber er begriff noch immer nicht.
»Das können wir, wenn sie da sind«, erklärte er gemächlich. »Mir wäre es recht, wenn wir jetzt an uns denken würden, Melanie. Meinetwegen kannst du den Salon ja behalten, wenn dir so viel daran liegt. Ich werde ja auch noch eine ganze Zeit zu tun haben, bis ich Adrian angelernt habe. Dumm ist der Junge ja nicht. Ihm fehlt nur die nötige Praxis. Mit Menschen kann er besser umgehen als ich, das muß man ihm lassen.«
»Er ist ja auch kein Junge mehr, sondern sechsundzwanzig Jahre, lieber Vinzenz. Und das Bewußtsein, für Frau und Kind sorgen zu müssen, wird ihm schon auf die Sprünge helfen.«
Da schlug bei ihm doch ein Glöckchen an. »Du meinst, daß sie sich sehr schnell ein Kind anschaffen?« fragte er.
»Anschaffen sollte man nicht sagen. Das passiert manchmal schneller, als man denkt. Wobei ich meinen möchte, daß Susanne es so gewollt hat.«
»So gewollt hat«, wiederholte er zögernd, »so gewollt hat.« Und dann lachte er dröhnend. »Ich habe eine lange Leitung, Melanie-Schatz!«
»Die hattest du schon immer, zumindest im privaten Bereich. Aber das macht nichts. Ich sehe, daß du dich nicht geändert hast.«
»Warum hat sie es mir nicht auch gesagt?« tat er dann beleidigt.
»Weil man so was meist zuerst der Mutter sagt, aber sie hat es ganz einfach so zwischen Tür und Angel fallen lassen, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt. Ja, mein lieber Vinzenz, nun wirst du nicht nur Schwiegervater, sondern auch Großpapa.«
»Und du nicht nur Schwiegermutter, sondern Großmama. Aber ganz bestimmt wirst du die schönste Großmama auf Gottes weitem Erdenrund sein.«
»Solche Komplimente hast du früher nie gemacht«, lächelte Melanie.
»Da war ich so an dich gewöhnt, und ehrlich gesagt warst du da auch noch nicht so schön«, meinte er neckend.
»lch mußte mich eben erst mausern.«
»Und ich mußte erst zu der Erkenntnis kommen, was du mir bedeutest.« Er zog sie in seine Arme und küßte sie, und sie ließ es sich gefallen, und Susanne konnte sich am nächsten Morgen nur wundern, daß ihr Paps nicht am Frühstückstisch erschien und Erna mißbilligend bemerkte, daß er gar nicht heimgekommen sei.
»Das ist ja wunderbar«, freute sich Susanne. »Das klappt besser, als ich dachte. Er ist bei seiner Frau, Erna.«
»Hat er eine neue Frau?« fragte Erna bestürzt.
»Er hat seine alte Frau neu entdeckt«, lachte Susanne, »aber lassen wir es Mami nur nicht hören, daß ich alt gesagt habe.«
*
Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, und an großen Ereignissen sollte es in der folgenden Zeit nicht fehlen. Der Baron war soweit genesen, daß er zur Insel der Hoffnung gebracht werden konnte. Das hatte Dr. Norden schnell organisiert, und der Patient hatte sich auch nicht mehr dagegen gesträubt. Es wäre auch besser, wenn er bei der Hochzeit nicht dabei sein würde, hatte er zu Adrian gesagt. Er brauche Zeit, um ganz mit allem fertig zu werden, was er selbst verschuldet hätte.
Er konnte nicht so schnell von einer Haut in die andere schlüpfen, aber an Einsicht fehlte es ihm jetzt nicht mehr. Sein Starrsinn, seine Ungerechtigkeit waren ihm bewußt geworden, und ebenso, daß er sich nur mit falschen Freunden umgeben hatte, als er von Adrian erfuhr, wozu die Almassys fähig gewesen waren.
»Es ist wohl ganz gut, daß der Herrgott mir noch Zeit läßt, meine Sünden zu büßen«, sagte er, »und vielleicht wird mir Susanne dann doch wieder die Hand reichen.«
»Du hättest nur ein Wort zu sagen brauchen, Vater, sie wäre gekommen«, sagte Adrian.
»Es braucht seine Zeit. Ich schäme mich.«
Und das waren wohl die versöhnlichsten Worte, die er sagte. Da mochte dann geredet werden, was immer die Leute wollten und dachten, als Adrian von Cordes seine geliebte Susanne zum Traualtar führte, und man eine kleine, aber erlesene Gesellschaft folgen sah. Bürgerliche und Aristokraten in herzlicher Freundschaft vereint. Melanie und Vinzenz Dittmar Arm in Arm, und zur Freude aller Anwesenden hatten sie sich am gleichen Tag zum zweiten Mal das Jawort gegeben.
»Aber jetzt gibt es keine Scheidung mehr in unserer Familie«, hatte Susanne als Glückwunsch gesagt.
»Das werden wir doch unseren Enkeln nicht antun«, sagte ihr Vater.
»Und wir nicht unseren Kindern«, raunte Adrian seiner bezaubernden Frau ins Ohr.
Gleich nach dem Hochzeitsmahl, während die anderen in bester Stimmung waren, brachen sie auf nach Tirol. In dem Haus, in dem sie ganz zueinander gefunden hatten, wollten sie die erste Woche ihres Ehelebens verbringen. Dann schon sollte die nächste Hochzeit gefeiert werden, und bei der durften sie auch nicht fehlen, waren sie es doch gewesen, die Dotty und Jürgen so schnell zu ihrem Glück verholfen hatten.
Im Gutshaus waren schon die Handwerker am Werk. So, wie Melanie es sich vorgestellt hatte, sollte es auch werden.
»Der Aribert wird schon einsehen daß es für ihn allein viel zu groß ist«, sagte sie, »und die Kinder können hier in gesunder Luft aufwachsen. Wir werden uns schon einigen. Diesmal fasse ich ihn mit Samthandschuhen an. Meine Wohnung hat ihm sehr gefallen. Die kann er haben, da wir ja nun nicht mehr von Tisch und Bett getrennt sind, Vinzenz. Man muß es nur richtig anfangen, um mit den Menschen klar zu kommen. Damals hatte ich eine Mordswut auf ihn, jetzt ist das anders. Eigentlich ist er ja zu bedauern.«
»Na, hoffentlich geht alles gut«, meinte Vinzenz skeptisch. »Aber ich kann ihm ja auch ein Haus am See anbieten.«
»Uns geht es verdammt gut«, sagte Melanie. »Dafür müssen wir dankbar sein.«
»Wir sind ja auch tüchtige und fleißige Leute«, meinte er.
*
Als fleißig und tüchtig erwiesen sich auch Adrian und Jürgen, aber Susanne hatte es ja gesagt, daß ihr Paps der beste Lehrmeister sei.
Darüber hatte wohl auch der Baron nachgedacht in den zwei Monaten, die er auf der Insel verbracht hatte. Aber Dr. Norden sagte ja, daß dem nicht zu helfen sei, der dort nicht eine neue Einstellung zum Leben fände. Auch Aribert von Cordes hatte sie gefunden. Als Adrian und Susanne ihn abholten, küßte er seiner Schwiegertochter zärtlich die Hände.
»Verzeih, was ich einmal sagte, Susanne«, bat er.
»Ist doch längst vergessen«, erwiderte sie. »Wir freuen uns, daß es dir wieder gutgeht.«
Was niemand sonst vollbrachte, dem Kind, dem Susanne im Frühsommer des kommenden Jahres das Leben schenkte, blieb es vorbehalten, das Herz des Barons ganz zu öffnen. Es war ein kräftiger Sohn. Nicht eine Minute war Adrian von der Seite seiner Frau gewichen, und dann umarmten sie sich so überglücklich wie Vinzenz und Melanie.
Sie hatten es kaum noch erwarten können, da Wilfried und Lore Emmrich sich schon drei Monate an einer wonnigen kleinen Susanne freuen konnten.
Aber nun hatten sie einen Sohn. Einen Adrian Daniel Alexander Dittmar von Cordes.
Nicht ein Wort des Widerspruchs war von Aribert von Cordes erfolgt, daß sein Sohn auch den Namen seiner Frau angenommen hatte. Er wußte jetzt, daß er den Dittmars ein zufriedenes und sorgloses Leben zu verdanken hatte, und er war dankbar, daß er in dem Haus, das nun der jungen Generation gehörte, und das Melanie wirklich so wundervoll umgestaltet hatte, herzlich willkommen war.
Er ließ Susanne die Truhe mit den Juwelen bringen. »Jetzt gehört sie dir«, sagte er. »Du kannst damit machen, was du willst.«
»Sie kommt wieder in ihr Verlies, Vater«, sagte Susanne. »Wer weiß, was für Zeiten kommen. Vielleicht wird dadurch künftigen Generationen zum Überleben verholfen. So mögen eure Vorfahren wohl auch gedacht haben.«
So war Susanne, und damit gewann sie aller Herzen, auch dieses einst so verbitterte. Aber sie machte ihrem Schwiegervater dann doch die Freude, zur Taufe ihres ersten Sohnes das Diadem zu tragen, das Adrians Mutter zu seiner Geburt bekommen hatte.
»Wahrlich eine Königin«, flüsterte der Baron mehr zu sich selbst, als er sie so sah.
»Die Königin meines Herzens, Vater«, sagte Adrian.