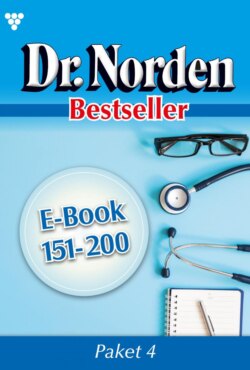Читать книгу Dr. Norden Bestseller Paket 4 – Arztroman - Patricia Vandenberg - Страница 20
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDr. Daniel Norden hielt den Telefonhörer fest an sein Ohr gepreßt, weil er die leise Stimme am anderen Ende des Drahtes kaum vernehmen konnte. Sein Gesicht hatte einen wirklich ernsten, sehr nachdenklichen Ausdruck.
»Selbstverständlich komme ich, Victor«, sagte er. »Bitte, resigniere nicht!« Dann lauschte er wieder, und ein Zucken lief über sein gebräuntes Gesicht. »Ja, ich komme noch heute, es ist versprochen.«
Dann saß er minutenlang, in sich versunken, am Schreibtisch, bevor er seine Frau anrief. Fee meldete sich sofort. Sie hatte schon auf ihren Mann gewartet.
»Feelein, ich muß zur Riebeck-Klinik fahren. Es wird wohl ziemlich spät werden«, sagte er.
»Was ist los, Daniel?« fragte Fee bestürzt.
»Ich erzähle es dir später. Es ist nichts fürs Telefon«, erwiderte er.
Also wieder mal eine ganz ernste Geschichte, dachte Fee.
»Kommt Papi immer noch nicht?« fragte Danny, ihr Ältester.
»Er muß noch etwas erledigen. Wir essen jetzt, sonst wird es für euch zu spät«, sagte sie gedankenverloren.
»Will aber Papi Bussi geben«, meldete sich die kleine Anneka jetzt zu Wort.
»Das vergißt er bestimmt nicht, auch wenn ihr schon schlaft«, erwiderte Fee.
»Schlafe aber nicht, wenn Papi nicht da ist«, sagte Anneka weinerlich. Sie hatte wieder einmal eine ganz besonders anhängliche Phase, wie immer, wenn in der Praxis sehr viel zu tun war und ihr heißgeliebter Papi nie pünktlich zu Tisch erschien.
Dr. Norden war bereits auf dem Weg zur Riebeck-Klinik.
Durch die ganze Stadt mußte er, und da herrschte jetzt viel Verkehr. Doch der Anruf von Victor Wagner war so dringlich gewesen, daß er noch einen weiteren Weg auf sich genommen hätte.
Vic! Ein Dutzend Jahre mußte es her sein, daß sie sich nicht gesehen hatten. Im Hörsaal hatten sie meistens nebeneinander gesessen. Daniel Norden, der genau wußte, was er wollte, und Victor Wagner, der sich bis zuletzt nicht entscheiden konnte, welches Spezialgebiet er wählen sollte.
Daniel sah ihn vor sich. Mittelgroß, sehr schlank, sehr jungenhaft aussehend war Vic gewesen und eigentlich immer gut aufgelegt, manchmal sogar ein bißchen leichtsinnig. Und Geld hatte er gehabt, Geld wie Heu, wie seine Kommilitonen sagten. Und dieser Vic sollte todkrank sein?
Daniels Augenbrauen schoben sich zusammen. Er mußte sich auf den Verkehr konzentrieren, und da krachte es auch schon vor ihm. Er konnte noch rechtzeitig bremsen und war schnell aus dem Wagen. Jetzt dachte er nicht mehr an Vic, jetzt wollte er zur Stelle sein, wenn ärztliche Hilfe gebraucht wurde. Und die wurde gebraucht. Es gab zwar keine Schwerverletzten, aber in dem Wagen, auf den ein junger Bursche aufgefahren war, saß ein kleines Kind auf dem Rücksitz, das durch den Aufprall das Bewußtsein verloren hatte. Die junge Mutter stand auch unter einem Schock.
Schon war auch die Funkstreife zur Stelle. Dr. Norden wies sich aus. »Ich bin auf dem Weg zur Riebeck-Klinik«, sagte er. »Ich kann Mutter und Kind gleich zu einer Untersuchung mitnehmen.«
»Sind Sie einverstanden?« wurde die junge Frau gefragt.
Sie nickte verstört und weinte leise, als sie das Kind in die Arme nahm.
»Ganz ruhig«, sagte Dr. Norden tröstend. »Es ist bestimmt nicht schlimm. Es ist nur eine Vorsichtsmaßnahme, wenn ich auf einer Untersuchung bestehe. Auch ein Schock kann Nachwirkungen haben.«
Zur Riebeck-Klinik war es jetzt nicht mehr weit. Der Kleine kam zu sich und begann fürchterlich zu schreien, aber als seine Mutter beruhigend auf ihn einredete, beruhigte er sich und schluchzte nur noch leise vor sich hin.
»Wie heißen Sie?« fragte Daniel.
»Claudia Fiebig«, erwiderte die junge Frau leise, »und das ist mein Sohn Daniel.«
»Wie nett, ich heiße auch Daniel«, sagte Dr. Norden aufmunternd und nannte dann auch seinen Nachnamen.
»Mein Mann wird sich schrecklich aufregen«, flüsterte Claudia. »Er denkt bestimmt, daß ich schuld war.«
»Ich kann bezeugen, daß Sie es nicht waren«, erwiderte Daniel ruhig.
»Martin wollte nie, daß ich fahre«, murmelte sie, »aber ich schaffe es sonst doch gar nicht. Ich bin berufstätig, muß den Kleinen in den Kindergarten bringen und abholen, und dann auch noch einkaufen. Es ist nicht so einfach.«
»Das weiß ich, ich kenne solche Fälle zur Genüge«, sagte Dr. Norden. »Und so ist es nur gut, wenn Ihnen bescheinigt wird, daß Sie einige Tage zu Hause bleiben müssen, um diesen Schock zu überwinden.«
»Damit wird wieder mein Chef nicht einverstanden sein«, sagte Claudia leise.
Und nun waren sie schon bei der Riebeck-Klinik angekommen.
»Wir unterhalten uns nachher noch«, sagte Dr. Norden. »Sie werden untersucht, und ich bringe Sie dann nach Hause. Recht so?«
»Sie sind sehr nett.Würden Sie bitte meinen Mann anrufen?« bat sie schüchtern. »Ich traue mich nicht. Daß das Auto kaputt ist, wird ihn wütend machen.«
»Er soll froh sein, daß Ihnen und dem Kind nichts Schlimmeres passiert ist«, sagte Dr. Norden. »Ja, ich rufe ihn an.«
Er vertraute Claudia Fiebig und den kleinen Daniel dem Oberarzt an, der sofort aufhorchte, als er sich vorgestellt hatte.
»Dr. Wagner erwartet Sie«, sagte er.
»Ich gehe auch sofort zu ihm. Unterwegs war dieser Unfall«, erklärte Dr. Norden. »Ich werde Frau Fiebig und das Kind später heimbringen, wenn nichts Ernsthaftes festzustellen ist. Wir wissen ja, daß ein Schockzustand manches verdeckt.«
Das konnte Claudia glücklicherweise nicht hören. Sie war jetzt noch viel aufgeregter als vorher. Es ging ihr sehr viel durch den Sinn.
Dr. Norden allerdings auch, als er die Nummer von Martin Fiebig wählte und sich niemand meldete. Er dachte aber nicht über dieses Ehepaar nach, sondern über seinen Studienfreund Victor Wagner, da ihm der Oberarzt empfohlen hatte, zuerst mit Professor Strecker zu sprechen, bevor er Victor aufsuchte.
Strecker war älteres Semester und ein sehr jovialer Mann. Er war der Typ des väterlichen Klinikleiters.
»Freut mich, Sie kennenzulernen, Kollege Norden«, sagte er mit tiefer, ruhiger Stimme. »Victor hat viel über Sie gesprochen.«
»Ich habe ihn sehr lange nicht gesehen.Was fehlt ihm?« fragte Daniel.
Ein Schatten fiel über das breite, freundliche Gesicht des Älteren. »Sie wissen nicht Bescheid? Tja, dann bleibt es wieder mal mir überlassen, von diesem verfluchten Krebs zu sprechen. Lungenkrebs, inoperabel, Meteastasierung weit fortgeschritten.«
Unwillkürlich ballten sich Daniels Hände zu Fäusten. »Er ist noch nicht vierzig und war Nichtraucher«, sagte er tonlos.
»Das ist er auch geblieben. Nach der Ursache dürfen wir forschen und werden sie dennoch nicht finden. Seine Zeit wird bald abgelaufen sein. Da stehen wir machtlos vis á vis, wie so oft, und für meine Person kann ich nur sagen, daß ich froh bin, bald in Pension gehen zu können. Vic weiß Bescheid.« Seine Stimme klang jetzt dumpf, sein Blick war zu Boden gerichtet. »Sie brauchen nicht in Zuversicht zu machen, Kollege. Er hat was auf dem Herzen, was er nur Ihnen sagen will.«
»Was sagt seine Familie?« fragte Daniel.
»Er hat keine Familie. Die Eltern sind tot.«
»Er ist nicht verheiratet? Damals war er verlobt, soweit ich mich erinnere.«
»Davon weiß ich nichts. Seine Praxis hat er schon vor zwei Jahren aufgegeben. Seither kenne ich ihn. Helfen konnte ich ihm nicht und andere konnten es auch nicht. Er hat nichts als einen Haufen Geld, mit dem er nichts anfangen kann, obgleich er nie hätte etwas dazuverdienen müssen. Tragisch. Man wird nach entfernten Verwandten forschen, und wenn es die gibt, werden sie sich die Hände reiben. Und jetzt gehen Sie besser zu ihm. Um diese Zeit hat er seine gute Stunde.«
Nun, ob man es eine gute Stunde nennen konnte, wollte Daniel nicht beurteilen. Er hätte Victor Wagner nicht wiedererkannt, wäre er unvorbereitet zu diesem Patienten geführt worden. Doch in dessen Augen, die tief in den Höhlen des ausgemergelten Gesichtes lagen, leuchtete es auf, als Daniel nach der schmalen, knochigen Hand griff, die völlig kraftlos war.
»Dan, alter Junge, bin froh, dich zu sehen«, sagte der Kranke leise. »Ich bin dir sehr dankbar. Ich habe eine große Bitte an dich. Viel Zeit bleibt mir ja nicht mehr.«
»Schon erfüllt, wenn es in meiner Macht steht«, sagte Daniel.
»Du bist ein Menschenfreund. Du hast für alles Verständnis. Ich habe von deiner Insel der Hoffnung gelesen. Aber mir hätte dort auch nicht geholfen werden können. Mich hat das er-wischt, was ich meinen Patienten nur schwersten Herzens sagte, wenn es feststand.« Er atmete pfeifend. »Erinnerst du dich an Sabine?«
Daniel blickte auf, fast erschrocken, sich fragend, was diese Frage bedeuten könnte.
»Warst du nicht mit einer Sabine verlobt?« kam es zögernd über seine Lippen.
»Ja, die verdammte Eifersucht hat uns getrennt.Wir wollten heiraten. Sabine erwartete ein Kind. Aber dann sah ich sie mit einem anderen Mann, und ich drehte durch und bezweifelte, daß ich der Vater des Kindes sei. Ich vergesse nie ihren Blick. Sie ging, verschwand wortlos. Vor zwei Jahren habe ich sie wiedergesehen. Sie hat mich nicht erkannt. Ich war da schon sehr verändert und wußte, daß es keine Rettung für mich gibt, wenngleich ich mich an den berühmten Strohhalm klammerte.«
Und nun klammerte sich sein Blick hilfesuchend an Daniels Gesicht.
»Sie hat diesen Mann geheiratet«, fuhr Victor flüsternd fort. »Manfred Mainhard heißt er. Aber es ist mein Kind, Dan. Ich habe es gesehen. Ich weiß, daß ich der Vater bin, und ich will, daß das Kind alles bekommt, was ich besitze. Du mußt mir helfen, du mußt Martina helfen. Meine Tochter heißt Martina. Sabine ist stolz. Ich hatte ihr damals geschrieben, aber ich habe keine Antwort bekommen. Für sie bin ich schon vor zwölf Jahren gestorben, und es war allein meine Schuld. Sie hat Manfred Mainhard erst ein Jahr später geheiratet, und sie haben zwei Kinder, die acht und sechs Jahre sind. Ich habe Erkundigungen eingezogen. Er ist Schriftsteller. Mein Gott, was verdienen die schon, wenn sie keinen Namen haben. Du wirst es ihr sagen, bitte, Dan, daß es mein letzter Wunsch ist, dem Kind und ihr zu helfen. Sag ihr, daß allein dieser Gedanke mich in Frieden sterben läßt. Du kannst das. Ich konnte es nicht schreiben. Du kannst so überzeugend sein. Weißt du noch, damals sagtest du mir, daß ich Internist werden solle, zum Gynäkologen oder Chirurgen würde ich nicht taugen. Ich wurde Internist. Ja, du kannst selbst Zweifelnde überzeugen, Dan. Bitte…«, seine Stimme erstarb, er nahm nochmals alle Kraft zusammen. »Mein Testament ist bei Notar Brandt. Versprich mir…« Nun hatte er keine Kraft mehr, er sah Daniel nur noch flehend an.
»Ich werde alles tun, was in meiner Kraft ist, Vic«, sagte Daniel. »Ich verspreche dir, daß dein Wille erfüllt wird.«
»Danke, Dan«, hauchte der Kranke, dann sank er in tiefe Bewußtlosigkeit.
Professor Strecker kam. »Er hat bald ausgelitten«, sagte er leise.
»Benachrichtigen Sie mich bitte«, sagte Daniel heiser.
»Ist selbstverständlich. Wenn meine Zeit hier vorbei ist, werde ich mich auf Ihrer Insel erholen. Ist doch zu machen?«
»Aber gewiß.«
»Es bleibt nichts in den Kleidern hängen«, murmelte der Professor. Er seufzte schwer. »Da draußen wartet wieder jemand auf Sie.«
Claudia Fiebig und ihr kleiner Daniel waren glücklicherweise gut davongekommen. »Papa schümpft«, plapperte der Kleine.
Davor schien auch seine Mutter Angst zu haben. »Mein Mann regt sich schnell auf«, sagte sie entschuldigend. »Er hat viel Ärger im Büro, und wenn Föhn ist, leidet er unter Kopfschmerzen.«
Die Fiebigs wohnten in einem Neubau, der architektonisch recht ansprechend gestaltet war. Und Martin Fiebig hielt schon aufgeregt Ausschau nach Frau und Kind. Er war ein blasser, ziemlich hochaufgeschossener junger Mann, und in seinen Augen brannte Angst und Eifersucht. Daniel Norden war ein guter Menschenkenner. Die hübsche Claudia schien sich jedoch nicht bewußt zu sein, daß ihr Mann maßlos eifersüchtig war. Unwillkürlich dachte Dr. Norden an Victor Wagner, der sich auch aus Eifersucht ein we-
nigstens kurzes Glück verscherzt hat-te.
»Was soll das bedeuten, was ist passiert?« stieß Martin Fiebig hervor.
»Auto bumbum gemacht«, sagte der kleine Daniel.
Blasser konnte der Mann kaum noch werden, und schnell erklärte ihm Dr. Norden, was gerade geschehen war.
»Ihre Frau trifft nicht die geringste Schuld. Ich bin Zeuge«, sagte er, aber Martin Fiebig riß Frau und Kind in seine Arme und drückte sie fest an sich.
»Uns ist ja nichts passiert, Martin«, sagte Claudia atemlos und doch glücklich.
»Aber was hätte passieren können!« stöhnte der Mann.
»Er macht sich immer zuviel Gedanken«, sagte Claudia zu Dr. Norden.
»Und ich mache meiner Frau auch oft unbegründete Vorwürfe«, gab Martin Fiebig zu. »Tut mir leid, Claudi, und Ihnen ganz herzlichen Dank, Herr Doktor. Es scheint doch noch Ärzte zu geben, die nicht nur kassieren.«
»Entschuldigen Sie das bitte«, sagte Claudia zaghaft, »aber mein Mann hat wirklich schlechte Erfahrungen gemacht. Vielleicht darf er Sie mal aufsuchen?«
»Ich habe meine Praxis aber am anderen Ende der Stadt«, sagte Dr. Norden mit einem flüchtigen Lächeln.
Martin Fiebig sah ihn mit einem seltsamen Ausdruck an. »Da soll mir kein Weg zu weit sein«, sagte er leise. »Sie haben auch keine Mühe gescheut, Herr Doktor.«
»Es war keine Mühe. Es war selbstverständlich. Ich bin selbst Vater, und außerdem war ich auf dem Weg zur Klinik. Es ist alles in Ordnung, Herr Fiebig. Sie brauchen sich nicht zu sorgen. Es war nur eine Vorsichtsmaßnahme. Es kann allerdings sein, daß der kleine Daniel noch davon träumt.«
»Ich vielleicht auch«, sagte Claudia scheu. »Aber Sie haben mir sehr geholfen.«
»Ich werde es nicht vergessen«, sagte Martin Fiebig leise.
»Nun erholen Sie sich von dem Schrecken, und für den Wagen muß die Versicherung des Schuldigen zahlen.«
»Der Wagen ist nicht wichtig«, sagte Martin Fiebig.
»Papa schümpft gar nicht«, staunte der kleine Daniel.
»Schimpft, heißt es, Danny«, wurde er von seinem Vater berichtigt. »Ich bin halt ein Choleriker, tut mir leid.«
»Nein, ein Choleriker sind Sie nicht«, sagte Dr. Norden.
»Was dann?«
»So schnell kann ich eine Diagnose nicht stellen. Wenn Sie den Weg nicht scheuen, können wir uns ja mal unterhalten.«
Er fing einen bittenden Blick von Claudia auf. »Sofern Sie Vertrauen zu mir haben«, fügte er schnell hinzu, ahnungsvoll, daß auch dieser Mann Hilfe benötigte, denn seine Vermutung, daß es sich um einen despotischen Ehemann handeln könne, fand er widerlegt. Martin Fiebig war ein nervöser, ängstlicher und eifersüchtiger Mann, ein Mann, der mit seinen Problemen nicht fertig wurde.
»Kann ich gleich morgen kommen, nachmittags vielleicht?« fragte Martin Fiebig.
»Gern, sagen wir gegen halb sechs Uhr?«
»Danke, Herr Doktor, vielen Dank für alles.«
Und Claudia wiederholte es. »Schönen Dank«, sagte auch der kleine Daniel.
*
Es war acht Uhr geworden, bis Daniel Norden heimkam, und die Kinder waren schon im Bett. Von Fee wurde er mit einem zärtlichen Kuß empfangen, und Lenni rief aus der Küche: »Endlich, Gott sei Dank.«
Sie machte sich auch schnell Sorgen und hatte es nun eilig, das Essen auf den Tisch zu bringen.
Daniel wusch sich die Hände und hielt seinen Kopf unter das kalte Wasser. Dann fühlte er sich etwas wohler und ging hinauf zu den Kindern, die auf den Gutenachtkuß warteten, obgleich sie schon im Einschlafen begriffen waren.
»Kommst du mal wieder früher, Papilein?« fragte die kleine Anneka schmeichelnd.
»Es wird schon mal wieder werden, mein Schätzchen«, erwiderte er. »Nun schlaf schön.«
»Du darfst aber nie krank werden«, murmelte die Kleine.
Und nun mußte er wieder an Victor denken. Aber erst, nachdem er seinen Hunger gestillt hatte, erzählte er Fee von dem Studienfreund. Sie zog fröstelnd die Schultern zusammen, obgleich es an diesem Abend fast drückend schwül war.
»Schrecklich«, sagte sie leise. »Und was wollte er von dir?«
Auch das erfuhr sie. Lange herrschte dann Schweigen zwischen ihnen.
»Und wenn er sich täuscht und es ist doch nicht sein Kind?« fragte Fee sinnend in dieses Schweigen hinein.
»Ich werde Sabine aufsuchen und mit ihr sprechen.«
»Kanntest du sie persönlich?« fragte Fee.
»Ja, wenn auch nur flüchtig, aber sie war ein sehr nettes, solides Mädchen, sehr tüchtig. Sie leitete ein Schreibbüro. Vic lernte sie dadurch kennen. Sie tippte seine Examensarbeiten.«
Fee dachte wieder ein paar Sekunden nach. »Und ihr Mann ist Schriftsteller«, sagte sie sinnend. »Vielleicht lernte sie ihn dadurch kennen, daß sie für ihn tippte.«
»Der Gedanke ist mir noch nicht gekommen«, meinte Daniel.
»Typisch Mann, und wie oft kommt es durch ungerechte Eifersucht zu schweren Konflikten. Ich verstehe nicht, daß erwachsene Menschen nicht vernünftig miteinander reden können, wenn es gilt, Zweifel auszuräumen. Nun, es mag sein, daß diese Sabine zu der Erkenntnis kam, daß Victor doch nicht der richtige Partner für sie sei. Ich werde mich morgen mal erkundigen, ob Manfred Mainhard unter einem Pseudonym schreibt und was er schreibt. Hat Victor dir auch die Adresse gegeben?«
»Nur die vorige. Sie sind inzwischen umgezogen.«
»Aber in München?«
»Das muß ich herausfinden.«
»Das kannst du mir überlassen, Schatz«, sagte Fee hilfsbereit. »Du hast genug zu tun.«
Daniel konnte sich auf seine Frau verlassen. Sie half ihm stets, wo und wann immer sie das konnte. Und nun erzählte er ihr auch von dem Zwischenfall mit Claudia Fiebig und ihrem Söhnchen.
»Daniel ist ein beliebter Name geworden«, sagte sie lächelnd.
»Gefällt er dir nicht mehr?« fragte er neckend.
Sie schenkte ihm ein zauberhaftes Lächeln. »Ich konnte ihn ja nicht patentieren lassen, mein Schatz. Aber ich würde dich auch lieben, wenn du Nepomuk heißen würdest.«
»Wieso ausgerechnet Nepomuk?« staunte er.
»Manche Eltern kommen auf die verrücktesten Ideen. Immerhin könnte ich dich dann Muckerl nennen.«
Sie verstand es, ihn aufzuheitern, sie hatte ihm schon oft die Sorgen vertrieben, aber in der Nacht träumte er dann doch von Victor und Sabine. Seltsam, wie deutlich ihm dieses sanfte Mädchen mit den großen nachtdunklen Augen im Traum erschien, obgleich so viele Jahre vergangen waren, seit er Sabine kennengelernt hatte.
*
Sabine Mainhard hätte eine vollkommen glückliche Frau sein können. Obgleich es keine himmelstürmende Liebe gewesen war, die sie und Manfred zusammengeführt hatte, war es in den Jahren der Ehe doch eine tiefe, innige Liebe geworden, die auch durch harte Bewährungsproben nicht mehr zu erschüttern war.
Die einzige große Sorge in ihrem recht bescheidenen Leben bereitete ihnen nur die jetzt fast zwölfjährige Martina, die immer ein sehr zartes Kind gewesen war. Martina war mit einem Herzschaden zur Welt gekommen und hatte immer besonderer Fürsorge bedurft.
Sie wurde von den jüngeren Geschwistern ebenso geliebt wie von den Eltern. Ja, Manfred Mainhard hatte einen ganz besonders innigen Kontakt zu dem Mädchen, das ihrem Alter geistig weit voraus war. Sport hatte Martina nie treiben dürfen, körperliche Belastungen durfte sie überhaupt nicht ausgesetzt werden. So hatte sie sich schon von früher Kindheit an überwiegend mit Büchern beschäftigt, wenn die anderen Kinder draußen herumtobten.
Für die kostspielige Operation, die bisher nur in Kanada ausgeführt werden konnte, fehlte den Mainhards allerdings das Geld. Sie waren schon glücklich gewesen, als Manfred von einem Onkel das Bauernhaus geerbt hatte und sie der lauten, stickigen Stadt entfliehen konnten.
Sie hatten es hübsch hergerichtet. Reichtümer hatte Manfred mit seinen Sachbüchern und Zeitungsartikeln nicht sammeln können, aber Not hatten sie nie leiden müssen. Sie waren zufrieden, und führten ein harmonisches Leben. Der achtjährige Axel und die sechsjährige Kathrin waren kerngesund.
Nichtahnend, welche Probleme auf sie zukommen würden, saßen sie an diesem Morgen, wie jeden Tag, vereint am Frühstückstisch. Sabine fiel es auf, daß Martina noch blasser war als sonst.
»Fühlst du dich nicht wohl, Tina?« fragte sie besorgt.
»Es ist wieder ein verrückter Föhn«, warf Manfred ein, der nun Martina auch forschend betrachtete. »Bleib zu Hause, Kleines.«
»Wir schreiben heute Englisch«, erwiderte das zierliche Mädchen, dessen Augen so groß und dunkel waren, wie die ihrer Mutter. Axel und Kathrin hatten die hellen Augen ihres Vaters, obwohl sie der Mutter sonst ähnlicher waren als Martina.
»Du bekommst doch eh eine Eins im Zeugnis«, meinte Axel. »Ich tät’ gern zu Hause bleiben.«
»Faulpelz«, sagte Sabine neckend.
»Frau Becher ist so langweilig«, murrte Axel. »Ich bin froh, wenn Frau Kreibel wieder da ist.«
»Ich würde schon sehr gern in die Schule gehen«, erklärte Kathrin.
»Die paar Monate vergehen sehr schnell«, sagte Martina etwas nachdenklich.
»Aber erst kommen die Sommerferien«, freute sich Axel. »Wir müssen jetzt aber gehen, Tina. Du darfst nicht rennen.«
Er war besorgt um die große Schwester. Sie hatten den gleichen Weg. Die Volksschule lag gleich neben dem Gymnasium, aber der Weg dorthin war doch ziemlich weit.
»Ich fahre euch«, sagte Manfred. »Tina soll in Ruhe frühstücken.«
»Ich habe keinen Hunger«, erwiderte das Mädchen.
»Bist eh so ein Krisperl«, meinte Axel. »Ich bin fast so groß wie du.«
»Bist ja auch ein Junge«, sagte Martina. Figürlich wirkte sie auch nicht älter als acht Jahre, aber sie hatte eben im Kopf, was ihr an Länge fehlte.
Sie klagte nie und fragte auch nicht mehr, warum ausgerechnet sie ein anderes Herz hatte. Sie hatte sich damit abgefunden, als es ihr erklärt wurde.
»Ich möchte auch mitfahren, Papi«, bat Kathrin, als der Aufbruch nahte.
»Dann könnt ihr gleich noch ein paar Besorgungen machen«, warf Sabine ein. »Ich habe alles schon aufgeschrieben. Ich kann dann dein Manu-skript abschreiben, Manni.«
»Es pressiert nicht, Liebes.« Er legte rasch den Arm um sie und küßte sie auf die Stirn. Er überragte sie um Haupteslänge. Sein dichtes dunkles Haar war an den Schläfen schon ergraut, in sein schmales, vergeistigtes Gesicht hatte sich manche Sorgenfalte eingegraben, aber es drückte Güte und Ausgeglichenheit aus.
Manfred Mainhard hatte kein leichtes Leben gehabt, und er hatte es sich auch nie leichtgemacht.
Sein Vater war früh gestorben, die Mutter war viele Jahre krank gewesen, und sie hatte kein Verständnis dafür gehabt, daß er sich einen Beruf erwählte, der ihrer Meinung nach nichts einbrachte. Ja, wenn er als Redakteur zu einer Zeitung gegangen wäre, hätte sie es verstanden, aber so bezeichnete sie ihn als einen Phantasten.
Es war ja nun wirklich nicht so, daß sie von der Hand in den Mund leben mußten. So schlecht verdiente Manfred nicht. Es mußte nur besser eingeteilt werden, als wenn man jeden Monat mit einem bestimmten Gehalt rechnen konnte. Und Sabine konnte einteilen.
Sie hatte nie daran gedacht, welch sorgloses Leben sie an der Seite Victor Wagners erwartet hätte, sie hatte dann überhaupt jeden Gedanken an ihn ausgeschaltet, nachdem sie von ihm so beleidigt worden war. Alles, was sie ersehnt hatte, fand sie bei Manfred. Verständnis, Wärme und Menschlichkeit. Das war viel mehr wert als finanzielle Sicherheit.
Sie setzte sich nun an die Schreibmaschine, aber sie tippte nicht sein Manuskript ab, sondern das, was sie in wenigen stillen Stunden selbst geschrieben hatte. Einmal, ganz plötzlich, hatte sie der Wunsch beseelt, selbst niederzuschreiben, in Worte zu fassen, was sie empfand, was sie mit den Augen einer glücklichen Frau sah.
Manfred hatte indessen Martina und Axel zur Schule gebracht. »Ich hole dich auch wieder ab, Tina«, sagte er liebevoll.
»Ich gehe gern, Papi«, erwiderte sie. »Es ist doch so schönes Wetter.«
Aber die Föhnwolken jagten unter dem blauen Himmel hinweg. Manfred sah es besorgt. Er wußte, daß es Martina an solchen Tagen gar nicht gut ging.
»Ich möchte, daß unsere Tina richtig gesund wird«, sagte die kleine Kathrin.
»Das möchte ich auch, mein Herzchen«, erwiderte Manfred leise. Und er überlegte wieder einmal, wie er das Geld aufbringen könne, um sie zu dem Spezialisten nach Kanada zu bringen.
»Jetzt guckst du wieder so traurig, Papi«, sagte Kathrin, »warum sind andere Leute reich?«
»Dafür sind wir glücklich, Kathrinchen«, sagte er weich.
»Aber nicht, wenn es Tina nicht gut geht«, meinte die Kleine ernsthaft. »Wir haben sie doch so lieb, und es wäre so schön, wenn sie mit uns herumspringen könnte.«
Ich muß es schaffen, dachte Manfred. Ob ich es nicht doch mal mit dem Roman versuchen soll, der schon so lange in der Schublade schmort?
»Wir müssen noch einkaufen, Papi«, erinnerte ihn Kathrin, als er schon in Richtung heimwärts fuhr.
»Hätte ich doch tatsächlich vergessen«, brummte er.
»Bist schon manchmal ein zerstreuter Professor«, lachte die Kleine schelmisch.
Aber beim Einkaufen war er das nicht. Da verglich er sorgfältig die Preise, und als er die Rechnung bezahlte, fragte er sich, wie Sabine es in den noch schwereren Zeiten nur fertig brachte, daß immer genügend zu essen im Hause war. Wenn er doch auch sie ein bißchen mehr verwöhnen könnte! Doch gleich dachte er wieder an Martina. Sie ging vor. Ihr mußte endlich geholfen werden.
*
Fee Norden hatte inzwischen schon in Erfahrung gebracht, wohin die Mainhards verzogen waren. Sorgfältig hatte sie sich alles notiert. Und da sie nun mal in der Stadt war, hatte sie auch gleich einige Einkäufe getätigt. Die Kinder wuchsen so schnell.
Sie hatte zwar nie so zu rechnen brauchen wie die ihr noch unbekannte Sabine Mainhard, aber auch sie stöhnte manchmal über die Preise.
Wieder in ihrem Vorort angekommen, suchte sie die Buchhandlung auf, die ihr wohlbekannt war und die in einem anderen Schicksal, das den Nordens auch sehr am Herzen gelegen war, vor gar nicht allzulanger Zeit eine beträchtliche Rolle gespielt hatte.
Sie war dort wohlbekannt und wurde höflich und freudig zugleich empfangen. Aber als sie nach Manfred Mainhard fragte, schüttelte der Besitzer den Kopf.
»Vielleicht schreibt er unter einem Pseudonym«, meinte Fee. »Haben Sie nicht so ein Verzeichnis? Es würde mich sehr interessieren.«
In einem dicken Wälzer fanden sie dann den Namen Mainhard. »Ach, der Fred Mainrad ist das«, sagte der Buchhändler. »Schreibt Sachbücher. Wird leider wenig Reklame gemacht.«
»Haben Sie welche da?« fragte Fee. Er hatte drei verschiedene, und sie kaufte alle drei. Sie fragte sich, was dieser Mann wohl sagen würde, wenn seine Frau das Erbe eines reichen Mannes antreten sollte.
Sie wußte nicht, wieviel Geld hinter Victor Wagner stand, aber eine Million war es sicherlich, wie Daniel meinte. Doch Fee wußte auch, daß ein unerwartetes Erbe so manche Konflikte nach sich ziehen konnte, und besonders wohl in einem solchen Fall.
Sie war zu Hause, die Kinder kamen auf sie zugestürzt, sie war abgelenkt. Lenni stand am Herd, und Fee hatte gerade noch Zeit, sich die Hände zu waschen, als auch Daniel schon kam, diesmal recht pünktlich, was die Kinder mit Jubel begrüßten. Doch Fee sah es seiner Miene an, daß er eine traurige Nachricht bekommen hatte.
»Victor?« fragte sie leise.
Er nickte. In Gegenwart der Kinder wurde darüber nicht gesprochen. Daniel konnte sich sogar zu einigen Späßen zwingen, und da seine drei Trabanten wie Kletten an ihm hingen, hatte er nur ein paar Minuten Gelegenheit, mit Fee zu sprechen.
»Er ist gegen sechs Uhr morgens gestorben«, raunte er ihr zu, und sie sagte ihm, was sie erreicht hatte.
»Ich werde mich mit Dr. Brandt in Verbindung setzen müssen«, sagte er, »aber Sabine soll erst nach der Beerdigung benachrichtigt werden.«
»Hoffentlich gibt es dann keine Probleme in der Ehe«, meinte Fee.
»Geld kann man immer brauchen. Sie wäre töricht, wenn sie das Erbe ablehnen würde.«
»Es kommt darauf an, wie der Mann es versteht«, meinte Fee. »Du würdest kategorisch nein sagen.«
»In Sabines Fall ist es ja auch so eine Art Wiedergutmachung«, sagte er nachdenklich. »Ich muß wieder weiter, mein Schatz. Wir werden am Abend darüber reden.«
Nun erinnerte er sich auch, daß Martin Fiebig kommen wollte. Ob es ihm ernst damit gewesen war?
Martin Fiebig war pünktlich um halb sechs Uhr in der Praxis. Er hatte es sich nicht anders überlegt. Er wirkte etwas ruhiger, aber auch verlegen.
»Wir haben lange überlegt, womit wir Ihnen eine kleine Freude machen könnten, Herr Doktor, aber so einfach ist das nicht«, sagte er stockend. »Da habe ich halt einen Taschenrechner aus unserer Firma mitgebracht. So was kann man ja immer brauchen.«
»Meine Frau bestimmt«, erwiderte Dr. Norden lächelnd.
»Er ist sehr zuverlässig, man darf nur nicht vergessen, die Batterien zu wechseln«, sagte Martin Fiebig. »Es wäre gut, wenn man beim Menschen auch so einiges einfach auswechseln könnte«, fügte er dann hinzu.
»Man ist ja schon fleißig dabei«, sagte Dr. Norden, »aber so schlimm wird es doch bei Ihnen nicht sein.«
»Na, ich weiß nicht. Es muß doch einen Grund haben, daß ich mich so schnell aufrege und manchmal wegen nichts und wieder nichts.«
»Vielleicht liegt es auch an der Schilddrüse«, sagte der Arzt, den fast hageren Mann forschend betrachtend. »Aber wir werden schon dahinterkommen.«
»Von der Schilddrüse hat noch keiner geredet, und ich war früher schon bei mehreren Ärzten. Aber dann haben sie mir Medikamente verschrieben, die mir überhaupt nicht bekamen. Zeit hat sich ja auch keiner genommen.«
»Wir nehmen uns Zeit. Jetzt wird erst mal Blutdruck und Puls gemessen, und dann zapfen wir Ihnen noch ein bißchen Blut ab. Und Sie erzählen mir noch so einiges aus Ihrem Leben, vor allem von früheren Krankheiten.«
»Richtig krank war ich eigentlich nie, und essen kann ich, was ich will und in jeder Menge, dicker werde ich davon doch nicht.«
Dr. Norden stellte fest, daß der Blutdruck ziemlich hoch war und der Puls unruhig. Dann nahm er Blut ab, und anschließend mußte sich Martin Fiebig auf die Waage stellen.
»Bei der Länge ein bißchen wenig«, sagte Dr. Norden. »Sie dürften gut zehn Kilo mehr wiegen.«
»Am Essen liegt es bestimmt nicht«, erklärte sein neuer Patient. »Claudi kocht sehr gut. Ich muß sie überhaupt bewundern, wie sie alles unter einen Hut bringt. Haushalt, Beruf, das Kind, und launisch ist sie auch nie. Und sie ist doch sehr hübsch, nicht wahr?«
»Und Sie sind sehr eifersüchtig«, stellte Dr. Norden beiläufig fest.
»Sie hätte eine andere Partie machen können«, sagte Martin Fiebig heiser. »Da hätte sie nicht mitarbeiten müssen.«
»Aber sie hat sich für Sie entschieden«, sagte Dr. Norden ruhig.
»Ich wollte doch gar nicht, daß sie berufstätig bleibt, aber nun haben wir die Wohnung gekauft und müssen viel abzahlen. Aber Claudi hat darauf bestanden, damit Danny sein eigenes Zimmer hat. Sie verdient gut. Sie ist Substitutin in einem Warenhaus. Ich verdiene auch nicht viel mehr als Finanzbeamter.«
»Und da scheinen Sie sich manchmal sehr zu ärgern«, sagte er.
»Die Galle kann einem hochkommen, wenn man so mitbekommt, was die Großen alles abschreiben können, abgesehen davon was sie oft auch einfach unter den Tisch fallen lassen, und bei den Angestellten wird einfach abkassiert.«
»Warum haben Sie diesen Beruf gewählt?« fragte Dr. Norden.
»Mein Vater hat es so bestimmt. Er war zuletzt Steuerrat. Bei uns zu Hause herrschte Zucht und Ordnung. Wir durften den Mund nicht aufmachen. Und Mutter zuliebe haben wir so manches dann auch geschluckt.«
Und daher hat er seine Komplexe, dachte Dr. Norden. »Ihre Eltern leben noch?« fragte er beiläufig.
»Mein Vater, er ist jetzt in einem Seniorenheim. Meine Mutter wurde vor zwei Jahren überfahren. Sie hat es nicht überlebt. Seither bekomme ich Zustände, wenn meine Frau nicht pünktlich zu Hause ist, und leider bin ich in gewisser Beziehung auch so wie mein Vater.«
»Inwiefern?«
»Daß ich immer gleich aufbrause, wenn mal was ist. Wenn mal was anbrennt oder was kaputtgeht. Mir tut es gleich immer leid, aber gesagt ist gesagt.«
»Ich glaube, daß Ihre Frau sehr tolerant ist.«
»Ich denke oft, wie sie es nur mit mir aushält, aber ich könnte ohne sie gar nicht leben, und sogar auf Danny bin ich manchmal eifersüchtig.«
Am Arbeitsplatz unzufrieden, dachte Dr. Norden, wie oft löste dieses Psychosen aus oder auch Existenzangst. Und bei Martin Fiebig kamen auch noch andere Ängste hinzu. Um hinter die Ursachen zu kommen, würde er wohl auch mit Claudia Fiebig sprechen müssen.
»Wir werden jetzt ein Szintigramm von Ihnen machen lassen, Herr Fiebig«, sagte er. »Dazu begeben Sie sich bitte in die Behnisch-Klinik.«
»Und was ist das?« fragte der Patient erregt.
»Wir wollen Ihre Schilddrüsenfunktionen feststellen. Ihr Untergewicht, Ihre leichte Erregbarkeit kann daher kommen, aber man kann dann auch etwas dagegen tun. Nur genau wollten wir es wissen.«
»Sie sind sehr gründlich, Herr Doktor.«
»Das ist meine Pflicht.«
»Alle sind nicht so bei Kassenpatienten.«
»Das ist bedauerlich, aber manchmal liegt es auch an den Patienten. Ein gewissenhafter Arzt ist auf das Gespräch angewiesen. Auf Ahnungen darf er sich nicht verlassen, doch manche Patienten schimpfen schon, wenn man ihnen Fragen stellt.«
»So, wie Sie fragen, kann doch keiner schimpfen«, sagte Martin Fiebig.
»Ich habe den Dreh halt herausbekommen«, erwiderte Daniel Norden lächelnd. »Man unterhält sich wie am Stammtisch. Sind Sie mit Ihrer Wohnung eigentlich zufrieden?«
»Ja, sie ist hübsch, aber eben auch entsprechend teuer.«
»Mir gefällt die Wohnanlage sehr gut, und manchmal ist es schon besser, ein bißchen mehr zu zahlen, als in so einem Betonsilo zu leben. Und mit Ihrer Frau können Sie doch auch zufrieden sein.«
»Bin ich auch, aber mir wäre es bedeutend lieber, wenn Claudi wenigstens nur halbtags arbeiten bräuchte. Ein Kind braucht doch die Mutter. Und wir wollten eigentlich nicht nur eins haben.«
»Geht Danny nicht gern in den Kindergarten?«
»O doch, aber mit seinen Betreuerinnen ist er ja mehr beisammen als mit uns.«
Solche Probleme kannte Dr. Norden zur Genüge. Alles hatte seinen Preis. Wenn man ein hübsches Heim haben wollte, mußte man jetzt gewaltig zahlen, und alles andere war auch teuer. Und wenn dann die Kasse nicht stimmte, hatte es öfter noch schlimmere Folgen als bei den Fiebigs. Und nun brach es aus Martin Fiebig hervor, was ihn besonders quälte.
»Und hinter Claudi ist ihr Chef her. Nachschauen tun ihr ja viele Männer, aber dieser alte Lustmolch läßt sie nicht in Ruhe.«
»Sehen Sie das nicht vielleicht ein bißchen zu übertrieben, Herr Fiebig?« fragte Dr. Norden.
»Ich habe sie doch entschuldigt, weil sie ein paar Tage zu Hause bleiben kann. Ganz genau wollte er es wissen und grad besorgt war er um sie, als ob es ohne sie überhaupt nicht gehe.«
»Sie wird schon so eine zuverlässige Kraft sein«, meinte Dr. Norden versöhnlich.
»Aber mich macht das alles fertig. Ich kann nachts manchmal überhaupt nicht schlafen, so viel geht mir durch den Kopf.«
Es wird allerhöchste Zeit, daß etwas für seine Gesundheit und vor allem für seine Nerven getan wird, dachte der Arzt. Er ermahnte Martin, das Szintigramm sofort machen zu lassen.
»Aber es ist doch schon so spät«, wandte er ein.
»Ich rufe Dr. Behnisch an.Wir sind befreundet. Er macht das schon, damit wir bald Bescheid wissen und etwas unternehmen können.«
Ein wenig ungläubig, daß ihm tatsächlich geholfen werden konnte, war Martin Fiebig wohl immer noch, aber er sah Dr. Norden mit einem so dankbaren Blick an, daß man ihm glauben konnte, wie sehr er diesem Arzt vertraute. Und als er gegangen war, rief Dr. Norden sofort Claudia Fiebig an und bat sie um zusätzliche Auskünfte. Da erfuhr er dann noch, daß Martin Fiebig liebend gern Jura studiert hätte und daß ihr Vater Direktor an einer Maschinenfabrik sei. Doch der sei in zweiter Ehe verheiratet und hatte noch zwei unversorgte Kinder, und außerdem wolle er nicht zum Großvater gestempelt werden.
Was es denn mit ihrem Chef auf sich hätte, fragte Dr. Norden auch.
Claudia schien verblüfft. »Er verläßt sich ganz auf mich«, erwiderte sie. »Er ist so kurzsichtig, daß er auch mit Brille nicht mehr richtig sieht, doch keiner soll es merken. Er will nicht vorzeitig in Pension gehen. Das ist alles.«
Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifer sucht, was Leiden schafft, dachte Dr. Norden wieder einmal. Und diesem an sich doch recht netten Martin Fiebig schien es sehr an Selbstbewußtsein zu mangeln.
Es waren nicht immer organische Leiden, die die Menschen quälten, den seelischen war oft noch schwerer beizukommen.
Immerhin konnte sich Dr. Norden aber schon ein Bild von dem Patienten machen. Und Martin Fiebig war der letzte an diesem Tag gewesen. Drei Krankenbesuche mußte er noch machen, dann begann auch für ihn der Feierabend.
*
Drei Tage später wurde Dr. Victor Wagner beerdigt. Mit Daniel und Fee Norden standen noch einige frühere Patienten und auch der Notar Dr. Brandt an seinem Grab. Eine Todesanzeige war nicht in der Zeitung erschienen, und ein Nachruf wurde auch nicht gehalten. Ein schlichtes Begräbnis war es für einen so reichen Mann, aber so hatte es Victor selbst verfügt.
Es war reiner Zufall, daß Sabine von seinem Tod erfuhr. Die Mutter von Axels Lehrerin, Frau Kreibel, war gestorben, und Sabine hatte erfahren, daß sie in München beerdigt werden sollte. Sie mochte diese junge Lehrerin und wollte ein paar Blumen zu der Beerdigung schicken, und deshalb sah sie die Todesanzeigen durch. Sie hatte Zeit an diesem Vormittag, denn Manfred war nach München gefahren, um sein Manuskript abzuliefern. Sie hatte sich schon gewundert, daß er es diesmal persönlich tun wollte, aber er hatte ihr nicht verraten, was er sonst noch vorhatte.
Sabine fand die Todesanzeige von Irene Kreibels Mutter, aber wie von ungefähr fiel ihr Blick dann auch auf die Beerdigungsliste dieses Tages, und da sprang ihr der Name Victor Wagner in die Augen. Sie wollte es nicht glauben, aber alles stimmte. Alter achtunddreißig, Dr. med. Internist. Die Zeitung entglitt ihren Händen, und sie sah ihn unwillkürlich vor sich, mit seinem jungenhaften Lächeln, immer zu einem Scherz aufgelegt.
So hatte sie ihn kennengelernt, als er in ihr Schreibbüro kam. Und sie hatte sich Hals über Kopf in ihn verliebt und er sich in sie. Sie waren oft beisammen, bald täglich, und sie hatten auch von einem gemeinsamen Leben gesprochen. Die Heirat war geplant, als sich das Baby ankündigte, aber sie wollte ihre Stellung noch behalten, bis Ersatz für sie gefunden war. Und dann war Manfred ins Schreibbüro gekommen, dieser stille, schüchterne Mann, der mit dem Pfennig rechnen mußte, und mit dem sie zuerst so viel Mitgefühl hatte, daß sie in ihrer Freizeit fünfzig Seiten umsonst für ihn schrieb. Gesagt hatte sie ihm das nie. Und einmal hatten sie sich rein zufällig auf der Straße getroffen, und da hatte auch der üble Zufall mitgespielt, daß Victor sie beisammen gesehen hatte.
Es fröstelte Sabine, als sie an die harten, bösen Worte dachte, die sie zu hören bekommen hatte. Daß sie ein Flittchen sei und wohl nur einen vermögenden Vater für ihr Kind haben wolle, und daß er froh sei, noch rechtzeitig dahintergekommen zu sein, daß sie sich mit anderen Männern herumtreibe.
Nein, jungenhaft froh war Victors Gesicht da nicht gewesen, sondern verzerrt und böse. Und sie war bis ins Innerste verletzt und wie gelähmt gewesen. Ihre Stellung hatte sie schon gekündigt gehabt. Sie hatte ihre Koffer gepackt, ihre kleine Wohnung gekündigt und ihre Ersparnisse von der Bank abgehoben. Fleißig gespart hatte sie gehabt, um auch etwas in diese Ehe mitzubringen. Und ausgerechnet Manfred war ihr dann im Bahnhof in den Weg gelaufen, so, als hätte es so sein müssen. In ihrer Verzweiflung hatte sie ihm alles erzählt. Manfred hatte sie gefragt, was sie nun tun wolle. Sie hatte nur die Schultern gezuckt. Sie hatte da ja noch nicht einmal gewußt, wohin sie fahren wollte.
Manfred mußte in den Harz fahren, um einen Reisebericht zu schreiben. Ohne zu überlegen, hatte er sie gefragt, ob sie nicht mitkommen wolle, um sich erst einmal auf andere Gedanken zu bringen. Und sie war mit ihm gefahren. Sie hatten dort lange, tiefsinnige Gespräche geführt. Er hatte sie sogar zu überreden versucht, eine Aussprache mit Victor herbeizuführen, aber Sabine hatte schon damals gewußt, daß sie immer jene abfälligen Worte in den Ohren haben würde, selbst wenn Victor von sich aus einen Versöhnungsversuch machen würde. Und sie war voller Dankbarkeit gewesen, in Manfred einen so aufrichtigen Freund zu finden.
Vor der Geburt des Kindes hatte er sie dann sogar gefragt, ob sie ihn nicht heiraten wolle, damit das Kind einen Vater bekäme, aber sie hatte gewußt, wie hart er sich tat, mit welchen finanziellen Schwierigkeiten er zu kämpfen hatte. Aber er hatte sich viel vom Munde abgespart, um ihr kleine Geschenke für das Baby machen zu können. Er hatte Martina als erster gesehen. Er hatte alles getan, um das zarte kleine Geschöpf über die Anfangsschwierigkeiten hinwegzubringen. Nach dem Tode seiner Mutter waren sie dann zusammengezogen in die Dreizimmerwohnung. Manfred versorgte das Baby mit einer Engelsgeduld und arbeitete dennoch wie ein Wilder. Und dann hatten sie geheiratet, und Sabine war sich gewiß gewesen, daß sie es nie bereuen würde.
Nein, sie hatte es nie bereut. Sie war überzeugt, daß sie mit Victor niemals so glücklich geworden wäre. Nie hatte sie ein böses oder auch nur ein gereiztes Wort von Manfred gehört. Und nie, wirklich niemals, hatte sie an Victors Vermögen gedacht.
»Nun ist er tot«, sagte sie leise vor sich hin. Vielleicht hatte er den Keim dieser Krankheit schon damals in sich. Vielleicht wollte er deshalb alles auf einmal haben und in vollen Zügen genießen.
Seltsam war es, zu denken, daß Victor nicht mehr lebte, doch beruhigend war es für sie, daß sie es Martina nicht sagen mußte. Martina wußte es nicht anders, als daß Manfred ihr Vater war, daß sie, Axel und Kathrin den gleichen Vater hatten.
Ob Victor verheiratet war, überlegte Sabine dann auch. Vielleicht hatte er Kinder, die nun Halbwaisen geworden waren. Und sie erinnerte sich auch daran, daß er ihr einmal einen Brief geschickt hatte, aber den hatte sie gar nicht geöffnet. In ihrem glücklichen Leben mit Manfred hatte kein Gedanke an den lebenden Victor Platz gehabt. Warum also sollte sie jetzt über ihn nachdenken, da er tot war? Aber es war fast unheimlich, wie gegenwärtig er ihr plötzlich wieder war. Und er war auf dem gleichen Friedhof begraben worden, wo sich auch das Grab von Manfreds Eltern befand.
Nicht die leiseste Ahnung kam Sabine, welche entscheidende Rolle der tote Victor Wagner noch in ihrem Leben spielen sollte. Wie sollte es auch möglich sein.
*
Manfred Mainhard war zum Verlag gefahren und hatte sein Manuskript abgeliefert. Anstelle des alten Lektors hatte er einen jungen vorgefunden, der ihn kritisch gemustert hatte.
»Warum schreiben Sie eigentlich nur so nüchternes Zeug, Herr Mainhard?« fragte der zu Manfreds Überraschung. »Sie verstehen es zwar, sehr ausdrucksvoll und lebendig zu schildern, aber Sie haben doch einen solchen Wortschatz, daß Sie sich auch mal an einen Roman wagen könnten.«
»Sie kennen meine Bücher?« fragte Manfred zurückhaltend.
»Ich habe einige mit großem Interesse gelesen. Um Ihnen reinen Wein einzuschenken: Ich bin der Neffe des Chefs, und ich habe mir zum Ziel gesetzt, einen frischen Wind in den Verlag zu bringen.«
»Doch nicht ausgerechnet mit mir«, sagte Manfred.
»Warum nicht?« Ein flüchtiges Lächeln legte sich um schmale Lippen. »Ich bin für Offenheit. Sie sind nicht clever, ich bin es. Sie sind creativ, das bin ich nicht. Jeder hat seine Stärken und seine Schwächen.«
»Ausgerechnet heute sagen Sie mir das«, murmelte Manfred.
»Wieso ausgerechnet?«
»Weil ich in der Tasche einen Roman habe, mit dem ich zu einem anderen Verlag gehen wollte.«
Jochen Burger, so hieß der blonde sportliche Mann, kniff die Augen leicht zusammen.
»Zahlen wir zu schlecht?« fragte er.
»Ich dachte nicht, daß hier ein Interesse an einem Roman von mir besteht«, erwiderte Manfred. »Ich weiß ja selbst nicht, was ich davon halten soll.«
»Sie sind sehr geneigt, sich zu unterschätzen, wie es scheint«, sagte Jochen Burger nachdenklich. »Lassen Sie Ihren Roman hier. Sie bekommen baldigst Nachricht, ob er in unser neues Programm paßt, und wenn, dann reden wir über ein angemessenes Honorar.«
Manfred war ziemlich benommen, aber er dachte an Martina und riß sich zusammen.
»Ich brauche Geld, ziemlich viel. Meine älteste Tochter muß am Herzen operiert werden. Wir müssen sie dazu nach Kanada bringen«, sagte er überstürzt, weil er Angst hatte, daß ihn der Mut verlassen würde. Wenn es um Geld ging, war er tatsächlich immer mehr als zurückhaltend gewesen und nur froh, wenn er ein fertiges Manuskript schnell bezahlt bekam.
In die bisher recht kühl wirkenden Augen des anderen kam ein warmer Schimmer. »Dann haben wir ja sogar etwas gemeinsam«, sagte Jochen Burger leise. »Wir haben ein behindertes Kind.«
Bestürzt sah ihn Manfred an. »Das ist nicht korrigierbar«, fuhr Jochen Burger fort. »Evi ist acht Jahre und geistig ganz auf der Höhe, aber ihre Arme enden da, wo normalerweise die Ellenbogen anfangen. Meine Frau will leider keine anderen Kinder haben. Das ist die größte Tragik. Ich hoffe auf eine gute Zusammenarbeit, Herr Mainhard. Leider kann ich keine Entscheidung ohne den Boß treffen, sonst würde ich Ihnen einen Vorschuß geben.«
»Wir kommen zurecht«, sagte Manfred.
»Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr, sagt man doch erheiternd. Ich verspreche Ihnen, daß Sie innerhalb einer Woche Bescheid über den Roman bekommen.«
»Verbindlichen Dank. Dann brauche ich mir die Schuhsohlen vorerst nicht abzulaufen«, sagte Manfred mit einem flüchtigen Lächeln.
Es war kein langes Gespräch gewesen, aber ein gutes, und es hob seine Stimmung, daß er akzeptiert wurde. Er dachte über sich nach, als er zu seinem Wagen ging. War er nicht selbst auch schuld, daß er es noch nicht weitergebracht hatte? Nun, geschäftstüchtig war er nie gewesen, und gestaunt hatte er immer ein bißchen, wie andere sich doch so viel besser vermarkten konnten. Immer hatte er die Zweifel in sich selbst bekämpfen müssen.
Nun fuhr er zum Friedhof, um das Grab seiner Eltern zu besuchen, was er nie vergaß, wenn er in München war. Er ging an dem frischen Grab vorbei, in das vor einer halben Stunde der Sarg mit Victor Wagners sterblichen Überresten gesenkt worden war, aber er hatte davon keine Ahnung. Das Grab seiner Eltern fand er ordentlich gepflegt vor. Zwei Eichhörnchen liefen über den Weg, die Vögel zwitscherten, und es herrschte eine wahrhaft himmlische Ruhe. Aber Manfred Mainhard ging nicht gern auf den Friedhof. Er liebte das Leben, das harmonische Leben mit Sabine und den Kindern, und er wünschte inbrünstig, daß Martina geholfen werden könnte, damit auch sie an allem teilhaben konnte.
Er liebte dieses Kind ganz besonders, weil es auf so vieles verzichten mußte, was anderen selbstverständlich war, doch dann dachte er daran, was Jochen Burger über sein behindertes Kind gesagt hatte und fragte sich, was wohl schlimmer sein mochte.
Er hielt dann nochmals bei einem Süßwarengeschäft an und kaufte die Pralinen, die Sabine so gern mochte, Schokolade und Kekse für die Kinder. Und dann war er froh, wieder aus der Stadt heraus zu sein, heimzukommen und von Sabine mit einem innigen Kuß empfangen zu werden. Sie sagte nicht, daß sie von Victors Tod gelesen hatte. Sie war glücklich, daß ihr Mann wieder daheim war.
*
Dr. Norden saß bei dem Notar Dr. Brandt und erklärte ihm, worum Victor ihn eigentlich gebeten hatte. Der Notar sah ihn zweifelnd und ungläubig an.
»Sie glauben doch nicht etwa, daß man eine solche Erbschaft ausschlagen könnte?« fragte er ironisch. »Bei so viel Geld hört der Stolz auf.«
»Ich möchte doch erst Frau Mainhards Einstellung dazu erforschen und bitte Sie, die amtliche Mitteilung noch zurückzuhalten.«
»Mir soll es recht sein«, brummte Dr. Brandt. »Ich würde mich jedenfalls nicht lange bitten lassen, ein Ja zu sagen.«
Und er wird wohl auch noch genug profitieren, dachte Dr. Norden seinerseits. Von zu Hause aus rief er die Nummer an, die Fee in Erfahrung gebracht hatte. Eine tiefe, ruhige Männerstimme meldete sich. »Mainhard, guten Tag.«
»Hier spricht Dr. Norden. Könnte ich bitte Frau Sabine Mainhard sprechen?«
»Ja, gern, aber bitte, worum handelt es sich?«
»Ich möchte es Frau Mainhard gern persönlich erklären«, sagte Daniel. Hoffentlich wird nicht wieder Eifersucht heraufbeschworen, dachte er dabei.
Sabine war maßlos überrascht. »Dr. Norden? Daniel Norden«, sagte sie staunend. »Wie haben Sie mich gefunden?«
»Das möchte ich Ihnen gern persönlich erzählen, Sabine. Wann könnte ich Sie am Wochenende erreichen?«
»Ist es etwa wegen Victor?« fragte sie gepreßt.
»Ja.«
»Das ist doch vorbei. Ich habe ganz zufällig gelesen, daß er gestorben ist.«
»Er hat mich um etwas gebeten. Bitte, Sabine, lehnen Sie ein Gespräch nicht ab.«
»Nicht, weil Sie darum ersuchen«, erwiderte sie nach einem kurzen Zögern. »Wir sind zu Hause. Ich habe keine Heimlichkeiten vor meinem Mann.«
»Um so besser. Wenn es Ihnen recht ist, werde ich dann am frühen Nachmittag kommen.«
Sabine erklärte sich einverstanden, doch mit einem sehr nachdenklichen Ausdruck legte sie den Hörer auf.
Manfred war hinausgegangen. Er hatte nichts von diesem Gespräch mitgehört, und er stellte auch keine Fragen.
Die Kinder waren im Garten, auch Martina, die im Schatten des alten Apfelbaumes, der für dieses Jahr reiche Ernte versprach, ihre Hausaufgaben machte.
»Dr. Norden wird am Samstag kommen, nachmittags«, sagte Sabine gedankenverloren zu ihrem Mann.
»Er ist dir bekannt?« fragte Manfred.
»Ja, von früher. Er ist Arzt.«
»Fehlt dir etwas?« fragte Manfred nun leicht erregt.
»Nein, es hat wohl mit Victor Wagner zu tun. Er ist gestorben. Ich habe es heute ganz zufällig in der Zeitung gelesen. Er wurde auf dem gleichen Friedhof bestattet wie auch deine Eltern.«
Unwillkürlich dachte Manfred an das noch frische Grab. »Er war doch nicht viel älter als ich«, sagte er geistesabwesend.
*
»Es könnte ja ein Unfall gewesen sein«, sagte Sabine, doch dieser Gedanke war ihr gerade eben erst gekommen. »Aber auch junge Menschen können krank sein«, fügte sie dann bebend hinzu. »Er hat nichts weiter gesagt.«
»Du wirst es ja hören, Liebes«, sagte Manfred.
»Wir werden es hören, Manni. Ich gehe jetzt an die Arbeit.«
»Gönnen wir uns doch einmal einen ruhigen Nachmittag, Sabine«, sagte er leise. »Es ist so schönes Wetter.« Er sah sie an. »Gegen diesen Dr. Norden hast du nichts?«
»Nein, er war sehr sympathisch. Er wußte genau, was er wollte. Ich glaube, er ist ein sehr guter Arzt geworden. Vielleicht weiß er für Martina einen Rat.«
»Und du bist gar nicht neugierig, was er dir sagen will?« fragte Manfred mit einem ganz flüchtigen Lächeln.
»Nein. Victor hat schon seit zwölf Jahren keine Bedeutung mehr für mich. Manche Menschen müssen sich wohl im Angesicht des Todes noch irgendwie rechtfertigen.« Sie sah ihn an. »Ich liebe dich«, fuhr sie voller Zärtlichkeit fort. »Unsere Gemeinsamkeit wird durch nichts gestört werden.«
Er nahm sie in die Arme und küßte sie. »Ich habe nur noch einen Wunsch«, sagte er leise, »daß unserer Martina geholfen werden kann.«
Sabine legte ihre schmalen Hände um sein Gesicht. »Einen besseren Vater als dich konnte sie nicht finden, liebster Manfred«, sagte sie innig. »Und in meiner Welt hat kein anderer Mann Platz.«
*
Am Freitag kam Martin Fiebig wieder zu Dr. Norden, der aber nichts verriet, was er inzwischen noch von Claudia erfahren hatte.
Er hatte jedoch erfahren, daß das Szintigramm eine beträchtliche Schilddrüsenüberfunktion ergeben hatte und war recht zufrieden, daß seine Diagnose auch diesbezüglich nicht widerlegt wurde.
Vor Überraschungen war auch ein so guter Arzt wie er nicht gefeit.
Nun konnte mit der Therapie begonnen werden, und Martin Fiebig zeigte sich auch sehr vernünftig, als Dr. Norden ihn ermahnte, die Medikamente regelmäßig zu nehmen und in einer Woche zur Kontrolluntersuchung zu erscheinen.
»Ich komme sehr gern zu Ihnen«, sagte Martin fast jungenhaft verlegen. »Schon Ihre Art übt eine beruhigende Wirkung auf mich aus. Ich hoffe, daß sich meine Frau auch bald nicht mehr über mich beklagen kann.«
»Sie beklagt sich nicht«, sagte Dr. Norden. »Sie hat sehr viel Verständnis für Ihre Sorgen. Aber Sie sollten doch einmal daran denken, mit Ihrer Frau gemeinsam einen längeren Urlaub zu machen.«
»Dann müssen wir auf unseren Notgroschen zurückgreifen«, sagte Martin.
»Denken Sie nicht zuviel an den Notgroschen, sondern mehr an Ihre Gesundheit und auch an die Ihrer Frau. Außerdem könnte ich Ihnen ein recht preiswertes Urlaubsquartier besorgen, wo sich auch der Junge wohl fühlen würde. Es ist ein Bauernhof im Chiemgau, der von einer Patientin bewirtschaftet wird. Die Anreise wäre auch nicht zu weit.«
»Bauer hätte ich werden wollen«, sagte Martin, »ja, dazu hätte ich auch Lust gehabt, wenn ich schon nicht Jura studieren konnte. Ich finde es unheimlich nett, daß Sie sich sogar um so was kümmern, Herr Doktor.«
»Man tut, was man kann«, lächelte Daniel. »Es war anscheinend mal wieder eine richtige Eingebung. Sagen Sie mir Bescheid, wann Sie Urlaub machen können, und ich spreche mit Frau Rimmel. Sie läßt sich gerne Gäste von mir vermitteln. Angewiesen ist sie nicht auf Vermietung, aber sie hat gern mal nette Menschen um sich.«
»Und es ist sehr nett von Ihnen, wenn Sie uns als nette Menschen bezeichnen«, sagte Martin. Fast schwärmerisch sah er den Arzt an. »Ich kann es noch immer nicht begreifen, daß es einen Arzt wie Sie gibt.«
»Na, mit Dr. Behnisch sind Sie doch hoffentlich auch zufrieden«, sagte Daniel schmunzelnd.
»Das schon, aber eine Klinik jagt mir doch immer Angstschauer ein.«
»Gut, daß wir welche haben. Oft sind sie lebensrettend, Herr Fiebig. Das dürfen Sie nie vergessen. Und Angst vor Krankheiten verschlimmert jede, das muß ich Ihnen auch sagen.«
»Ich bin ein Feigling.«
Vielleicht war er das wirklich, aber er hatte auch seine guten Seiten, und er hatte eine tatkräftige Frau. So ergänzte sich manches zum Vorteil, vor allem, wenn jeder guten Willens war, und die Fiebigs waren es.
Dr. Norden fuhr ganz zufrieden nach Hause. »Morgen fahren wir zu Sabine«, sagte er zu Fee.
»Wir?« fragte sie.
»Natürlich wir. Es soll eine sehr hübsche Gegend sein, und wir kennen sie noch nicht. Wir essen draußen zu Mittag, und du kannst mit den Kindern ein bißchen wandern.«
»Oder Sabines Kinder spielen mit ihnen«, warf Fee ein, und ein verschmitztes Lächeln legte sich um ihre Lippen. »Du willst doch nicht auf meine Unterstützung verzichten, Daniel.«
»Wieder mal durchschaut«, sagte er mit leisem Lachen. »Du kannst auf den Grund meiner Seele schauen.«
»Wenn man das nur könnte«, meinte sie seufzend. »Wie sehr wäre den Ärzten geholfen und damit auch den Patienten, aber man kann halt nur dann Gedanken lesen, wenn man einen Menschen in- und auswendig kennt.«
»Wie schaue ich eigentlich inwendig aus?« scherzte er.
»Gesund, glücklicherweise«, erwiderte Fee zufrieden.
Die Kinder freuten sich natürlich auf den Ausflug, und der guten Lenni wurde mal wieder ein ruhiger Tag beschieden. Doch für sie war das gar nicht wichtig. Richtig zufrieden würde sie erst sein, wenn die Familie Norden wieder wohlbehalten zu Hause war. Mit ihrem ganzen warmen, dankbaren Herzen hing Lenni an dieser Familie, seit sie ihren Mann und ihre Mutter durch einen tragischen Autounfall verloren hatte und auch ihr eigenes Leben ihr nichts mehr bedeutete. Aber Dr. Norden hatte sie davor bewahrt, dieses Leben in tiefster Verzweiflung zu beenden, und seither gehörte ihre ganze Liebe denen, für die sie sorgen durfte, und vor allem auch den Kindern, die sie so zärtlich liebte, und die ihrer lieben Lenni die gleiche Liebe entgegenbrachten.
Ein strahlender Tag sollte ihnen beschert sein. Die ganze Stadt schien hinauszuströmen zu den Ausflugsgebieten, aber Dr. Norden kannte die stilleren Schleichwege, und sie hatten es nicht eilig.
Sie fanden auch einen Gasthof, der wahrhaft einladend gastlich aussah. Für die Kinder war es am wichtigsten, daß sie im schattigen Biergarten essen konnten. Da schmeckte es noch mal so gut. Jeder bekam, was er am liebsten wollte, und so einig sich die Nordens auch sonst waren, ihre Geschmäcker waren ganz verschieden. Wenn außerhalb gegessen wurde, kam das zu Tage. Fünf verschiedene Gerichte standen auf dem Tisch. Für Daniel eine knusprige Kalbshaxe mit Salat, für Fee Wir-
sing und mageres Tellerfleisch, für Danny Hamburger, die hier Fleischpflanzerl genannt wurden, mit Kartoffelbrei und Soße, für Felix Kinderschnitzel mit Salaten und für Anneka eine Nudelsuppe mit Huhn. Und jeder konnte beim anderen kosten, das war das Beste. Grad lustig ging es da zu, und aufpassen brauchte man auch nicht, weil keine Tischdecke schmutzig werden konnte. Die kleinen Freuden des Lebens waren für den strapazierten Arzt die großen, und er genoß sie und wollte noch nicht an die Unterredung mit Sabine denken.
Aber dann rückte die Stunde doch heran. Sie hielten vor dem hübschen Bauernhaus. Axel und Kathrin riefen gleich im Duett:
»Mami, der Besuch kommt«, aber dann galt ihre Aufmerksamkeit den drei Kindern. Was kümmerte es sie, was der fremde Mann mit ihrer Mami sprechen wollte. Sie waren unbefangen.
»Spielt ihr mit uns?« fragte Axel. Und der mit ihm gleichaltrige Danny war gleich dazu bereit.
Sabine war aus dem Haus gekommen. Sie lächelte verlegen. »Drei Kinder haben Sie, Dr. Norden«, fragte sie.
»Sie sehen es, Sabine«, erwiderte Daniel, erfreut, Sabine immer noch mädchenhaft hübsch und fast unverändert zu sehen. »Und meine Frau möchte Sie auch gern kennenlernen.«
»Es freut uns sehr«, sagte Sabine. »Herzlich willkommen.«
Höflich, aber ebenfalls freundlich wurden sie auch von Manfred willkommen geheißen. Nur Martina fehlte.
»Haben Sie nicht auch drei Kinder?« fragte Fee spontan.
»Ja, aber Martina hat einen schweren Herzfehler und muß die Sonne meiden, wenn sie so herunterbrennt wie heute«, erwiderte Sabine.
Daniel runzelte leicht die Stirn. »Kann man nicht helfen?« fragte er.
»Sie müßte operiert werden«, erwiderte Manfred, »aber bisher wird das nur in Kanada gemacht.«
»Unser Herzzentrum ist doch auch entwickelt worden«, sagte Daniel. »Nun, darüber können wir noch sprechen. Ich habe vorerst eine Mission zu erfüllen.«
»Eine Mission?« wiederholte Sabine stockend.
»Es geht um den Letzten Willen eines jetzt Verstorbenen«, sagte Daniel.
»Mein Mann kann es ruhig wissen. Wir haben keine Geheimnisse voreinander«, sagte Sabine hastig.
»Um so besser. Sie hätte ich gleich wiedererkannt, Sabine.«
»Ich Sie auch, Daniel. Sie haben sich kaum verändert. Aber immerhin sind zwölf Jahre vergangen, und in unserer beider Leben hat sich einiges geändert.«
»Und zwölf Jahre sind eine lange Zeit«, sagte Manfred.
*
Ja, es war eine lange Zeit; und darüber wurde gesprochen, bevor Daniel Norden dann über seinen Besuch bei Victor sprach.
»Er ist sich bewußt gewesen, wie tief er Sie verletzt hat, Sabine. Ich denke, er war schließlich ein sehr einsamer Mensch. Er hat mit dem Gedanken gelebt, etwas gutmachen zu müssen, und er ist mit dem Gedanken gestorben, daß sein Letzter Wille erfüllt wird. Er hat Ihnen und dem Kind sein gesamtes Vermögen hinterlassen.«
Sabine starrte ihn an und hob abwehrend die Hände. »Nein, ich will es nicht«, rief sie aus. Dann griff sie nach Manfreds Arm. »Das ist Martinas Vater, sie kennt keinen anderen, und sie soll niemals etwas anderes erfahren.«
»Das braucht sie doch nicht«, sagte Daniel Norden ruhig. »Victor hat kei-nerlei Bedingungen gestellt. Er hat tiefe Reue empfunden.«
»Er hat mir nichts mehr bedeutet, seit ich Manfreds Frau bin. Ich liebe meinen Mann, und er liebt Martina. Und ich will nicht, daß ihre Geschwister jemals erfahren, daß sie einen anderen Vater hat.«
»Wir kommen auch so zurecht. Wir brauchen das Geld dieses Mannes nicht«, warf Manfred ein. »Ich werde es auch so schaffen, daß Martina operiert werden kann. Ich will die Liebe dieses Kindes ganz einfach nicht verlieren.«
Und da stand die kleine Martina im Türrahmen. Riesengroß schienen die dunklen Augen in dem kleinen, blassen Gesicht.
»Das wirst du auch nicht, Papi«, sagte sie. »Entschuldigung, daß ich fast alles gehört habe. Ich wollte eigentlich zu den Kindern gehen.«
»Geh zu den Kindern, Kleines«, sagte Sabine bebend. »Was wir hier sprechen, hat nichts mit dir zu tun.«
»O doch, Mami«, sagte Martina. »Ich habe es ganz richtig verstanden, denke ich. Ich weiß auch, daß die Operation viel, viel Geld kosten würde Aber ich möchte gern gesund sein.«
Fee preßte die Lippen aufeinander. heiße Tränen stiegen ihr ebenso in die Augen wie Sabine, aber sie konnte sich beherrschen.
»Ich will auch nicht, daß Papi nur für mich arbeitet. Axel und Kathrin sind doch auch da«, fuhr Martina fort, und dann sah sie Dr. Norden an. »Ist es so viel Geld, daß man damit die Operation bezahlen kann?« fragte sie leise.
»Ja, ich denke schon«, erwiderte er ausweichend.
»Dann mußt du es annehmen, Mami«, sagte Martina. »Meinetwegen. Ich möchte doch noch so gern bei euch bleiben. Ich habe euch so lieb. Sag du es, Papi. Sag, daß Mami es nicht ablehnt.«
Und sie ging zu Fee. »Und Sie sagen es bitte auch. Wenn ich gesund werde, könnte ich studieren und auch Arzt werden und anderen Menschen helfen. Das wünsche ich mir so sehr.«
»Du hast es nie gesagt, Tina«, flüsterte Manfred, während Sabine nun gewaltsam gegen die Tränen ankämpfen mußte.
»Ich konnte nichts sagen. Ich weiß doch nicht, wie lange ich lebe. Darüber habe ich mir schon Gedanken gemacht.«
Hilflos sah Fee ihren Mann an, wahrend Sabine und Manfred zu Boden blickten und den flehenden Kinderaugen auswichen.
»Du wirst leben, Martina«, sagte Daniel Norden. »Und du wirst bestimmt vielen Menschen helfen können mit dieser Einstellung. Wenn man schon in so jungen Jahren solch ein Ziel hat, wird Gottes Segen dich begleiten.«
Und wieder einmal waren ihm die richtigen Worte in den Mund gelegt worden.
Martinas Augen leuchteten auf. »Ja, daran glaube ich«, sagte sie. »Und jetzt gehe ich zu den Kindern. Die kleine Anneka ist so süß. Buben können nicht so gut mit einem kleinen Mädchen spielen. Ich habe ihnen schon ein bissel zugeschaut.«
Und gleich waren die vier Erwachsenen allein, und nun wanderten die Blicke hin und her.
Und wieder war es Daniel, der zuerst Worte fand. »Sie haben es gehört, Sabine. Victor wußte nichts von der Herzkrankheit des Kindes, aber was wissen wir von den Gedankengängen eines Kranken, der sein Ende vor sich sieht. Er hat Ihnen sehr weh getan, aber er wollte es gutmachen. Ich bin überzeugt, daß es ihn sogar beruhigte, daß Sie einen guten, fürsorglichen Mann gefunden haben. Ich weiß, daß er Ihnen all das schreiben wollte, aber dazu hatte er nicht die Kraft. Und er fürchtete, nicht die richtigen Worte zu finden. Martina ist ihm diesbezüglich voraus. Ich habe noch kein Kind kennengelernt, das in so jungen Jahren so viel Reife zeigt.«
»Sie liest viel«, sagte Manfred. »Wer weiß, was sie alles liest. Sie holt sich Bücher und stellt sie zurück. Sie darf ja keinen Sport treiben und herumtollen. Nun hat sie begriffen, daß ich nicht ihr Vater bin«, schloß er deprimiert.
»So dürfen Sie es nicht sehen. Ich meine, daß sie ziemlich deutlich sagte, daß sie Sie als ihren Vater betrachtet. Für sie existiert jetzt nur ein Toter, der ihr Geld hinterlassen hat. Sie braucht nicht zu erfahren, wieviel es ist.«
»Für mich ist es dennoch schwer, ja zu sagen«, murmelte Sabine.
»Sie tun es für Martina«, warf Fee ein. »Und warum fremde Menschen, der Staat oder irgendwelche Institutionen?«
»Kann es uns denn Glück bringen, da es sein Geld ist?« fragte Sabine. »Sie wissen nicht, wie sehr er mich gedemütigt hat.«
»Ich weiß es, Sabine«, sagte Manfred. »Aber ein kranker Mensch hat meist auch eine kranke Seele. Er war doch lange krank?« richtete er das Wort an Daniel.
»Ja, eine solche Krankheit kommt nicht über Nacht«, erwiderte Dr. Norden. »Anfangs macht sie sich sporadisch bemerkbar.«
»Er hat alles immer so leicht genommen«, sagte Sabine. »Er brauchte sich um seine Zukunft doch auch keine Sorgen zu machen.«
»Doch all sein Geld nützte ihm nichts«, sagte Fee verhalten. »Im Angesicht des Todes wird Geld bedeutungslos. Ewiges Leben kann sich niemand erkaufen und kein Arzt der Welt kann einem dazu verhelfen. Aber Martinas Leben soll alles unwesentlich erscheinen lassen, was in der Vergangenheit war.«
»Kann sie gerettet werden, Dr. Norden?« fragte Sabine.
»Welche Diagnose wurde erstellt?« fragte der Arzt.
»Wir verstehen nichts davon. Ich werde den Bericht holen«, sagte Manfred Mainhard mit fester Stimme.
Und dann las Dr. Norden. Sein Gesicht war sehr ernst. »Ich würde schnellstens zu dieser Operation raten, noch bevor die Pubertätsphase einsetzt, die sich bei Martina ja zum Glück verzögert hat. Überlegen Sie nicht mehr. Nehmen Sie das Geld.Tun Sie es für das Kind. Ich werde Ihnen gern behilflich sein, daß Martina von Professor Tucker selbst operiert wird.«
»Sie kennen diesen Arzt?« fragte Manfred.
»Nicht persönlich, seinen Ruf.«
»Paps kennt ihn«, warf Fee ein. »Sie können Martina begleiten. Sie wird nicht allein sein.«
»Und die beiden Kinder?« fragte Sabine.
»Die können Sie doch auch mitnehmen. Manchmal hat Geld auch seine guten Seiten. Zögern Sie doch nicht. Betrachten Sie alles als einen Fingerzeig Gottes.«
»Ja, er hat dir weh getan, Sabine, und dafür habe ich ihn tief verachtet«, sagte Manfred. »Ich weiß nicht, was geschehen wäre, hätte ich ihn zu Lebzeiten getroffen. Aber er hat sehr leiden müssen, und jetzt kommt durch ihn die Rettung für Martina, und wir können bei ihr sein. Sie braucht nicht zu entbehren, was sie liebt. Sie hat es uns doch zu verstehen gegeben, wie sie denkt und fühlt. Ich will gewiß nicht mehr, als das, was dem Kind hilft, und was darüberhinaus bleibt, soll für andere verwendet werden. Ich sage es hier vor Zeugen und gebe es schriftlich. Niemand soll denken, daß ich mich bereichern will. Martina ist das Kind, das ich am meisten liebe.« Seine Stimme bebte. »So wahr mir Gott helfe, es ist die Wahrheit!«
»Nun, Sabine?« fragte Dr. Norden nach einem langen Schweigen.
»Ich sage ja«, erwiderte sie und streckte ihm die Hand entgegen. »Sie verstehen ja alles, Daniel, auch die zerrissenste Seele.«
Ganz spontan ging Fee auf Sabine zu. »Wir werden uns hoffentlich noch oft sehen und uns freuen können«, flüsterte sie.
Sabine wischte sich ein paar Tränen aus den Augen. »Sie haben das Große Los mit Daniel gezogen und ich mit Manfred, aber wenn Martina geholfen wird, werde ich ohne Groll an Victor denken können. Ich kann aus meiner Haut nicht heraus. Leicht ist mir das Ja nicht gefallen.«
Und das wäre es wohl erst recht nicht, hätte sie da schon gewußt, daß sie über mehr als eine Million verfügen konnte. Aber da stand es schon fest, daß sie bereits am nächsten Freitag die Flugreise nach Kanada antreten konnten.
Dr. Johannes Cornelius hatte ein langes Telefongespräch mit Professor Tucker geführt. Vor vielen Jahren hatten sie sich kennengelernt, aber Erinnerungen waren schnell aufgefrischt gewesen. Zwei Ärzte, die auf unterschiedlichen Gebieten helfen wollten, verständigten sich rasch.
Doch am meisten begeistert war Axel, daß er die weite Reise mit den Eltern und Geschwistern antreten konnte, daß seine Ferien viel früher begannen als bei den anderen.
»Das hab’ ich nur dir zu verdanken, Tina«, sagte er, als er im Flugzeug neben seiner großen Schwester saß, »dafür wirst du auch ganz gesund.«
Er wußte nichts um die Angst der Eltern, er wußte nicht, welche Gedanken Martina bewegten, als sich das Flugzeug emporhob, dann nur der Himmel über ihnen war, die Wolken unter ihnen. Zwischen Himmel und Erde schwebten sie dahin.
*
»Meinst du, daß die Operation Martina Genesung bringen wird?« fragte Fee ihren Mann.
»Wenn sie gelingt«, erwiderte er zögernd. »Ein Risiko ist immer dabei. Aber schau nicht gleich so ängstlich, Fee. Tucker ist der Mann für diese Operation.«
»Und warum können solche Operationen nicht auch bei uns durchgeführt werden?«
»Einmal, weil besondere klimatische Bedingungen dafür nötig sind, zum anderen wohl auch, weil wir in mancher Beziehung doch ein bißchen hinter-herhinken. Kompetenzstreitigkeiten, ewiglanges Hin und Her wegen Bewilligung der Gelder, und leider sind ja auch so manche kompetente Ärzte abgewandert, weil sie es satt haben, all die Steine wegzuräumen, die ihnen in den Weg geworfen werden.Wir fragen uns doch auch ständig, warum bei uns die Kindersterblichkeit noch höher ist als in anderen Ländern, die in vielen anderen Gebieten nicht mit uns Schritt halten können.«
»Ich habe erst neulich gelesen, daß bei uns viel mehr Ärzte praktizieren, als notwendig wären«, sagte Fee.
»In den Großstädten, mein Schatz. Ich gehöre auch zu denen, die mehr Patienten haben, als ihnen nach Errechnung zustehen würden. Aber gehen wir mal aufs Land, in die Dörfer. Wie ist denn da die Versorgung?«
»Man denkt eben auch an die Kinder, an die weiten Schulwege«, sagte Fee. »Und an die gesellschaftlichen Ereignisse, an denen man teilhaben möchte.«
»Auf uns trifft das recht sparsam zu«, sagte sie.
»Was vermißt du?« fragte Daniel.
»Ich? Nichts. Ich habe doch euch. Man kann sich schließlich nicht verzetteln.«
»Andere Frauen denken anders, Liebling. Und leider ist es ja auch so, daß sehr viele an ihr Bankkonto denken. Der Hausarzt ist im Aussterben begriffen, darüber müssen wir uns doch im klaren sein.«
»Du wirst doch nicht zu den letzten gehören, Daniel?«
»Weiß man es? Der Notarzt wird gerufen, der Patient wird in die Klinik gebracht, gleich, was ihm fehlt. Ich mache mir keine Illusionen, Fee. So wird es in der Zukunft sein.«
»Wenn die nächste Generation überhaupt noch eine hat.«
»Was sind das für Gedanken, Liebes?«
»Die kommen von selbst, wenn man jeden Tag die Zeitung liest.«
»Dann lies sie nicht mehr.«
»Ist es nicht so, daß die Menschen sich selbst zerstören und alles, was Generationen vor uns geschaffen haben? Wo gibt es denn noch eine heile Welt? Wie soll es denn weitergehen, wenn alle Ideale willkürlich zerstört werden?«
»Du hast heute aber einen sehr kritischen Tag«, stellte Daniel fest.
»Ich habe manchmal einfach eine Wut«, sagte Fee. »Da schuften sich manchmal Menschen zu Tode, und andere lungern nur herum, wollen aber dennoch alles haben. Es wird gestohlen und gemordet…«
»Und es gibt so viele, die sich in ihrem Glauben an das Gute nicht beirren lassen. Du gehörst doch auch dazu, Fee.«
»Und du auch.«
»Es wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Dann wäre alles sinnlos. Dann könnten wir uns in die Einöde zurückziehen und würden dort auch nicht sicher sein. Wir könnten alles vergraben, was wir haben und eines Tages zu der bitteren Erkenntnis kommen, daß wir unseren Kindern den Weg verbaut haben, weil wir nur noch zweifelten. Jede Generation und jede Zeit hat ihre Probleme, und jeder Mensch ist seines Glückes Schmied oder auch seines Unglücks. Aber nun genug davon, mein Schatz. Gehen wir noch ein halbes Stündchen durch unseren Garten, in dem auch nach dem kalten Frost alles wieder grünt und blüht. Und hoffentlich können wir uns auch bald freuen, daß ein junges, wertvolles, geliebtes Leben gerettet wird.«
Fee lehnte sich an ihn. »Jetzt sind sie schon in Kanada.«
*
Ja, die Mainhards waren glücklich gelandet, und sie brauchten nicht in einem unpersönlichen Hotel zu wohnen. Professor Tucker hatte dafür gesorgt, daß sie in einem kleinen Haus für sich sein konnten.
»Es ist bald so wie zu Hause«, sagte Axel. »Ich habe mir alles ganz anders vorgestellt.« Es klang fast ein wenig enttäuscht.
»Wolltest du in einem Wohnwagen durchs Land ziehen?« scherzte Manfred, obgleich ihm zum Scherzen eigentlich nicht zumute war.
»Es sieht wirklich nicht viel anders aus als bei uns«, sagte Kathrin. »Ich habe noch keinen Bären gesehen.«
»Davor möchten wir auch verschont bleiben«, murmelte Manfred.
»Bären sind doch lieb. Man darf sie nur nicht reizen«, sagte Axel.
»Ihr erlebt keinen Film, sondern die Wirklichkeit«, wurde er von Manfred belehrt.
»Die Küche ist ganz toll«, sagte Martina. »So eine müßte Mami auch haben. Wenigstens eine Geschirrspülmaschine.«
»Ach was«, sagte Sabine, »mir macht das Spülen nichts aus. Und jetzt schlafen wir uns erst mal richtig aus.«
»Es ist aber noch gar nicht dunkel«, sagte Axel. »Ich habe auch im Flugzeug so lange geschlafen.«
»Wenn Mami müde ist, soll sie schlafen«, sagte Martina.
Sie wirkte nicht müde. Sie strahlte Zuversicht aus.
»Unsere Martina ist ein erstaunliches Kind«, sagte Manfred zu Sabine, als sie allein waren. Ganz schnell waren Axel und Kathrin dann doch eingeschlafen.
»Wenn sie uns nur erhalten bleibt, Manni. Ich habe solche Angst.«
»Sie hat keine Angst«, sagte er. »Sie ist voller Zuversicht.«
»In acht Wochen wird sie zwölf Jahre«, sagte Sabine gedanken voll.
»Und dann sind wir vielleicht schon wieder daheim«, sagte er, seinen Arm unter ihren Nacken schiebend. »Und du bekommst eine Geschirrspülmaschine, damit deine Hände nicht doppelt strapaziert werden.«
»Wir wollen uns an die Abmachung halten, Manni. Kein Pfennig mehr wird ausgegeben, als für Martina gut ist.«
»Vielleicht nehmen sie meinen Roman«, sagte er. »Ich hätte Burger Bescheid sagen sollen, daß ich zu Hause nicht zu erreichen bin.«
»Welchen Roman meinst du?« fragte sie staunend.
»Ich habe ihn geschrieben, als wir uns kennenlernten, aber dann kam alles ganz anders, als ich dachte, und ich habe ihn in die Schublade gelegt. Aber es kann ja sein, daß ich auch mal eine Fortsetzung schreibe. Aber wie es auch sei, Liebes, ich schaffe es schon, euch ein besseres Leben zu bereiten.«
»Ich bin sehr zufrieden, und wenn Martina gesund wird, bleibt kein Wunsch offen, das solltest du eigentlich wissen, Manni.«
»Hast du dir schon Gedanken gemacht, was du mit dem Geld machen willst, das übrigbleibt?«
»Ja, aber darüber reden wir erst, wenn wir unsere Martina mit nach Hause nehmen können.«
»Es gibt behinderte Kinder, die keine vermögenden Eltern haben«, sagte er leise.
Sie schmiegte sich eng an ihn. »Zwei Seelen und ein Gedanke, Liebster. Wenn es nur immer so bleiben würde.«
»An mir soll es nicht liegen, Sabine.« Seine Lippen streichelten ihr Gesicht. Und sie schlief in seinen Armen ein, wie so oft, sich geborgen fühlend.
*
Schon am nächsten Tag fuhren sie zur Klinik. Es war ein großes supermodernes Gebäude von riesigen Ausmaßen, das allen Beklemmungen einflößte.
»Hauptsache ist, du kannst dann herumspringen, wenn wir dich abholen, Tina«, sagte Axel. »Aber hoffentlich kannst du die Leute verstehen.«
»Tina kann doch englisch«, sagte Kathrin. »Siehst du nun, wie wichtig es ist, wenn man Sprachen lernt.«
»Du Klugschnack«, brummte Axel.
Man setzte wohl nicht voraus, daß die kleine Martina so perfekt schon die englische Sprache beherrschte, denn vieles wurde dann gesagt, was sie eigentlich nicht verstehen sollte. Aber Professor Tucker war so was wie ein guter Nikolaus für die kleine Patientin, die sich so tapfer in ihr Schicksal fügte. Mit seinem weißen Haar und Bart und den blitzenden Blauaugen gewann er gleich ihr Vertrauen.
Aber sie setzte den erfahrenen Arzt in Erstaunen und brachte ihn sogar in Verlegenheit.
»Ich weiß schon, daß es schwierig ist«, sagte Martina, »aber wenn Sie mir wenigstens ein bißchen helfen können, bin ich schon froh. Sie brauchen ja meinen Eltern nicht zu sagen, wenn es nicht ganz gut werden kann.«
Professor Tucker schluckte zweimal. »Und woher nimmt die junge Dame diese Weisheit?« fragte er heiser.
»Ich habe Ohren und kann denken«, erwiderte Martina.
»Für dein Alter bist du aber schon verflixt schlau«, sagte Professor Tucker.
»Ich durfte ja nie draußen spielen, da habe ich gelernt«, erwiderte sie.
»Und wahrhaftig keine Zeit vergeudet, Tina. Na, dann reden wir mal offen. So eine Operation kann nur gelingen, wenn der Patient tüchtig mithilft. Hast du Angst?«
»Nein, es wäre viel schlimmer, wenn Mami oder Papi krank wären. Die Kleinen brauchen sie doch so sehr.«
Professor Tucker konnte es nicht verhindern, daß seine Augen feucht wurden. »Wir werden gut miteinander auskommen,Tina«, sagte er. »Ich mag so mutige Mädchen.«
»Sie müssen mir nur alles erklären«, sagte Tina. »Ich will nämlich auch mal Ärztin werden, und dann will ich schon viel wissen.«
»Aber wenn du mal Ärztin bist, werden wir hoffentlich schon ein ganzes Stück weiter sein«, sagte er sinnend.
Sie sah ihn fragend an. »Kriege ich ein neues Herz? So was gibt es auch.«
»Sagen wir mal ein beinahe neues, kleines Fräulein.«
»Aber ich kann meins behalten?«
»Aber ganz bestimmt. Du hast also doch Angst.«
»Nur davor, daß ich ein Herz bekommen könnte von einem der tot ist, das mag ich nicht.«
»Und dafür hast du auch eine Erklärung, Tina?«
»Ja. Weil so ein Mensch doch ganz andere liebgehabt hat, und in meinem Herzen wohnen Mami, Papi und meine Geschwister.«
»Ich möchte darin auch einen Platz haben, Tina«, sagte Professor Tucker, »und du kannst du zu mir sagen. Wir sind jetzt dicke Freunde.«
»Und wie noch?« fragte Tina.
»Was noch?«
»Bloß du? Wie heißt du noch?«
»Sag einfach Tucker. Jonathan ist kein Name, der jungen Damen gefällt.«
»Mir gefällt er aber sehr, Jonathan«, sagte Tina.
»Was soll jetzt noch schiefgehen«, brummte er gerührt. »Vergiß alles, was dein kluges Köpfchen aufgeschnappt hat, Tina.«
»Ich weiß aber, daß es sehr schwierig ist. Ich halte dir die Daumen«, sagte das Kind.
*
»Das ist ein Kind«, sagte Professor Tucker zu Manfred und Sabine, als sie sich zusammengesetzt hatten. »Alles, was ich besitze, würde ich geben, wenn ich sie Ihnen abkaufen könnte.«
»Für nichts auf der Welt«, erwiderte Manfred.
»Das habe ich mir gedacht. Es war auch nur so ein Wunschtraum. Wann passiert es einem schon mal, daß so ein kleines Geschöpf so viel Herz und Verstand hat.«
»Sie sprechen aber von einem kranken Herzen«, sagte Manfred rauh.
»Das ist die Ungerechtigkeit, die mich aufbegehren läßt«, erwiderte der Professor. »Sie dürfen versichert sein, daß ich das Bestmögliche tun werde, um Tina zu einem normalen Leben zu verhelfen, und ich werde dafür kein Honorar fordern.«
»Aber wir haben das Geld für die Operation«, sagte Sabine.
»Dann verwenden Sie es anderweitig.«
Nun hatten sie das Geld, und nun wollte dieser berühmte Professor keins haben. Doch Tucker sagte ihnen mit einem leicht spöttischen Unterton, daß die Hospitalkosten wohl hoch genug sein würden. »Unsere Verwaltung macht keine Zugeständnisse«, bemerkte er.
»Eine solche Klinik erfordert ja auch einen gewaltigen Aufwand«, meinte Manfred vernünftig.
Tucker machte eine abwehrende Bewegung. »In aller Welt werden so ungeheure Summen für Vernichtungswaffen ausgegeben, daß es einem hochkommen könnte. Und was Menschenleben zu erhalten betrifft, ist oft nicht das Notwendigste vorhanden. Aber darüber könnte ich mich stundenlang auslassen und in Zorn reden. Es ist einfach schön, wenn man sich an einem Kind erfreuen kann, wie Tina eines ist.«
Die Worte gingen Manfred und Sabine nicht aus dem Sinn.
»Er hat wirklich eine besondere Beziehung zu Tina«, sagte Sabine nachdenklich, »und dies nach dieser kurzen Zeit.«
»Wir haben sie immer als unser Sorgenkind betrachtet«, bemerkte Manfred. »Er wird ihr helfen, davon bin ich überzeugt.«
Aber sie ahnten nicht, wieviel Gedanken sich Jonathan Tucker über diese Operation machte, wenn er die Röntgenbilder betrachtete. Dann meinte er, Tinas Stimme zu vernehmen: Ich halte dir die Daumen! Ja, das würde er brauchen. Seine Gedanken wanderten viele Jahre zurück. Sein eigenes Kind hatte er nicht retten können, und darüber war auch seine Ehe zerbrochen. Aber damals, vor dreißig Jahren, hatten sie noch nicht die Möglichkeiten gehabt, solche Operationen auszuführen. Lange hatte es gedauert, bis die Voraussetzungen dafür geschaffen wurden, und er hatte sich zäh und verbissen Schritt für Schritt vorwärts gekämpft. Viele Erfolge konnte er verzeichnen, aber auch Mißerfolge waren nicht ausgeblieben.
Nun war da ein Kind, das ihn gläubig und vertrauend anblickte, ein Kind, dem sein Herz sich zugewandt hatte. Er war mit jeder Faser seines Seins engagiert.
Nachdem er sich sogar über die Wettervoraussagen informiert hatte, setzte er die Operation für Donnerstag an. Ein wenig spielte da sogar der Aberglauben mit, denn eine Patientin mit astrologischen Ambitionen hatte einst den Donnerstag als seinen Glückstag bezeichnet.
»Also dann am Donnerstag, Tina«, sagte er zu dem Kind, und er hielt die kleinen Hände fest umschlossen.
»Fein«, sagte sie, »an einem Donnerstag bin ich geboren, da kann nichts schiefgehen.«
Er brauchte ihr nicht Mut zu machen, sie machte ihm Mut. Er beugte sich herab und küßte sie auf die Stirn. »Du bist ein richtiger Schatz«, sagte er weich.
*
Dr. Nordens Gedanken weilten oft in Kanada, doch gerade in diesen Tagen wurde bekannt, daß in München eine Herztransplantation gelungen war.
»Das scheint einfacher zu sein, als Anomalien zu beheben«, sagte er zu Fee. »Immerhin ist es tröstlich zu wissen, daß auch auf dem Gebiet der Medizin Fortschritte erzielt werden.«
Doch schon kamen neue Hiobsbotschaften. In Spanien war eine Epidemie ausgebrochen, die viele Todesopfer forderte und deren Ursache man noch nicht auf den Grund gekommen war.
»Kaum ist ein Virus in den Griff bekommen, bereitet uns ein anderer Kopfzerbrechen«, sagte Daniel nachdenklich.
»Und so lange die Erde sich dreht, wird der Mensch ein Rätsel bleiben«, sagte Fee, »aber wenn man mal die Todesanzeigen liest, muß man doch feststellen, daß viele Menschen sehr alt werden.«
»Und wenn immer weniger Kinder geboren werden, wird der Staat völlig überaltert.«
»Augenblicklich scheint es aber einen Babyboom zu geben.«
»Und schon wird auch wieder darüber geredet, daß Vergünstigungen für junge Paare und Kinder gestrichen werden sollen. Die Folge wird sein, daß eben doch wieder weniger Kinder geboren werden. Ich fürchte, daß unserem Nachwuchs keine rosigen Zeiten beschieden sein werden.«
»Man muß sich immer den Gegebenheiten anpassen, mein Schatz. Unsere Eltern mußten das und frühere Generationen auch. Man darf Wohlstand nicht als etwas Selbstverständliches betrachten und nicht munter in den Tag hineinleben, wie es so viele tun.«
»Andererseits kann man es aber auch verstehen, daß die Jugend etwas vom Leben haben will, wenn sie dauernd hören müssen, daß die fetten Jahre vorbei sind.«
Ja, die Nordens standen mitten im Leben und machten sich keine Illusionen, aber sie genossen auch gern die schönen, sorgenfreien Tage, die ihnen beschieden waren.
»Wir werden ja hören, was die Mainhards zu erzählen haben«, meinte Daniel. »Ob das Leben in Kanada besser und billiger ist als hier?«
»Du willst doch nicht etwa auswandern?« scherzte Fee.
»Gott bewahre, ich bin ein seßhafter Mensch. Bleibe im Land und nähre dich redlich.«
»Hast du Hunger?« fragte Fee.
»Gegen was zum Knabbern hätte ich nichts einzuwenden.«
Und das bekam er.
Am nächsten Morgen kam Claudia Fiebig mit dem kleinen Danny zu ihm in die Praxis. Der Junge hatte einen gehörigen Schnupfen, und außerdem schien sich eine Mittelohrentzündung anzubahnen.
»Gut, daß Sie so bald kommen, da bleiben dem Kleinen große Schmerzen erspart, Frau Fiebig«, sagte Dr. Norden.
»Daß etwas mit den Ohren sein könnte, ahnte ich gar nicht«, sagte Claudia. »Sie sind sehr gründlich.«
»Ich habe doch selbst Kinder. Nun, wie ist es mit dem Urlaub?«
»In drei Wochen könnten wir ihn nehmen. Mein Chef war sehr einsichtig. Martins weniger, aber diesmal war sogar mein Mann energisch. Jetzt wissen sie wenigstens, daß er sich nicht alles gefallen läßt. Und das habe ich auch wirklich nur Ihnen zu verdanken. Martin zeigt jetzt viel mehr Rückgrat.«
»Weil er sich wohler fühlt«, sagte Dr. Norden. »Der Urlaub wird Ihnen guttun. Ich werde heute abend gleich mit Frau Rimmel telefonieren.«
»Meinen Sie denn wirklich, daß sie uns nimmt?«
»Da bin ich ganz sicher. Und es wird Ihnen gefallen. Es ist eine liebe Frau. Sie nimmt aber nur Gäste, die ihr von guten Bekannten empfohlen werden, weil sie mal gehörig hereingefallen ist. Sie können sich schon vorbereiten.«
»Ich freue mich so«, sagte Claudia. »Wir konnten noch nie gemeinsam Urlaub machen. Und Martin mag doch überhaupt keinen Betrieb. Seine Eigenheiten hat er schon, aber zum Glück keine, die man nicht tolerieren kann. Ich muß diesem jungen Mann fast dankbar sein, der uns in den Wagen gefahren ist. Dadurch habe ich Sie kennengelernt. Übrigens will er den Schaden selbst bezahlen.«
»Darauf lassen Sie sich mal lieber nicht ein«, sagte Daniel. »Die jungen Burschen sind recht clever. Meistens werden die Rechnungen höher, als man meint und hinterher ist es leicht der Geschädigte, der draufzahlen muß.«
»Das hat Martin auch gesagt. Ich hätte mich schon beschwatzen lassen.«
»Und Papi hat geschümpft«, sagte Danny.
»Mir recht, Sohnemann«, sagte Claudia lächelnd. Dann blinzelte sie Dr. Norden zu. »Die Eifersucht, wenn ein Mann aufkreuzt, ist Martin nicht auszutreiben.«
»Das wird sich geben«, lächelte Dr. Norden. »Ich war früher auch sehr eifersüchtig und auch völlig grundlos.«
Und während er redete, wurde Danny versorgt, der das gar nicht so richtig mitbekam, weil er sehr interessiert zuhörte, was der nette Onkel Doktor alles sagte.
»Na, du wirst deinen Spaß haben auf dem Bauernhof, Danny«, sagte Dr. Norden. »Pferdchen, Kühe und Hühner, da wird es dir bestimmt nicht langweilig werden. Und wenn du ganz brav bist, wird auch bestimmt schönes Wetter sein.«
Und der Kleine strahlte. »Pferdis, Kuhlemuhle sind ganz doll«, freute er sich. »Und Mami ist immer da.«
Und das ist wohl doch das Allerbeste, dachte Dr. Norden, wenn die Mutter Zeit für ihr Kind hat.
*
Die Tage waren schnell dahingegangen. Der Donnerstag war angebrochen. Professor Tucker war früh auf den Beinen. Sabine hatte in dieser Nacht kaum ein Auge zugetan, und Manfred ließ es sich nicht anmerken, daß es ihm nicht viel anders ergangen war.
Sie hatten Axel und Kathrin nicht gesagt, daß Martina an diesem Tag operiert würde, aber die beiden Kleinen spürten was.
»Geht es Tina nicht gut?« fragte Axel ängstlich.
»Habt ihr schon mit dem Jonathan gesprochen?« fragte Kathrin.
Für sie war es auch schon der Jona-than. Sie mochten ihn.
»Schön wär’s, wenn wir solchen Opa hätten«, meinte Axel. »Warum haben wir eigentlich keinen?«
»Eine Omi wäre aber noch besser«, warf Kathrin ein. »Aber liebe Eltern sind doch am besten«, fügte sie rasch hinzu.
»Wir machen heute einen Ausflug«, sagte Manfred unvermittelt.
»Aber nicht zu weit«, sagte Sabine. Ihre Gedanken waren bei Martina. Manfreds auch, aber er wußte, daß es gar nichts einbringen würde, wenn sie hier herumsaßen und ständig auf die Uhr schauten.
»Und dann besuchen wir Tina«, warf Kathrin ein.
Martina hatte schon die Vornarkose bekommen. Professor Tucker stand neben ihrem fahrbaren Bett und hielt ihre Hand. Seltsam gleichmäßig war der Puls, viel besser als sonst.
»Jetzt wirst du schlafen, und wenn du aufwachst, haben wir alles überstanden«, sagte er leise.
»Dann ist es, als ob ich noch mal auf die Welt komme«, flüsterte Martina, »an einem Donnerstag.« Und dann sah Prof. Tucker, wie ihre Daumen sich zwischen Finger und Handfläche schoben und die kleinen Fäuste lagen ganz ruhig auf der Decke, als sich die Lider gesenkt hatten.
Sie drückte ihm die Daumen, und andere aus seinem Team warfen ihm aufmunternde Blicke zu.
Schwester Harriet legte ihm die Gesichtsmaske um. »Ich weiß, wie dir zumute ist, old John«, sagte sie leise. Sie waren schon viele Jahre Freunde, und sie hatten manche leidvolle Stunde gemeinsam durchlebt. Jeder lebte für sich allein, doch in solchen Augenblicken waren sie sich nah.
Die modernsten Apparate standen bereit und wurden nun eingeschaltet. Auf dem Bildschirm über dem Operationstisch konnte jeder jeden Handgriff von Professor Tucker verfolgen. Auf einem Band war der Herzschlag des Kindes abzulesen. Nur noch ein kurzes Zögern, dann setzte Jonathan Tucker das Skalpell an. Absolute Stille herrschte. Der Brustkorb des Kindes war freigelegt. Nun konnten auch die Assistenten sehen, was dieses kleine Kinderherz beengte.
Die Diagnose lautete: Intrakavitärer Tumor des Vorhofes, ein äußerst seltenes Krankheitsbild, aber Professor Tucker wußte längst, daß man auch vor solchen bösen Überraschungen nie sicher sein konnte.
Die Herz-Lungenmaschine wurde eingeschaltet. Nur mit dieser konnte diese Operation überhaupt durchgeführt werden, und zum ersten Mal war sie im Jahre 1954 angewandt worden, drei Jahre nach dem Herztod von Tuckers kleiner Tochter. Er warf einen kurzen, dankbaren Blick auf diese Maschine, die sieh bei ähnlichen Operationen nun schon so oft als lebensrettend erwiesen hatte, und die es ermöglichte, daß das Herz während der Operation selbst in seiner Tätigkeit ausgeschaltet wurde und der Kreislauf des Blutes dennoch aufrecht erhalten werden konnte.
Unendlich lange dauerte die Operation, doch Jonathan Tucker hatte jeden Zeitbegriff verloren. Er war konzentriert und gerade fanatisch in seiner Tätigkeit gefangen, denn unentwegt klang ihm Martinas Stimmchen in den Ohren: Ich drücke dir die Daumen.
Für Professor Tucker war es die bedeutendste Operation, die er in seinem Leben je ausgeführt hatte. Allerdings sollte diese später auch in die Geschichte der Medizin eingehen, als ihm und vielen anderen bewußt wurde, was er da durchgeführt hatte und was ihm gelungen war.
Ja, es war gelungen! Nach fünf Stunden konnte man es sagen. Nun kam es nur noch darauf an, wie der zarte Kinderkörper die Belastungen überstehen würde, wie groß der Lebenswille dieses kleinen Mädchens war.
*
Drei Stunden waren die Mainhards durch den Wald gewandert. Ein Bär war ihnen nicht begegnet, aber da auch Axel inzwischen wußte, wie gefährlich und aggressiv sie werden konnten, war er darauf wirklich nicht erpicht.
»Tina wird aber warten«, sagte Kathrin plötzlich.
»Sie wird doch operiert«, entfuhr es Sabine unbedacht, da sie gar nichts anderes denken konnte.
Die Kinder blieben stehen. »Heute schon? Warum habt ihr es nicht gesagt?« fragte Axel fast zornig. »Wir laufen hier herum, und Jonathan wird schwitzen.«
»Aber er macht unsere Tina gesund«, sagte Kathrin. »Er hat es mir versprochen.«
Und wenn es ihm nicht gelingt, dachte er, aber gleich schob er den Gedanken von sich. Es mußte einfach gelingen. Warum sonst war ihnen diese Chance für Tinas Leben zugespielt worden, warum war das Geld zur rechten Zeit gekommen, und warum hatten sie plötzlich so viel Hilfe von Dr. Norden und Dr. Cornelius gefunden und letztlich diese große Einsatzbereitschaft von Professor Tucker? Das alles konnte doch nicht umsonst gewesen sein!
»Ich will jetzt wirklich wissen, wie es Tina geht«, sagte Axel. »Wie lange dauert so eine Operation, Mami?«
»Das kann man vorher nie sagen«, erwiderte sie tonlos.
»Und was wird da überhaupt gemacht?« fragte Kathrin.
Daran wollten weder Manfred noch Sabine jetzt denken. Ohne wahnsinnige Angst konnten sie es sich gar nicht vorstellen, wie das Herz da freigelegt wurde und was damit geschah.
Axel preßte beide Hände auf die Stelle, wo sein Herz schlug.
»Richtig hören kann man, wie es klopft«, sagte er. Und schmerzhaft klopften auch die Herzen von Manfred und Sabine.
Ganz langsam gingen sie den Weg zurück. »Wir dürfen doch nicht gleich zu Tina«, sagte Sabine, als Axel immer wieder zur Eile drängte.
»Warum denn nicht?« fragte er.
»Wegen der Infektionsgefahr. Tina muß erst noch auf der Intensivstation liegen«, erklärte Manfred.
»Und was ist das?« fragte Kathrin.
»Da darf niemand zu ihr, außer den Ärzten und den Schwestern. Und wir dürfen sie nur durch das Fenster sehen.«
»Aber ich will meine Tina wenigstens durch das Fenster sehen«, murmelte Kathrin weinerlich.
»Heul jetzt nicht«, zischte Axel, »Mami und Papi regen sich eh schon auf.«
Eiskalt war Sabines Hand, als Manfred diese nun ergriff.
»Wir gehen erst nach Hause«, sagte sie leise zu den Kindern. »Ihr seid erhitzt und schmutzig.«
»Es ist aber nicht nach Hause«, sagte Kathrin jetzt ganz trotzig. »Bei uns ist es wirklich viel schöner, auch wenn wir keine moderne Küchen haben.«
Als sie dann, gewaschen und umgekleidet in der Klinik erschienen, war die Operation noch immer nicht beendet. Aber die Kinder stellten keine Fragen mehr. Kathrin lehnte sich an Sabines Schulter, Axel blätterte in einer Illustrierten. Manfred und Sabine sahen sich von Zeit zu Zeit an, Halt einander suchend.
Dann endlich kam Schwester Harriet. Ihr ergrautes Haar kräuselte sich feucht unter dem frischen Häubchen, das sie angelegt hatte.
»Die Operation ist gelungen, der Professor bleibt noch bei Tina«, sagte sie. »Sie gehen jetzt besser heim. Wir rufen Sie an, wenn Sie Tina sehen können.«
»Ich möchte hierbleiben«, sagte Sabine. »Geh du mit den Kindern heim, Manni.«
Er nahm die beiden bei den Händen. »Ich habe ein gutes Gefühl, Sabine«, sagte er leise, »ein ganz gutes.«
*
Harriet führte Sabine zum Schwesternzimmer. »Trinken Sie erst mal einen Tee, Mrs. Mainhard«, sagte sie.
»Sie sprechen sehr gut Deutsch, Schwester Harriet«, sagte Sabine geistesabwesend.
»War lange drüben nach dem Krieg. Hat mir gut gefallen. Jetzt sieht drüben aber alles schon besser aus, wie man so hört. Ist gut, wenn es keine so schrecklichen Kriege mehr gibt.«
»Meinen Sie, daß sie uns erspart bleiben?« fragte Sabine.
»So verrückt kann doch keiner mehr sein. Es gibt so genug Elend in der Welt. Aber jetzt entspannen Sie sich erst mal. Der Chef war großartig.«
»Es hat lange gedauert«, sagte Sabine leise.
»Ja, das ist nun mal so, da muß man ganz genau sein.«
Sie brühte den Tee auf und füllte eine Keksschale mit Gebäck. Dann lächelte sie mütterlich. »Ist ja so ein liebes Kindchen, die Tina, und so gescheit. Mir würde es direkt bange werden, wenn ich so ein kluges Kind hätte.«
»Haben Sie Kinder, Schwester Harriet?« fragte Sabine.
»Keine Zeit dafür gehabt, als ich jung war, und dann war ich zu alt. Nun ja, wie es einem bestimmt ist.«
Dann wurde sie schon gerufen, und Sabine blieb allein. Eine junge Schwester kam herein, nahm sich Tee und Plätzchen und musterte Sabine unfreundlich, aber das merkte Sabine nicht. Und endlich kam dann Professor Tucker.
»Haben Sie nichts zu tun, Schwester Judy?« fragte er die junge Krankenschwester ironisch.
Sie verschwand errötend. »Mit den jungen Dingern kann man nicht viel anfangen«, sagte er zu Sabine. »Sie wollen sich meist nur einen feschen jungen Arzt angeln, aber davon gibt es nicht viele.«
»Wie geht es Tina?« fragte Sabine flüsternd.
»Wir können zufrieden sein. Ja, ich bin recht zufrieden. Sie hat mir fest die Daumen gehalten.«
Er setzte sich auf die Schreibtischecke und sah Sabine durchdringend an. »Sie will leben, und sie wird leben, Mrs. Mainhard.«
Sabine sprang auf und umarmte ihn spontan. »Oh, ich bin so glücklich, so dankbar, lieber Professor Tucker«, stammelte sie. »Ich finde keine Worte. Wie können wir Ihnen nur danken?«
»Geben Sie mir die Möglichkeit, Tinas Lebensweg weiter zu verfolgen«, sagte er verhalten. »Ich liebe dieses Kind.«
»Professor Tucker zur Notaufnahme«, rief eine Stimme aus der Sprechanlage, und so wurde Sabine einer Antwort enthoben, jedoch nicht ihren Gedanken.
Sie ging langsam den Gang entlang, folgte dem Schild, das zur Intensivstation wies, doch da gebot ihr eine verschlossene Tür Halt.
Schwester Judy kam des Weges. »Zutritt verboten«, sagte sie schnippisch.
»Da liegt mein Kind«, flüsterte Sabine.
»Ach, die Kleine? Da brauchen Sie sich nicht kümmern, der Boß ist ja ganz verrückt mit ihr.«
Sabine drehte sich um und ging. Wie verschieden doch die Menschen sind, hier wie auch in der Heimat, dachte sie. Dann wanderte sie in dem Garten hin und her, bis es dunkel wurde. Sie ging wieder hinein. Schwester Harriet kam.
»Sie sind immer noch hier, Mrs. Mainhard? Gehen Sie doch nach Hause«, sagte sie freundlich.
»Kann ich Tina nicht wenigstens sehen?« fragte Sabine bittend.
»Na gut, einen Blick dürfen Sie auf ihr Bett werfen. Aber erschrecken Sie nicht vor den Schläuchen. Das muß sein.«
Da lag sie, die kleine Tina. Wie ein Baby kam sie Sabine vor, aber tapfer unterdrückte sie die Tränen.
»Es wird alles vergessen sein, wenn sie munter herumspringt«, sagte Schwester Harriet gutmütig. »Schlafen Sie sich aus, wir passen auf die Kleine auf. Für den Chef ist es allerdings ein anstrengender Tag. Zwei Herzinfarkte.«
»Wenn ich doch nur etwas tun könnte«, murmelte Sabine.
»Schlafen Sie«, sagte Schwester Harriet nochmals.
*
Es war still im Haus, als Sabine kam. Die Kinder saßen vor dem Fernsehapparat. Zu Hause hatten sie keinen, hier waren sie damit abzulenken.
»Ich habe Tina kurz sehen dürfen«, sagte Sabine mit erstickter Stimme, als Manfred sie in die Arme nahm. »Professor Tucker ist sehr zufrieden.«
»Wir müssen ihm sehr dankbar sein«, sagte Manfred.
»Er ist vernarrt in Tina«, fuhr Sabine schleppend fort.
»Was machst du dir für Gedanken, Liebes?« fragte er bestürzt.
»Er will sie uns wegnehmen.«
»Mein Gott, denk doch nicht so was. Deine Nerven sind überreizt, Liebes. Ich mache uns einen Glühwein. Es ist ganz schön kühl geworden.«
Sie lehnte sich in einen weichen Sessel zurück und schloß die Augen. Bilder kamen und gingen, und auch Victor huschte schnell an ihren Augen vorbei.
Dann läutete das Telefon, zum ersten Mal, seit sie hier waren, und es war ein fremdes, erschreckendes Geräusch.
Sabine sprang auf, aber Manfred nahm schon den Hörer ab.
»Dr. Norden!« rief er fassungslos aus. »Woher wissen Sie die Nummer?«
»Von der Klinik«, tönte Dr. Nordens Stimme durch den Draht. »Wir haben gehört, daß die Operation geglückt ist und freuen uns mit Ihnen. Und wir freuen uns auf das Wiedersehen.«
Es war ein kurzes Gespräch, aber es sagte ihnen, daß auch in der Heimat an sie gedacht wurde. Sabines müde Augen leuchteten auf.
»Wir haben Freunde, Manni«, flüsterte sie.
Er nahm sie in die Arme und streichelte ihren Rücken. »Es wird alles besser werden, Liebste, alles. Ich habe plötzlich so viele Ideen.«
»Dann schreib doch«, sagte sie. »Hier ist das Papier billiger als bei uns.«
*
»Mainhard ist nicht zu erreichen«, sagte Jochen Burger unwillig.
»Warum liegt dir so viel daran?« fragte seine Frau Gundula.
»Ich will seinen Roman so bald wie möglich herausbringen, aber er soll eine Fortsetzung schreiben. Das wird ein Knüller, Gundi, und ich kann Onkel Franz beweisen, daß ich einen guten Riecher habe.«
»Was mußt du Onkel Franz schon beweisen«, sagte sie leichthin. »Er kann doch nichts mitnehmen. Gib mir mal das Manuskript.«
Seine Augen verengten sich. »Es könnte nicht schaden, wenn du es liest«, sagte er mit einem seltsamen Unterton.
»Also dreht es sich um eine Frau, um die ideale Frau«, stellte sie mit spöttisch gekräuselten Lippen fest. »Aber es kommt immer darauf an, mit welchen Augen man solche Frauen sieht. Manche können sich ja wirklich mit einem Heiligenschein umgeben.«
»Mami, kommst du?« ertönte ein bittendes Stimmchen, und schon eilte Gundula hinaus, zum Kinderzimmer, das eigentlich das schönste im ganzen Haus war.
Zwei viel zu kurze Ärmchen streckten sich ihr entgegen, aber Gundula sah nur das süße Gesicht des kleinen Mädchens.
»Kann meine Evi wieder mal nicht einschlafen?« fragte sie zärtlich.
»Du hast mir noch keine Geschichte erzählt, Mami, und du kannst so schöne Geschichten erzählen. Viel schönere, als in den Büchern stehen. Warum druckt Papi sie nicht?«
»Weil sie nur uns gehören, Evi«, sagte Gundula, »dir und mir.«
»Aber ich hätte es gern, wenn auch andere Kinder so schöne Geschichten lesen könnten, Mami. Ich denke mir auch selbst welche aus, aber leider kann ich so schlecht schreiben.«
Gundula schluckte den quälenden Schmerz hinunter, als sie auf die verkrüppelten Händchen blickte.
»Nun, du könntest sie dem Tonband erzählen, mein Liebling«, sagte sie. »Ich stelle es dir ins Zimmer und zeige dir, wie man es bedient. Das kannst du bald. Du kannst so viel, Evi. Es kommt doch gar nicht so sehr darauf an, was Hände vollbringen können, wenn man einen klugen Kopf hat und ein großes Herz.«
»Du bist die allerliebste Mami von der ganzen Welt«, sagte die Kleine. »Ich möchte nur ganz gern auch so hübsch sein wie du.«
»Du bist viel hübscher, Evi. Und nun leg dich hin. Ich erzähle dir eine Geschichte.«
Ganz weich war ihre Stimme. So weich war sie nie, wenn sie mit ihrem Mann sprach, und zum ersten Mal wurde sich Jochen Burger dessen bewußt, weil er an der Tür lauschte, die Gundula in der Eile nicht fest ins Schloß gezogen hatte. Und er stand noch da, als sie herauskam.
Sie lehnte sich an die Wand. »Evi schläft«, sagte sie tonlos. »Was machst du hier?«
»Ich habe gelauscht, Gundi. Und jetzt weiß ich, warum du keine Kinder mehr haben willst«, sagte er heiser.
»Warum wohl nicht?« fragte sie sarkastisch.
»Weil sie sich nicht zurückgesetzt fühlen soll.«
Er streckte die Hände nach ihren aus und zog diese an seine Brust. »Ich liebe dich doch, Gundi, und ich liebe Evi, willst du das nicht begreifen?«
»Ich bin schuld, daß sie nicht vollkommen ist«, schluchzte sie auf. »Ich habe die Tabletten genommen, ich hätte es nicht tun dürfen. Mein Gott, warum konnte ich diese lächerlichen Schmerzen nicht ertragen. Warum muß das Kind ein Leben lang darunter leiden?«
»Du bist nicht schuld, Liebste, du nicht. Der Arzt hat dir die Tabletten verschrieben. Und schuld sind nur die, die sie auf den Markt gebracht haben. Wir lieben unser Kind dennoch, Gundi. Andere Eltern haben ganz andere Sorgen um ihre Kinder. Schau, es ist ja nicht so, daß ich Mainhards Buch so schnell auf den Markt bringen will, weil ich es gut finde. Er hat ein schwer herzkrankes Kind, das operiert werden muß und dafür braucht er viel Geld.«
»Und warum gibst du es ihm nicht, Jochen?«
»Das kann ich nicht, wenn Onkel Franz nein sagt, und er will für sein Geld etwas haben. Er verschenkt nichts. Er will verdienen.«
»Gib mir das Manuskript. Ich will es lesen.«
Er holte es. Gundi gab ihm einen Kuß. »Ich weiß jetzt, daß wir doch zusammengehören«, sagte sie leise.
»Erst jetzt?« fragte er bestürzt.
»Weil du begriffen hast, wie sehr uns Evi braucht.«
*
Sie las bis tief in die Nacht hinein, und bevor ihr fast die Augen von selbst zufielen, blätterte sie noch einmal zurück bis zu der Stelle, die da lautete: Ich wußte, daß das Leben des Kindes an einem hauchdünnen Faden hing, aber ich wollte, daß es am Leben bleibt, um jeden Preis, denn es hatte uns zusammengeführt.
Als Jochen am Morgen aus seinem Zimmer kam, war Gundula dabei, ihr kostbares Meißner Porzellan einzupacken, das sie von ihrer Großmutter geerbt hatte.
»Was machst du?« fragte er erschrocken.
»Ich werde es verkaufen«, erwiderte sie.
»Warum?«
»Damit das Kind operiert werden kann. Es ist doch eine wahre Geschichte, Jochen. Wir benutzen das Geschirr sowieso nicht, Evi kann es gar nicht anfassen. Und wenn es nicht so viel bringt, gebe ich die goldenen Kuchenbestecke dazu. Die brauchen wir auch nicht. Onkel Franz schwingt doch nur ganz schwülstige Reden, wenn du ihn um ein Voraushonorar angehst.«
»Warte doch erst mal ab, Gundi«, sagte Jochen.
Sie legte den Kopf zurück. »Wieviel Jahre haben sie um das Leben des Kindes gebangt?« fragte sie.
»Mainhard sagte etwas von zwölf Jahren.«
»Und jetzt könnte ihm geholfen werden. Unser Kind ist organisch völlig gesund, und Evi können wir nur mit sehr viel Liebe und Verständnis helfen. Hilfst du mir ein bißchen, Jochen?«
Er griff nach ihren Schultern und zog sie empor. »Du bist wundervoll, Gundi«, sagte er, »aber jetzt laß das mal. Ich bringe das schon in Ordnung. Ich fahre nachher zu Mainhard. Vielleicht nimmt er das Telefon nur nicht ab, weil er eine Absage fürchtet. Er ist einer von denen, die sich nicht verkaufen können.«
»Das brauchst du nicht zu betonen. Ich habe sein Buch gelesen. Es drückt so viel Hoffnung aus, daß ich Angst habe, eine Fortsetzung könnte nur traurig sein.«
»Jetzt laß mal das Geschirr. Ich spreche mit Onkel Franz.« Er hob lauschend den Kopf. »Evi ruft. Ich gehe zu ihr.«
Ein weiches Lächeln glitt über Gundis Gesicht, als er hinauseilte.
»Du, Papi?« fragte Evi staunend. »Fühlt Mami sich nicht wohl?« fragte sie aber gleich ängstlich.
»Sie hat nur gerade was zu tun, und warum soll ich dir nicht auch mal beim Waschen helfen?«
»Du bist doch ein Mann«, sagte Evi.
»Und du meinst, ich kann das nicht? Probieren wir es doch einmal, Spätzchen.«
»Hast du denn Zeit?«
»Ich nehme sie mir.«
Es war seltsam, aber plötzlich war die Scheu wie weggeblasen, die ihn befangen gemacht hatte, wenn er das Kind in die Arme nahm. Sie lächelte zu ihm empor. Niedliche Grübchen bildeten sich in ihren Wangen.
Hatte er dazu erst Manfred Mainhard kennenlernen müssen, um auch mit seiner Frau offen sprechen zu können, um ihre wahren Empfindungen zu erkennen?
»Gell, du hast mich auch lieb«, sagte Evi.
»Sehr, mein Liebling.«
*
Jochen hatte sich dann doch entschlossen, zuerst zu seinem Onkel zu fahren. Franz Burger lebte in einer schönen alten Villa vor den Toren der Stadt, und es war kein großer Umweg für Jochen, wenn er später Manfred Mainhard aufsuchen wollte.
Franz Burger lebte in seiner eigenen Welt, in der alles seinen Platz hatte, alles seinen Vorstellungen entsprach.
Unangemeldete Besuche liebte er gar nicht, aber Jochen wurde dennoch überraschend freundlich empfangen.
»Was gibt es?« fragte der alte Herr. »Wegen einer Lappalie kommst du doch nicht eigens zu mir heraus.«
Jochen trug sein Anliegen zögernd vor, aber ohne Umschweife.
»Wir sind kein Wohltätigkeitsinstitut, Jochen«, sagte Franz Burger, »aber wenn die Geschichte gut ist, steht einem Ankauf nichts im Wege.«
Jochen sah den Älteren überrascht an. Er hatte mit heftigem Widerspruch gerechnet.
»Ihr haltet mich anscheinend für einen hartherzigen Geizkragen«, sagte Franz Burger. »Nun, ich habe meine Prinzipien, aber herzlos bin ich nicht. Es läßt mich doch auch nicht ungerührt, welches Schicksal die kleine Evi tragen muß.«
»Sie ist dennoch ein ganz fröhliches Kind«, sagte Jochen. »Es gibt Schlimmeres. Geistig behinderte Kinder bilden eine schwerere Prüfung für ihre Eltern.«
»Ihr habt euch mehr Kinder gewünscht«, sagte der alte Herr.
»Darüber wollen wir nicht sprechen, Onkel Franz. Gundi hat ihre Entscheidung getroffen. Sie war ganz spontan bereit, sich von dem Meißner Porzellan zu trennen, um Mainhard zu helfen.«
»Wie du ihn mir geschildert hast, halte ich es für besser, er wird für eine gute Arbeit bezahlt. Laß mir das Manuskript hier. Die Entscheidung darüber hast du ja schon getroffen. Ich gebe meine Zustimmung.«
»Ich danke dir«, sagte Jochen.
Der alte Herr lächelte flüchtig. »Das Risiko trägst du, Jochen. Immerhin kann es auch ein glänzendes Geschäft für dich werden.«
»Für den Verlag«, sagte Jochen.
»Wir werden eine Einigung treffen. Ich hoffe, daß sich unsere privaten Kontakte ausdehnen.«
»Wenn du es wünschst, Onkel Franz?«
»An mir sollte es wahrhaftig nicht liegen. Ich würde mich gern mit Evi beschäftigen, wenn ihr damit einverstanden seid.«
Eine Überraschung jagte die andere. Sehr nachdenklich verabschiedete sich Jochen von seinem Onkel. Eine enttäuschende Überraschung war es jedoch, daß er dann vor Mainhards verschlossenem Haus stand.
Eine Nachbarin kam vorbeigeradelt.
»Die Mainhards san net da«, sagte sie. »Die sind in Kanada mit Tina.«
»Danke für die Auskunft«, erwiderte Jochen.
»Die ganze Familie ist gefahren. Muß eine Stange Geld kosten.«
Die Frau war mitteilsam, aber Jochen wollte sich auf kein Gespräch einlassen. Irgendwie schien Manfred Mainhard also das Geld ganz schnell beschafft zu haben. Es war für ihn anscheinend nicht mehr dringlich, daß der Roman schnell angekauft wurde.
Nun wußte er aber, wo Mainhard lebte und schrieb. Das Haus gefiel ihm. Vielleicht wäre es auch für Evi besser, wenn wir mehr auf dem Lande leben würden, dachte er. Aber würde man sie dann hier nicht noch mehr zur Kenntnis nehmen, bemitleiden oder gar verspotten. Kinder konnten grausam sein. Aber Jochen Burger konnte sich nicht vorstellen, daß Manfred Mainhards Kinder grausam sein konnten.
Ja, Evi sollte Spielgefährten haben, nicht ganz so abgeschirmt werden. Wenn es die richtigen waren, konnte es nur förderlich für sie sein. Ein Kind wie Martina Mainhard, das selbst soviel durchgemacht hatte, könnte Evi vielleicht eine Freundin werden. Seltsam, wie sehr er sich in Gedanken schon in diese Familie hineingelebt hatte, wieviel Kraft er für sich selbst aus den geschriebenen Empfindungen dieses Mannes geschöpft hatte.
*
Manfred dachte nicht an seinen Roman, der ja eigentlich kein Roman war. Sein ganzes Denken gehörte nur Tina, die nun die schwersten Tage überstanden hatte. Ein paar kritische Situationen hatte es schon gegeben, doch von diesen hatten sie erst nachträglich von Professor Tucker erfahren.
Martina mußte noch auf der Inten-sivstation bleiben, aber sie konnten sie sehen und durch das Fenster mit ihr sprechen. Sie lächelte, sie winkte ihnen zu. Die Schläuche waren entfernt worden. Sie bekam noch ihre Infusionen, aber so beängstigend blaß sah sie schon nicht mehr aus.
Axel und Kathrin meinten, daß es ihr doch schrecklich langweilig sein müsse, wenn sie nicht mal lesen könne, aber die meiste Zeit schlief sie ja noch.
Axel und Kathrin hatten Spielgefährten gefunden. Sie verständigten sich mit Händen und Füßen, aber sie vertrugen sich recht gut. Sie lernten englisch, die neuen Freunde deutsch, und es ging meist recht lustig zu.
Manfred und Sabine litten nun auch nicht mehr an Langeweile. Sie hatten Papier gekauft, und Professor Tucker hatte ihnen eine Schreibmaschine besorgt. Überhaupt tat er alles, um ihnen gefällig zu sein, doch Sabine beneidete ihn, weil er viel mehr Zeit bei Tina verbringen konnte als sie selbst.
Ihr mütterlicher Instinkt sagte ihr, daß Tina dem Professor eine innige Zuneigung entgegenbrachte. Er hatte ihr ein neues Leben geschenkt, schenkte sie ihm dafür nun ihr ganzes Herz?
»Denk doch nicht so was, Sabine«, sagte Manfred, wenn sie diese Gedanken äußerte. »Er will sie uns doch nicht wegnehmen.«
»Doch, das möchte er am liebsten. Er hat es ja schon gesagt.«
»Es ist so ein Wunschgedanke, der keine Wurzeln hat. Es ist doch ein großes Glück für uns und vor allem für Tina, an einen solchen Arzt geraten zu sein, der mit seinen Operationen nicht nur Lorbeeren ernten will, sondern so menschlich ist. Tina hat einen gütigen Freund gewonnen, und wir sollten dafür dankbar sein.«
Für Tina waren es freilich die schönsten Stunden, wenn Jonathan Tucker neben ihrem Bett saß. Dann wurde sie nicht müde, ihm zu lauschen. Was er so alles zu erzählen wußte! Weit war er in der Welt herumgekommen, bis er hier Fuß gefaßt hatte.
»Und warum bist du ausgerechnet hier geblieben, Jonathan?« fragte sie.
»Weil man mir hier die Möglichkeit gab, all das zu verwirklichen, was mir vorschwebte.«
»Und nun willst du immer hierbleiben?« fragte sie sinnend.
»Nun bin ich schon ein alter Herr, Tina, und es ist Zeit, daran zu denken, von Jüngeren abgelöst zu werden.«
»Du bist aber noch nicht alt«, widersprach sie.
»Du siehst mich mit ein wenig verklärten Augen«, meinte er schmunzelnd, »und der Bart verdeckt so manche Falten.«
»Aber deine Augen sind jung und deine Stimme«, sagte Tina, »und es gibt ganz bestimmt keinen so guten Arzt wie dich auf der Welt. Wenn ich erwachsen bin und Ärztin, möchte ich gerne hier bei dir arbeiten.«
Gerührt betrachtete er sie. »Bis dahin wird noch viel Zeit vergehen, kleine Tina. Und selbst wenn du sehr fleißig bist, werde ich dann schon an die achtzig Jahre sein.« Und vielleicht lebe ich dann gar nicht mehr, dachte er, aber rasch lenkte er sich ab. »Aber was würdest du sagen, wenn ich nach Deutschland kommen würde? Da hat ein guter, alter Freund ein wunderschönes Sanatorium, das ich schon lange einmal kennenlernen wollte. Und da könntest du dich ganz gut erholen. Insel der Hoffnung, heißt es, gefällt dir das?«
»Sehr gut«, nickte sie. »Und da willst du hin?«
»Mit dir, damit wir noch ein bißchen zusammenbleiben können.«
»Das wäre ganz wunderschön«, sagte Tina mit verklärten Augen. »Versetzt werde ich ja bestimmt, wenn ich jetzt auch viel versäume, und dann kommen die Sommerferien, da kann ich ja auch viel nachholen. Bei uns daheim ist es auch schön. Kann ich bald aufstehen, Jonathan?«
»In ein paar Tagen, und dann machen wir einen kleinen Spaziergang.«
»Dürfen sich Mami und Papi jetzt auch bald an mein Bett setzen?«
»Bald, Tina.«
»Wenn ich dich nicht hätte, wäre ich schon sehr traurig, daß ich sie immer nur durch das Fenster sehen kann. Sie sind so lieb, Jonathan.«
»Ja, das weiß ich, mein Kleines.« Doch, was er sonst dachte, behielt er für sich. Wenn Tina nämlich nicht so fürsorgliche Eltern gehabt hätte, würde dieses Kind schon lange nicht mehr leben.
*
Am Abend sagte er es Tinas Eltern. Er war zu ihnen gefahren, um ihnen zu sagen, daß sie Tina morgen kurz besuchen dürften.
Er hatte seinen Besuch telefonisch angekündigt. Sabine hatte schnell ein gutes Essen zubereitet, dem Jonathan Tucker nicht widerstehen konnte, obgleich er schon in der Klinik gegessen hatte.
»Ich will ja nicht sagen, daß unser Klinikessen schlecht ist«, meinte er schmunzelnd, »aber das ist doch etwas anderes.«
»Essen Sie immer in der Klinik?« fragte Sabine.
»Meistens, manchmal auch im Restaurant, wenn ich mal besondere Gelüste verspüre, aber das geschieht höchst selten. Ich habe ja niemanden, der für mich kocht.«
»Sie haben keine Familie?« fragte Manfred.
»Ich bin der übriggebliebene Sohn längst verstorbener Eltern«, erwiderte er, »immerhin bereits vierundsechzig Jahre alt.«
»Das hätte ich nicht gedacht«, sagte Sabine. »Sie sind noch so frisch und munter.«
»Man hört es gern, aber manchmal täuscht es und man täuscht sich auch selbst. Nun, um ein wenig mehr von mir zu erzählen, dürfen Sie ruhig wissen, daß ich früher mal verheiratet war. Es ist lange her. Wir hatten auch eine kleine Tochter, die ich abgöttisch liebte. Sie war auch herzkrank, aber es gab keine Möglichkeit, ihr zu helfen. Meine Ehe zerbrach darüber. Meine Frau heiratete einen Chefingenieur. Wenn Maschinen kaputt sind, verkraftet man das wohl eher. Ich bin sehr froh, daß es uns heute möglich ist, Herzkranken zu helfen, und besonders froh bin ich, daß wir Tina helfen konnten, daß ich es noch erleben kann, daß wir diesbezüglich solche Fortschritte machen. Wenigstens auf diesem Gebiet sind Erfolge erzielt worden. Aber wenn Tina nicht so be-
hütet worden wäre, wenn ihr aus inniger Liebe und Fürsorge nicht so viel Kraft zugeflossen wäre, hätte ihr solche Hilfe auch nicht zuteil werden können.«
»Tina war immer ein sehr einsichtiges Kind, und sie wußte wohl auch am besten, was ihr schaden mußte«, sagte Manfred.
»Die meisten Kinder verlieren den Lebenswillen, wenn ihnen zu wenig Liebe und Verständnis entgegengebracht wird«, sagte Jonathan Tucker. »Ich habe es leider oft genug erleben müssen. Wenn eine Seele getötet wird, resigniert der Kranke.«
Darauf herrschte ein längeres Schweigen. Sabine war in die Küche gegangen, um noch einen Kaffee zuzubereiten.
»Wie wäre es mit einem Brandy?« fragte Manfred.
»Keinen Widerspruch«, lächelte Professor Tucker. »Es duftet ja auch schon nach Kaffee. Ich beneide Sie.«
»Es ist schade, daß wir räumlich so weit voneinander entfernt sein werden, aber wir werden doch hoffentlich in Verbindung bleiben«, sagte Manfred.
Sabine kam mit dem Kaffee herein. »Ich wollte Ihnen einen Vorschlag unterbreiten«, sagte Jonathan Tucker.
»Sagen Sie bitte nicht, daß Sie Tina hierbehalten wollen«, flüsterte Sabine.
»Ich will doch nicht, daß das Kind unglücklich wird«, gab er zurück. »O nein, das dürfen Sie nicht denken, Sabine. Ich möchte noch mit ihr beisammen sein, aber nicht hier. Ich möchte sie mitnehmen auf die Insel der Hoffnung. Sie wissen doch, daß Dr. Nordens Schwiegervater dort Chefarzt ist. Wir sind gute alte Bekannte. Wir haben uns lange nicht gesehen, und ich habe Sehnsucht nach dem guten alten Europa und einem Gedankenaustausch mit, alten Freunden. Und für Tinas Regeneration wäre eine anschließende Kur sehr gut.« Er sah Sabine bittend und ein wenig traurig an. »Ich will sie Ihnen doch nicht wegnehmen, ich möchte sie nur noch eine Weile um mich haben. Ist dies zuviel verlangt?«
»Nein«, erwiderte Manfred rasch, und Sabine schüttelte nun beschämt den Kopf.
»Sie haben so unendlich viel für Tina getan«, flüsterte sie, »es ist ungerecht, wenn ich eifersüchtig bin.«
»Eifersüchtig?« fragte Jonathan betroffen.
»Bisher gehörte Tina doch nur uns.«
»Weil sie wußte, daß sie bei Ihnen geborgen ist«, sagte Jonathan ernst. »Aber es wird nicht so bleiben, und es würde sie doch nur in ihrer Weiterentwicklung einengen. Das müssen Sie begreifen, Sabine. Sie hat vieles zurückstecken, auf vieles verzichten müssen, was anderen Kindern selbstverständlich ist. Ihnen ist es zu danken, daß sie sich nie in die Ecke gestellt fühlen mußte. Und das hat doch weit mehr dazu beigetragen, daß sie überlebt hat als alle Medikamente. Nun wird sie Schritt für Schritt ein anderes Leben kennenlernen, langsam und bedächtig zwar, aber doch mit der Gewißheit, daß sie eines Tages springen und tanzen kann. Sie wird jung sein unter jungen Menschen und doch irgendwie schon so weise, daß sie den Gefahren ausweichen kann, die dieses Leben mit sich bringt, ohne daß man sie davor behüten muß. So wird sie an allem teilnehmen können, ihren Geschwistern und sicher auch anderen ein Vorbild sein und vielen helfen können, die ärmer dran sind, so, wie sie es will.«
»Wie sie es will? Meinen Sie, daß sie schon genau weiß, was sie will?« fragte Sabine stockend.
»Sie will Ärztin werden, und ich bin überzeugt, daß sie eine gute Ärztin wird. Sie bringt alles dafür mit, sogar schon Erfahrung, was leiden bedeutet. Sie ist ein ganz wunderbares kleines Mädchen. Ich weiß nicht, ob ich den Mut gehabt hätte, diese Operation auszuführen, wenn sie ihn mir nicht gemacht hätte, so voller Vertrauen mit einem so festen Glauben.«
»So schlimm war es«, murmelte Sabine mit erstickter Stimme.
»Ja, so schlimm. Und in meiner langen Praxis hatte ich bisher nicht einen vergleichbaren Fall, aber ich hatte auch noch keine so mutige Patientin. Sie verstehen, daß Tina etwas Besonderes in meinem Leben ist, ich möchte sagen, ein Dank für viele mühsame Jahre. Und ich kann Sie nur bitten, es mir zu vergönnen, daß ich auch einen Platz in ihrem Herzen einnehmen darf.«
Und so fand dieser Abend einen wundervollen Abschluß, auch für Sabine. Sie reichte Jonathan beide Hände, und er zog diese an seine Lippen.
»Lieber Professor Tucker…«, weiter kam Sabine nicht. »Ach was, sagt doch auch Jonathan«, fiel er ihr ins Wort. Aber dann verabschiedete er sich rasch, als Sabine ihn umarmte und auf die Wange küßte. Tränen der Rührung wollte er nicht zeigen.
*
Ganz glücklich war Sabine, als sie endlich die Hände ihres Kindes halten konnte. Am Vormittag war ihr ein halbes Stündchen gestattet, am Nachmittag sollte es dann Manfred vergönnt sein.
Durch die Desinfektionsschleuse mußten sie gehen, einen sterilen Kittel anziehen und ihr Haar unter einer Haube verstecken, aber sie konnte Tina nahe sein. Sie konnte in die strahlenden Augen des Kindes blicken. Ja, sie strahlten hell und froh.
»Jetzt werde ich ganz gesund, Mami, ist das nicht herrlich?« sagte Tina voller Freude. »Vielleicht wachse ich jetzt auch ein bißchen schneller.«
»Nicht gar zu schnell, Kleines. Dafür bleibt dir noch lange Zeit.«
»Jonathan war heute morgen schon bei mir und hat mir erzählt, daß er einen schönen Abend mit euch verbracht hat und daß du so gut kochen kannst.«
»Und hat er dir auch erzählt, daß er mit dir zur Insel der Hoffnung fahren will?« fragte Sabine.
Da stieg tatsächlich das Blut in Tinas blasse Wangen. »Würdet ihr es denn erlauben?« fragte sie leise.
»Wenn du es willst, warum sollten wir es dann nicht erlauben, Kleines?«
»Ihr sollt doch nicht denken, daß ich Jonathan jetzt lieber habe als euch. Aber ich muß ihn liebhaben, Mami. Das verstehst du doch?«
»Ja, das verstehe ich.« Jetzt sagte sie es ohne zu zögern.
»Er hat doch auch niemanden. Weißt du, er hätte sehr gern eine Familie, wenn er es auch nicht zugibt. Immer nur im Krankenhaus sein und operieren, das ist doch sehr schwer, wenn niemand zu Hause wartet, mit dem er reden kann. Und hier kennt er eigentlich nur Schwester Harriet richtig. Die anderen haben ja Familie.«
Sie machte sich ihre Gedanken, die kleine Tina, und Sabine fühlte wieder, wie sehr sie nach innen gelebt hatte. Und war es ihr nicht erst richtig durch Jonathans Worte klargeworden, wieviel Größe dieses kleine Geschöpf bewiesen hatte in seinem Leiden?
Sie hatten gebangt um Tinas Leben, sie hatten gefürchtet, daß es dann doch plötzlich aus sein könnte, aber Tina selbst hatte nie ein Wort der Klage oder der Angst geäußert.
»Fühl mal, wie mein Herz schlägt, Mami«, sagte sie. »Das ist jetzt schon ganz anders als früher. Jonathan hat gesagt, daß da so eine harte Nuß gewesen ist, die immer mitgewachsen ist, wenn ich gewachsen bin. Eigentlich kann ich sehr froh sein, daß ich nicht schnell gewachsen bin.« Jetzt lachte sie sogar, und auch Sabine lächelte, obgleich es ihr gar nicht danach zumute war.
»Nun darf ich auch bald spazierengehen, und dann brauche ich auch nicht mehr auf der Intensivstation zu liegen. Dann können mich auch Axel und Kathrin besuchen.«
»Immer langsam, mein Schatz«, sagte Sabine.
Von Axel und Kathrin mußte dann am Nachmittag Manfred erzählen, Tina freute sich, daß ihre Geschwister nun auch schon englisch lernten.
»Da müssen wir immer fleißig üben, damit sie es nicht wieder vergessen«, sagte Tina. »Aber Jonathan sagt, was man in früher Jugend lernt, bleibt viel mehr haften. Wir können über alles reden, aber er braucht nicht zu wissen, daß du erst später mein Papi geworden bist. Ich will keinen anderen haben als dich.«
»Ich bin darüber sehr glücklich, Tina«, sagte er.
»Erzählst du mir mal genau, wie du Mami kennengelernt hast?«
»Wenn du es so genau wissen willst?« sagte er lächelnd.
»Ich möchte immer alles ganz genau wissen. Wenn ich erst aufstehen kann, erklärt mir Jonathan auch genau, wie die Operation verlaufen ist.«
»Ist dir das nicht ein bißchen unheimlich, Tina?«
»Ich lebe ja«, sagte sie vergnügt. »Und wenn ich mal Ärztin bin, kann ich schon mitreden.«
»Du hast ja schon große Pläne im Sinn.«
»Ja, schon lange. Jetzt erzählst du mir, wie du Mami kennengelernt hast.«
Und Manfred erzählte. Tina lauschte ganz andächtig.
»Und da hast du gleich gewollt, daß sie deine Frau wird«, sagte sie nachdenklich.
»Ich schon, aber ich wußte nicht, was sie davon halten würde, Tina. Weißt du, ich habe gar nicht viel verdient und konnte ihr nichts bieten.«
»Das ist doch egal. Du mußt dir mal die Eltern von meiner Klasse anschauen. Die, die das meiste Geld haben, streiten auch am meisten, und die Kinder sind gar nicht gern zu Hause. Daher kommt es nämlich, daß sie ausrücken oder in schlechte Gesellschaft geraten oder Drogen nehmen. Die fangen früh damit an.«
»Davon hast du nie gesprochen, Tina«, sagte Manfred erschrocken.
»Wozu auch, bei uns ist es doch anders, und meine Geschwister kläre ich schon beizeiten auf, Papi, darauf kannst du dich verlassen. Aber du brauchst dir gar keine Gedanken zu machen. Kinder, die ihre Eltern richtig liebhaben, tun so was nicht. Und ihr habt ja Zeit für uns, anstatt uns Geld zu geben, so als Ausgleich.«
»Du blickst durch, Tina«, sagte Manfred ernst. »Hast du auch schon mal über behinderte Kinder nachgedacht?«
»Natürlich, ich war ja auch behindert, nur hat man es mir nicht so angesehen wie anderen. Am allerschlimmsten finde ich es, wenn Kinder geistig behindert sind.«
»Und diejenigen, die körperlich behindert sind, sind nicht so schlimm dran? Blinde und Taube zum Beispiel?«
»Wenn man denken kann, dann kann man sich beschäftigen. Alles ist irgendwie schlimm, wenn man von Geburt an so ist und gar nicht begreifen kann, daß man anders ist als andere.«
Da kam Schwester Harriet herein. Sie lächelte freundlich, sagte aber doch recht bestimmt, daß die halbe Stunde längst um sei.
»Aber ich habe gerade ein interessantes Thema mit Papi«, sagte Tina.
»Morgen ist auch noch ein Tag«, sagte Schwester Harriet, »und es kommen noch viele, Tina.«
»Dann werde ich wieder nachdenken und morgen weiter mit dir reden, Papi«, sagte Tina. »Jetzt werde ich nicht mehr so schnell müde, und Jonathan wird es schon erlauben, daß ihr länger bei mir bleiben könnt. Weißt du, was ich mir wünsche?«
»Sag es.«
»Schreib doch auch mal eine Geschichte für Kinder. Nicht so einen Quatsch wie in den Comics, sondern was aus dem wirklichen Leben.«
»Ich werde darüber nachdenken, Tina.« Dann streichelte er ihre kleinen blassen Hände. Mehr war nicht gestattet, aber sehnsüchtig wartete er auf den Tag, wo er sie wieder in die Arme nehmen konnte.
Und als er die Klinik verließ, dachte er zum ersten Mal an Jochen Burger, an jenes Gespräch, das sie geführt hatten, an dessen Kind.
*
»Na, was hast du erreicht?« fragte Gundi, als ihr Mann heimkam.
»Mainhard ist mit seiner Familie schon in Kanada«, erwiderte er.
»Dann brauchst du das Buch nicht aus Mitleid drucken zu lassen. Das ist gut«, sagte sie ruhig. »Vielleicht will er jetzt gar nicht mehr, daß es gedruckt wird.«
»Wie meinst du das?«
»Nun, wenn das Kind operiert wird und die Operation glückt, wird es den Betroffenen wohl nicht recht sein, wenn die Vorgeschichte publik wird. Und sollte die Operation nicht glücken, würde sie alles aufwühlen. Du solltest mit ihm noch darüber sprechen. Was hat denn Onkel Franz gesagt?«
»Wir sollten unsere persönlichen Kontakte mehr pflegen, und er würde sich gern mit Evi beschäftigen.«
»Das kann doch nicht wahr sein!« staunte Gundi.
»Wir haben ihn wohl doch verkannt, Gundi«, sagte Jochen. »Er kann nicht in eine andere Haut schlüpfen. Er kann aus seiner Welt nicht heraus, aber er möchte uns in diese einbeziehen.«
Sie sah ihn schweigend an. »Nun, dieser Mainhard scheint uns in mancher Hinsicht die Augen geöffnet zu haben, Jochen«, sagte sie gedankenvoll.
»Ja«, erwiderte er schlicht. Dann nahm er sie in die Arme. »Wir werden unser Leben anders gestalten, Gundi. Wir werden Evi einbeziehen in dieses Leben und sie nicht als bemitleidenswertes Geschöpf betrachten. Und du wirst deine Schuldgefühle bewältigen, nicht nur verdrängen. Wir werden für Evi Spielgefährten suchen, die in einer ähnlichen Situation sind.«
»Ich kann nur noch staunen«, sagte Gundi.
»Man muß manchmal einen Schubs bekommen, mein Liebes. Du hast ihn mir nicht gegeben.«
»Ich hätte wohl auch einen gebraucht«, sagte sie offen. »Aber wir haben nun lange genug aneinander vorbeigeredet. Jetzt fühle ich mich woh-ler.«
»Ich auch. Und am Wochenende besuchen wir Onkel Franz.«
*
Das Wochenende brachte schlechtes Wetter, dennoch fuhren die Nordens zur Insel der Hoffnung, überzeugt, daß es da zumindest nicht regnen würde. Und sie sollten nicht enttäuscht werden. Der Himmel wurde immer heller, je näher sie der Insel kamen.
»Weil da nur brave Menschen sind«, sagte Anneka eifrig.
»Man möchte es fast meinen«, lachte Fee. Und groß war die Freude des Wiedersehens. Dr. Johannes Cornelius konnte auch gleich mit einer freudigen Nachricht aufwarten.
»Um Mitternacht hat mich der gute Tucker aus dem Schlaf gerissen«, berichtete er heiter. »Er hat nicht daran gedacht, daß bei uns Schlafenszeit ist. Er will mit Tina ein paar Wochen bei uns verbringen. Was sagt ihr nun?«
»Daß es mich freut, wenn ich ihn kennenlerne«, sagte Daniel.
»Ich bin auch gespannt, Paps«, schloß Fee sich an.
»Wer ist Tucker?« fragte Danny.
»Ein großartiger Arzt«, erwiderte Daniel.
»Papi und Opi sind die größten«, erklärte Danny, »und so eine Insel hat niemand, nur wir.«
Und hier konnten sie, fern von jedem Verkehr, in reinster Luft, herumstrolchen, ohne daß man sich Sorgen machen mußte. Natürlich wurden sie dennoch von Mario begleitet, der sich stets als ihr Beschützer fühlte.
»Tina wird sich mit Mario gut verstehen«, sagte Fee. »Wann kommen sie, Paps?«
»Vielleicht schon in vier Wochen. Tucker ist überglücklich, daß die Operation so gut verlaufen ist.«
»Schön wär’s, wenn wir auf anderen Gebieten auch solche Erfolge erzielen würden«, meinte Daniel.
»Fangt jetzt bitte nicht wieder vom Krebs an«, warf Anne ein. »Ich möchte mal nichts von Krankheiten hören.«
»Anne braucht auch mal Tapetenwechsel«, sagte Johannes.
»Sie kann ja zu uns kommen und Großstadt genießen«, scherzte Daniel.
»Einen Tag«, meinte Fee anzüglich »dann hat sie es schon wieder eilig, heimzukommen. Das kennen wir ja.«
»Ich möchte nur nicht, daß immer gefachsimpelt wird, wenn ihr mal da seid«, erklärte Anne. »Wir haben zur Zeit genug schwere Fälle.«
Es blieb nicht aus, daß so manche auf die Insel kamen, für die es keine Hoffnung mehr gab, die sich nur an jedes Fünkchen Hoffnung klammerten, und für die es doch zu spät war.
Aber dann ging es bei ihnen fröhlich zu, und die Kinder sorgten schnell dafür, daß Anne auf andere Gedanken kam.
*
Auch bei Franz Burger sollte es an diesem Tag lebhafter zugehen als sonst. Jochens Ankündigung, daß er mit Gundi und Evi kommen würde, hatte eine rege Geschäftigkeit zur Folge gehabt.
Rosina hatte Kuchen gebacken, als gelte es eine ganze Kompanie abzufuttern, und nun kam sie aus der Küche gar nicht mehr heraus, weil auch ein festliches Mittagessen auf den Tisch kommen sollte.
Das Faktotum Heinrich, zuständig für Haus und Garten, richtete die Terrasse her, die vom Hausherrn so selten gewürdigt wurde.
»Bei dem Wetter«, brummte Franz Burger.
»Es wird sich aufklaren«, meinte Heinrich, und tatsächlich klarte es sich auf.
Gegen elf Uhr traf der Besuch ein. Franz Burger ging ihnen entgegen. Da Evis verkrüppelte Ärmchen unter einem hübschen roten Lodencape versteckt waren, wirkte sie so normal wie andere kleine Mädchen.
»Es freut mich sehr, daß ihr mich besucht«, sagte Franz so herzlich, daß Gundi ihm einen Kuß auf die Wange drückte.
»Wenn du dich ein bißchen herunterbeugst, bekommst du auch ein Bussi von mir, Onkel Franz«, sagte Evi. Und er beugte sich zu ihr herunter, aber dabei beließ er es nicht, sondern hob sie empor und schwenkte sie durch die Luft.
Ja, Jochen und Gundi hatten etwas zu staunen, und an diesem Wochenende sollten sie noch öfter Grund dazu haben.
Er hatte eigene Ideen entwickelt, wie man Evi dazu verhelfen könnte, selbst zu essen mit einem Besteck, dessen Griffe als ovale Öffnungen geformt waren, durch die sie ihre kleinen Hände schieben konnte. Und er hatte noch viele andere Ideen, die es Jochen und Gundi bewußt machten, daß er sich nicht erst jetzt damit beschäftigt hat-
te.
Evi war ganz fasziniert und keineswegs bedrückt oder scheu. Und als Onkel Franz gar meinte, daß er doch jetzt viel Zeit hätte, sich mit ihr zu beschäftigen und ihr viel beibringen könnte, nickte sie eifrig.
»Du kannst ja auch was erfinden, damit ich schreiben lernen kann«, meinte sie unbefangen, aber gleich fügte sie hinzu: »Hast du nicht immer sehr viel zu tun, Onkel Franz?«
»Das macht doch dein Papi«, erwiderte er. »Warum sollte ich ihm dreinreden!« Er warf seinem Neffen einen schrägen Blick zu, aber Jochen war sprachlos und vermochte nichts zu sagen.
»Wir besprechen das alles noch«, fuhr er dann fort. »Heute wird nicht von Geschäften geredet.«
Gundi gelangte schnell zu der Überzeugung, daß tief verwurzelte Vorurteile eine ungerechte Einstellung zu dem alten Herrn erzeugt hatten und er wohl zu stolz gewesen sei, den ersten Schritt zu tun. Nun, dieser war jetzt getan. Die Brücke war geschlagen.
*
Für Tina war es ein Feiertag, als sie den ersten Spaziergang im Freien machen durfte. Sorgsam war sie darauf vorbereitet worden. Zuerst hatte sie nur bis zur Zimmertür und zurück gehen dürfen, aber das ging schon ganz gut. Dann hatte Jonathan sie bis zu seinem Zimmer geführt, und dort konnte sie sehen, wie viele dicke Bücher in den Regalen standen.
»Hast du die alle schon gelesen?« fragte sie staunend.
»Du lieber Himmel, dann wäre ich zu sonst nichts mehr gekommen«, erwiderte er mit einem leisen Lachen. »Für mich sind das Nachschlagewerke, Tina.«
»Du weißt doch sowieso alles«, sagte sie überzeugt.
»So ist es auch wieder nicht. Niemand ist allwissend. Und man muß immer wieder dazulernen. Schau, Tina, als ich so alt war wie du, hatten wir noch keine Ahnung, daß Menschen auf den Mond fliegen können und auch wieder heil zurückkommen. Da gab es nur ganz kleine wacklige Flugzeuge, und schon gar nicht wagte man daran zu denken, daß manche menschliche Organe austauschbar sein würden.«
»Aber manche Menschen müssen das doch schon im Sinn gehabt haben«, sagte sie nachdenklich. »Es dauerte doch sehr lange, bis man in der Forschung Erfolg hat. Aber eins hätten sie nicht zu erfinden brauchen.«
»Was?« fragte er.
»Die Atombomben, die soviel anrichten können. Es wird doch viel Gutes für die Menschen gemacht, warum soll das wieder kaputt gemacht werden? Und dazu brauchen sie so viel Geld. Kein Kind in der Welt müßte hungern, wenn es dafür verwendet würde.«
Auch darüber hatte sie sich schon Gedanken gemacht.Wie ernst ihr kleines Gesicht war!
»Denken wir nicht daran, Tina«, sagte Jonathan. »So unvernünftig werden die Staatsmänner nicht sein, einen Atomkrieg zu provozieren.«
»Und wozu werden die Dinger dann gebaut?« fragte Tina. »Das verstehe ich wirklich nicht. Wie können die Leute, die das erfunden haben und immer noch mehr erfinden, nur ruhig schlafen?«
»Sie werden sich wohl nicht solche Gedanken machen wie du«, erwiderte Jonathan.
»Ich möchte solchen Leuten mal richtig die Meinung sagen«, erklärte Tina.
»Vielleicht wirst du mal Gelegenheit dazu haben«, sagte er.
»Gibst du mir mal so ein Buch zum Lesen?« fragte sie nach einer kleinen Pause.
»Das ist ja viel zu schwer, und du verstehst es noch gar nicht.«
»Hast du nicht eins, das ich verstehe?«
»Eins habe ich, aber das kennst du bestimmt schon.«
»Wie heißt es?«
»Der kleine Prinz.«
»Von Antoine de Saint-Exupéry«, sagte sie, »ja, das kenne ich. Er ist leider auch so einen sinnlosen Tod gestorben.«
Jonathan schloß unwillkürlich die Augen. Mein Gott, sie ist doch erst knapp zwölf Jahre, wie kann sie nur schon so tiefsinnig denken?
»Er hätte sicher noch viele schöne Geschichten geschrieben«, fuhr Tina leise fort. »Ich bin froh, daß ihr nicht mehr in den Krieg müßt, wenn einer kommt, du nicht und Papi auch nicht.«
Diesem optimistischen Gedanken wollte er nun bei Gott nicht widersprechen, aber bevor ihm andere Gedanken kommen konnten, sagte sie: »Und Axel werde ich verstecken. Der mag sowieso kein Schießeisen in die Hand nehmen. In der Bibel steht: Du sollst nicht töten. Aber es steht auch da: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Es gibt so viele Widersprüche, Jonathan.«
»Du bist mir einfach zu gescheit«, sagte er mit einem tiefen Seufzer.
»Ich hatte nur viel Zeit, alles zu lesen, was mir unter die Finger gekommen ist«, erwiderte sie mit einem umwerfenden Lächeln.
Aber war es nicht seltsam, daß sie nur mit ihm so tiefsinnige Gespräche führte? Jonathan sagte allerdings nie, daß sie noch viel zu jung dafür sei und sie sich noch ein paar Jahre gedulden solle, bis sie all diese Probleme begreifen würde. Er nahm sie einfach ernst. Und nun freute er sich schon auf die Zeit mit ihr auf der Insel der Hoffnung. Jetzt brauchte er einen Rückschlag ja nicht mehr zu fürchten.
Nun neidete es ihm Sabine wenigstens nicht mehr, daß er all die Genesungsstadien, die Tina durchmachen mußte, zuerst genießen konnte. Sie hatte begriffen, wieviel Güte in diesem Mann war und wie glücklich es ihn machte, daß Tina sich so schnell erholte.
Eigentlich verlief ihr Leben wie zu Hause. Manfred schrieb und sie tippte ab, was er geschrieben hatte. Er konnte mit der Schreibmaschine gar nichts anfangen.
Axel und Kathrin waren die meiste Zeit bei den Nachbarn, denen dies höchst willkommen schien. Der Vater war den ganzen Tag weg, die Mutter war heilfroh, wenn ihre sehr lebhaften Schlingel beschäftigt wurden. Sie hatte das Sabine gegenüber freudig geäußert und auch gesagt, daß sie mit dem Haushalt vollkommen ausgelastet sei.
Allerdings hatte die wirklich nette Jeannette auch viel Verständnis dafür, daß Manfred Ruhe zum Schreiben brauchte, obgleich sie gleichzeitig aufrichtig eingestand, daß es bei ihnen dauernd Differenzen geben würde, wenn ihr Mann den ganzen Tag im Hause wäre.
Jeannette nahm es leicht. Sie war eine gute Hausfrau und Mutter. Sie war auch hilfsbereit und brachte den Mainhards jeden Morgen frische Sandwiches.
Und so gingen die Tage nun dahin in einem schönen geruhsamen Gleichmaß, und Sabine und Manfred gönnten sich auch so manche Mußestunde, da sie nun von der Sorgenlast um Tina befreit waren.
Und dann kam der Tag, an dem Axel staunend feststellte, daß Tina ihn um ein ganzes Stück überragte.
»Du bist aber schnell gewachsen«, sagte er bewundernd.
»Das kommt vom vielen Schlafen«, erwiderte sie.
»Und noch hübscher bist du geworden«, meinte er. »Kommt das auch vom vielen Schlafen?«
»Was du nicht alles feststellst«, sagte Tina verlegen.
»Die werden vielleicht schauen, wenn wir heimkommen, Tina«, freute sich Axel. »Aber zuerst fährst du ja mit Jonathan auf die Insel. Schade, daß wir da nicht mitdürfen.«
»Ihr seid mir doch nicht böse?« fragte Tina.
»Dir kann man doch gar nicht böse sein, aber wir vermissen dich doch sehr.«
»Aber bald geht alles wieder seinen Gang, und dann muß Jonathan ja auch wieder zurück.«
»Und dann bist du traurig«, sagte Axel leise.
Ihr Blick wanderte in die Ferne. »Schön wäre es, wenn er unser Großpapa wäre«, sagte sie träumerisch. »Ich glaube, das würde er auch gerne sein.«
»Dann fragen wir ihn doch, Tina.«
»Er muß ja auch noch anderen Menschen helfen«, sagte sie leise.
*
Jonathan Tucker hatte seinen Urlaub festgelegt. Betroffen nahmen es seine Mitarbeiter zur Kenntnis.
»Nun zeigt mal, was ihr könnt«, sagte er. »Es wird nicht mehr lange dauern, dann räume ich euch ganz das Feld.«
Das meinte er ernst. Niemand hatte es geglaubt. Schwester Harriet war bis ins Mark getroffen, das stand fest. Bleich und stumm wandelte sie einher. Und es dauerte einige Zeit, bis Jona-than das bemerkte, denn er war in jeder freien Minute immer noch mit Tina beschäftigt.
»Wir haben doch oft darüber gesprochen, daß wir gemeinsam aufhören, Harriet«, sagte er. »Nun naht die Zeit. Wir waren uns doch immer einig.«
»Aber Sie haben nie gesagt, daß Sie dann ganz von hier fortgehen«, begehrte sie auf.
»Das habe ich jetzt auch nicht gesagt.«
»Aber ich weiß es. Sie werden nach Deutschland gehen, um Tina öfter sehen zu können.«
»Die gute Harriet weiß mehr als ich«, bemerkte Jonathan, aber ein ironischer Ton gelang ihm nicht.
»Ich kenne Sie zu gut«, meinte Harriet.
»Na schön, wenn Sie mich so gut kennen, warum siezen wir uns wieder privat?«
»Es ist besser so, dann fällt der Abschied nicht so schwer. Dann sind Sie eben nur der Chef, der Adieu sagt auf Nimmerwiedersehen.«
»Nicht aufregen, Harriet, ich hätte dich schon noch gefragt, ob du mitgehen willst, wenn ich selbst mit mir im reinen bin«, erwiderte er.
»Ob ich mitgehen will?« wiederholte sie fassungslos.
»So ganz einsam wollte ich auch drüben eigentlich nicht sein, falls ich tatsächlich diesen Entschluß fasse. Oder hat du gemeint, ich will mich bei den Mainhards einnisten?«
»Man denkt so manches«, murmelte Harriet.
»Der Mensch denkt, Gott lenkt. Ich gehe hier weg, wenn mein Vertrag abgelaufen ist. Ein paar Jahre müssen mir bleiben, um meine Erfahrungen und meine Erkenntnisse der Nachwelt zu überliefern. Ich denke, daß dies meine Pflicht ist. Und dabei könntest du mir helfen, Harriet. An vieles kannst du dich besser erinnern als ich, und du hast ja auch Tagebuch geführt. Du hast doch oft gesagt, daß du das neue Deutschland gern mal besuchen würdest, wenn du Zeit dafür hast.«
»Das würde ich auch gern, und wenn du mich fragst, wenn das eben so eine Art Angebot gewesen sein sollte, dann sage ich ja.«
Ein Lächeln glitt über sein Gesicht. »Dann fällt mir die Entscheidung gar nicht mehr schwer, Harriet. Diesmal fahre ich allein, aber ich werde mich umschauen und ein nettes Häuschen suchen, wo wir unsere Erfahrungen zu Papier bringen können, in aller Ruhe, fern von aller Hektik.«
»Allein fährst du ja nicht«, sagte sie nachdenklich.
Schweigend blickte er zum Fenster hinaus. »Nächstes Jahr steht Tina mitten im Leben. Dann wird sie auch schon langsam eine junge Dame, und die Boys werden ihr nachschauen. Die Zeit entgleitet uns so schnell, Harriet. Erst jetzt habe ich mich erinnert, daß es doch gut ist, wenn man auf einem Höhepunkt scheidet und nicht mitleidvoll als alter Mummelgreis verabschiedet wird.«
»Du und Mummelgreis, bis dahin ist es wirklich noch lang hin«, sagte Harriet.
»Aber die Jahre lassen sich nicht leugnen. Ich mache mir keine Illusionen, Harriet. Es ist nicht immer ein kleines, tapferes Mädchen da, das mir die Daumen drückt. Uns geht jetzt alles viel mehr unter die Haut, oder willst du mir widersprechen?«
»Kann ich nicht«, erwiderte Harriet.
»Also dann, meine Gute, nächstes Jahr kommt der Tapetenwechsel. Du wirst doch nicht tatsächlich geglaubt haben, daß ich dich hier allein zurückgelassen hätte, dazu haben wir zwei doch viel zuviel gemeinsam mitgemacht.«
»Dank dir, Jonathan, daß du so denkst«, sagte sie. »Bist ein feiner Kerl, aber das habe ich dir ja schon oft gesagt.«
»Und du bist ein feines Mädchen, Harriet.«
»Ein altes Mädchen«, lächelte sie mit ganz tränenfeuchten Augen. »Wie es sich für einen alten Knaben geziemt. Kannst du eigentlich auch kochen?«
»Das hättest du schon längst feststellen können«, erwiderte sie lächelnd. »Aber ich kann mir ja schon ein paar Rezepte von Sabine geben lassen, wenn es dich danach gelüstet. Wenn ich gewußt hätte, daß bei dir auch die Liebe durch den Magen geht, hätte ich mir mehr Mühe gegeben.«
»Weißt du, Harriet, früher war mir alles egal, was ich geschluckt habe. Da gab es nur die Arbeit. Ich war besessen davon, alles zu erreichen, was ich mir so vorstellte.«
»Hast du alles erreicht, Jonathan?«
»Ich habe einem liebenswerten, klugen Kind ein neues Leben schenken können. Das zählt letztendlich für mich, Harriet. Die anderen, die ich operierte, hatten entweder Angst vor dem Sterben, oder sie wollten nur leben, besser gesagt, das, was sie unter leben verstanden. Aber Tina dachte weit in die Zukunft hinein. Sie dachte auch an mich, an meine Angst vor der Operation, und kannst du mir jemanden sagen, der an mich dachte, wenn ich das Skalpell in die Hand nahm?«
»Ja, ich«, erwiderte sie schlicht, aber dann drehte sie sich um und eilte schnell davon. Und Jonathan dachte, daß er sich zu wenig Gedanken um sie und ihre Gefühle gemacht hätte, sonst hätte er wohl auch nicht so viele Abende hinter seinen Büchern verbringen müssen.
Aber dann hätte es wieder Klatsch gegeben, dachte er dann. Es galten ungeschriebene Gesetze in diesem Hospital, die schon manchem zum Verhängnis geworden waren. Natürlich wurde alles hier sehr diskret abgehandelt, aber es gab einen Verwaltungsrat, der die Augen und Ohren überall hatte. Es war noch gar nicht so lange her, daß ein Arzt an die Klinik gekommen war, der schon einige Jahre geschieden war. Er hatte sich mit einer jüngeren Krankenschwester angefreundet, und schon bald hatte man ihnen anheimgestellt, sich doch eine andere Stellung zu suchen.
Das waren Begebenheiten, die Jonathan immer geärgert hatten, aber er hatte sich nie eingemischt. Er hat-
te sich immer nur für die Patienten interessiert. Doch nun hatte die kleine Tina längst schlummernde Gefühle in ihm geweckt, die Sehnsucht nach menschlicher Wärme.
*
Nach solcher Wärme sehnte sich auch Lotte Rimmel, die in einem langen Winter nur mit ihren Tieren gesprochen hatte. Um die Pfingstzeit hatte sie ein paar Hausgäste gehabt, die etwa im gleichen Alter wie sie gewesen waren. Nette Leute, denen es gefiel, die aber doch sagten, daß sie nicht ständig so fern der Stadt leben wollten. Für ein paar Wochen schon, aber nicht länger. Und dann hatte Dr. Norden ihr das Ehepaar Fiebig angekündigt mit dem kleinen Sohn Danny. Wenn es nicht der Dr. Norden gewesen wäre, hätte sie nein gesagt. Lieber wollte sie für sich allein sein, als bedauert zu werden für dieses einsame Leben, das sie sich doch selbst nach schweren Enttäuschungen gewählt hatte.
Aber Dr. Norden konnte sie nichts abschlagen. Er hatte sie davor bewahrt zu resignieren und ihr zugeredet, sich für ihren Lebensabend noch eine neue Aufgabe zu schaffen. Sie stammte vom Lande, sie solle zurück aufs Land gehen, hatte er ihr geraten. In der Stadt hatte sie sich nicht glücklich gefühlt, aber sie hatte ausgeharrt, solange ihr Mann lebte. Richtig glücklich war sie in dieser Ehe nie gewesen. Kinder waren ihr versagt geblieben, und ihr Mann hatte auch keine gewollt. Ihn hatte jedes Kinderlachen gestört. In den großen Mietshäusern, die er gebaut und vermietet hatte, waren keine Spielplätze für Kinder einkalkuliert, aber es waren doch eine ganze Anzahl darin zur Welt gekommen und herangewachsen. Kleine Füße waren treppauf und treppab getrappelt, und auch darüber hatte er sich aufgeregt.
Und wenn sie ihn gebeten hatte, doch etwas toleranter zu sein, hatte sie seinen Ärger ausbaden müssen.
Doch nun würde ein Kind auf ihren Bauernhof kommen, das erste Kind, seit sie hier lebte, und Lotte Rimmel war ganz aufgeregt. Mit besonderer Liebe und ganz eigenhändig hatte sie das Zimmer für den kleinen Danny hergerichtet, sogar schnellstens ein Kinderbett gekauft. Drei Wochen würde sie Kinderlachen genießen können, und vielleicht kamen dann später auch noch mehr Eltern mit Kindern, die sich hier so frei tummeln konnten, die sich an den Tieren freuten, und denen es nicht langweilig wurde und murrten, weil es hier keinen Fernseher gab.
Den hatte Lotte Rimmel hassen gelernt, weil ihr nun bereits vor zwei Jahren verstorbener Mann diesen immer zu allererst eingeschaltet hatte, wenn er die Wohnung betrat, noch bevor er sie begrüßt hatte. Und wehe, wenn dann schon eine Sendung begonnen hatte, die er sehen wollte. Ob sie sich denn für gar nichts interessiere, hatte er gemurrt.
O ja, sie hatte sich für vieles interessiert, aber es waren eben andere Dinge gewesen als jene, für die er sich interessiert hatte.
Alles, was ihr Freude machte, hatte sie heimlich tun müssen. Zum Beispiel, in der Krankenfürsorge zu helfen, oder die Waisenkinder an den Festtagen zu beschenken. Das Geld dafür hatte sie sich absparen müssen, obgleich Geld und Gut in Hülle und Fülle vorhanden waren.
»Jeder Mensch bekommt seine Chance«, hatte ihr Mann immer gesagt. »Der eine versteht sie zu nutzen, der andere nicht.« Und für ihn waren alle Faulpelze, die es nicht zu Besitz brachten. Und wenn sich Lotte mal erlaubte zu sagen, daß sie sich im Alter doch aufs Land zurückziehen könnten, hatte sie nur zu hören bekommen, daß sie ein Bauerntrampel gewesen und geblieben sei.
Nun, so sah sie nicht aus. Mit ihren fast sechzig Jahren war sie eine noch schlanke, ansehnliche Frau, die vital und flink endlich ihr Leben selbst bestimmen konnte.
Und behende eilte sie aus dem Haus, als Martin Fiebigs Auto mit hörbarem Geräusch nahte.
»Grad, daß wir es geschafft haben«, waren Martins erste Worte, als er ausstieg. »Unser Muckel ist schon ein bißchen altersschwach.«
»Wir haben hier eine gute Werkstatt«, sagte Lotte Rimmel. »Aber erst einmal herzlich willkommen.«
Danny kletterte aus dem Wagen, sah Lotte staunend an. »Das ist doch keine Dame, Mami, das ist eine Omi«, sagte er, und damit hatte er Lottes Herz schon gewonnen.
»Aber Frau Rimmel ist trotzdem eine Dame, Danny«, sagte Claudia verlegen.
»Ach was«, sagte Lotte, »lassen wir es doch bei der Omi. Mich kann es nur freuen.«
»Siehst du, Mami, der Onkel Doktor hat es gesagt, daß sie lieb ist, aber so schön, wie es hier ist, hat er nicht gesagt.«
»Dr. Norden war ja leider noch nicht hier«, sagte Lotte.
»Er hat so viel zu tun«, erklärte Danny sofort. »Er ist dauernd unterwegs.«
»Läßt du uns auch mal zu Wort kommen, Sohnemann?« fragte Martin. »Wir möchten Frau Rimmel doch sagen, daß wir uns sehr freuen, hier unseren ersten gemeinsamen Urlaub verbringen zu können.«
»Den ersten gemeinsamen Urlaub«, wiederholte Lotte nachdenklich, »nun, dann kann ich wirklich nur hoffen, daß der Wettergott das gehört hat.«
»Darauf kommt es nicht an«, sagte Claudia. »Dr. Norden sagte uns, daß wir uns hier auch betätigen können. Mein Mann wird es mit Begeisterung tun.«
Lotte Rimmel schnappte gleich nach Luft. »Sie sollen sich doch erholen«, sagte sie fassungslos.
»Was aber nicht gleichbedeutend mit faulenzen sein muß«, warf Martin ein. »Ich bin das ganze Jahr ein Bürohocker.«
»Aber jetzt zeige ich Ihnen erst mal die Zimmer«, sagte Lotte Rimmel.
Und da fühlten sie sich gleich heimisch. Danny war natürlich ganz begeistert, daß er solch ein hübsches großes Zimmer neben dem seiner Eltern hatte, und gleich mußte er auch feststellen, daß man vom Fenster aus die Berge sehen konnte.
»Zum See ist es auch nicht weit«, erklärte Lotte, »aber heute wirst du wohl lieber in der Badewanne planschen.«
»Ist denn eine da?« fragte er.
»Aber freilich«, erwiderte Lotte lachend und öffnete die nächste Tür.
»Oh, Mami, ein ganz tolles Bad«, rief Danny begeistert aus.
»Das ist ja alles wunderhübsch«, sagte Claudia. Und für diesen Preis, dachte sie dann weiter. Anderswo hätten sie das drei- oder gar vierfache dafür zahlen müssen, was sie sich freilich nicht leisten konnten.
»Ich hoffe, Sie werden sich wohl fühlen und dann auch gern wiederkommen«, sagte Lotte.
»Das wird uns leichtfallen«, sagte Claudia herzlich.
»Du bist lieb«, sagte Danny zu Lotte. »Ich möchte dir ein Bussi geben.«
Darüber konnten nun wieder seine Eltern staunen, denn er war sonst sehr scheu. Doch Lottes Augen leuchteten auf, und sie hob ihn empor. »Wir werden uns bestimmt gut verstehen, Danny. Ich freue mich, daß endlich ein Kind im Haus ist.«
»Und wie darf ich zu dir sagen?« fragte Danny.
»Einfach Tante Lotte«, erwiderte sie. »In einer halben Stunde gibt es Mittag-essen.«
»Kann ich helfen?« fragte Claudia.
»Die Liesl ist ja da. Sie sollen sich erholen.«
*
Und wie schmeckte das Essen, das in der behaglichen Bauernstube eingenommen wurde. Saftige Schnitzel mit frischen Salaten gab es als Begrüßungsessen, und vorher eine Suppe mit Grießnockerln, wie Danny sie besonders gern mochte. Sie fühlten sich wie im Schlaraffenland. Lotte bekam noch ein paar Bussis von Danny, als sie sagte, daß er wünschen könne, was er am liebsten äße. Da zählte er gleich unbefangen auf. »Suppe und Pfannkuchen und Kartoffelbrei und Soße, und Tomaten mag ich auch und Äpfel.«
Und Milch bekam er, wie er sie noch nie getrunken hatte. Dann führte Lotte sie durch den Obstgarten, und er konnte Erdbeeren selbst pflücken.
»Wenn es so schön bleibt, werden die Kirschen auch bald reif«, sagte Lotte.
»Es bleibt schön, ich bin doch brav«, erklärte Danny.
»Ja, du bist sehr brav«, sagte Lotte.
»Papi braucht nicht zu schümpfen«, meinte Danny verschmitzt.
Aber Martin war jetzt schon ein völlig anderer Mensch. Alle Gereiztheit war von ihm abgefallen.
»Und nun möchte ich die Pferdchen und die Kühe sehen, Tante Lotte«, bat Danny.
Pferde gab es drei, den Maxi, die Mädi und das Fohlen Mucki, das dem kleinen Danny natürlich besonders gut gefiel. Die sechs Kühe hatten auch Namen, die leicht zu merken waren. Fanny, Kitty, Sissi, Milli, Stasi und Wally hießen sie.
»Und sie haben keinen Mann?« fragte Danny. »Die Pferdeln sind eine Familie wie wir, Papi, Mami und Kind. Hast du keinen Mann und keine Kinder, Tante Lotte?«
»Leider habe ich keine Kinder, und mein Mann lebt nicht mehr, Danny.«
Er sah sie an und schmiegte seine Wange dann an ihre Hand. »Jetzt habe ich dich lieb, Tante Lotte«, raunte er ihr zu.
So waren an diesem Tag wieder vier Menschen glücklich und zufrieden, und selbst Liesl, die es mit den Fremden eigentlich gar nicht hatte, zeigte ihr freundlichstes Gesicht. Sie war auch nicht mehr die Jüngste und so allein wie Lotte. Sie war froh gewesen, hier auf dem Hof ihr Leben verbringen zu können. Mit diesen Gästen war aber auch sie einverstanden, und Lotte wünschte, daß jetzt die Zeit nicht gar so schnell vergehen würde. Ein fröhliches Leben begann auf Lottes Hof. Martin bewies, daß er Talent zum Bauern hatte. Claudia ließ es sich nicht ausreden, sich in Haus und Garten zu betätigen, und für Danny brachte jeder Tag neue Wunder. Er durfte schon in der Frühe noch nestwarme Eier aus dem Hühnerstall holen, er schaute beim Melken zu, das Martin auch mit großem Geschick vollbrachte, er fütterte die Pferde mit Mohrrüben und Äpfeln, die extra für sie eingekellert worden waren, und dann kehrte auch der schöne Hirtenhund Troll auf den Hof zurück, der eine Woche bei einem Züchter verbracht hatte. Warum wohl, das wollte Danny auch wissen.
»Damit er sich eine nette Gefährtin aussuchen konnte«, erklärte Lotte schmunzelnd.
»Und warum hat er sie nicht mitgebracht?« wollte Danny wissen.
»Sie wird nun kleine Hündchen bekommen«, erwiderte Lotte.
»Aber die wird er doch auch sehen wollen. Er ist aber gar nicht traurig.«
»Er freut sich, daß er wieder zu Hause ist«, sagte Lotte. »Bei Hunden ist das anders als bei Menschen, wenn sie nicht immer beisammen sind.«
So manches gab es doch, was Danny nicht verstehen konnte, noch nicht, aber ihm gefiel es sehr, wenn Troll neben ihm hertrottete oder wenn er mit ihm Ball spielen konnte, oder wenn er mit ihnen zum See ging und dort munter herumschwamm. Da packte Danny der Ehrgeiz. Er wollte auch schwimmen lernen. Er begriff es schnell, allerdings paddelte er auch so wie Troll. Ein Tag war so schön wie der andere, kamen auch mal Wolken und manchmal auch ein Gewitter. Dann saßen sie in der Bauernstube, und wenn es abends kühl wurde, prasselte im Kamin ein lustiges Feuer, und immer gab es noch was Leckeres zum Schlecken oder Knabbern, es war verständlich, daß da gar kein Heimweh aufkommen konnte.
*
Sabine war dagegen nicht gefeit. Sie freute sich am meisten auf den Tag, an dem sie die Heimreise antreten konnten. Ärztliche Bedenken gegen den langen Flug hatte nun auch Jonathan nicht mehr, doch für Manfred und Sabine war es ein beruhigender Gedanke, daß er sie begleiten würde.
Der Abschied von Harriet ging nicht ohne Rührung ab, aber sie hielt tapfer die Tränen zurück und meinte, daß sie sich bestimmt wiedersehen würden.
»Sie sind uns immer herzlich willkommen, Harriet«, sagte Sabine.
»Paß gut auf dich auf, Harriet«, sagte Jonathan.
Tina umarmte sie. »Ein Jahr vergeht schnell, Harriet«, raunte er ihr ins Ohr und küßte sie auf beide Wangen.
»Hättest ruhig mitkommen können«, sagten Axel und Kathrin wie aus einem Mund.
Dann saßen sie wieder in dem riesigen Flugzeug, dicht beieinander, doch diesmal zu sechst und mit anderen Gefühlen als auf dem Herflug. Für Tina hatten sie neue Kleidung kaufen müssen, da ihr alles zu klein geworden war in der kurzen Zeit, aber auch Axel und Kathrin hatten neue Jeans bekommen, da sie ihre alten aufgetragen hatten. Jonathan hatte einen ganzen Koffer voller Sachen dabei für die Kinder, die Harriet eingekauft hatte, weil er nichts davon verstand. Aber die sollten sie erst zu Hause bekommen. Für ihn war es der erste weite Flug seit zwanzig Jahren, und ihm wäre es schon ein bißchen unheimlich gewesen, wenn er nicht neben Tina gesessen wäre. Er hielt ihre Hand und fing einen aufmunternden Blick auf.
»Fliegen ist schön, Jonathan«, sagte sie. »Schau doch hinaus, diesmal sind keine Wolken unter uns. Man kann den Ozean sehen.«
»Ich fühle mich wohler, wenn ich Boden unter den Füßen habe«, brummte er.
Sie lachte schelmisch. »Den hast du doch, der bricht nicht durch.«
»Ich bin wirklich sehr vorsichtig«, gab er zurück. »Ich mache lieber die Augen zu.«
»Du hast ja auch noch so viel gearbeitet, da muß man müde sein«, sagte sie. »Schlaf gut.«
»Sie hat ja jetzt schon mütterliche Instinkte«, raunte Manfred Sabine zu. Sie blinzelte zu ihm hinüber. »Da kann man schon von vertauschten Rollen reden, aber es scheint ja auch ihm zu gefallen.«
»Er nimmt Tina ernst, Sabine, viel ernster, als wir sie genommen haben. Für uns war sie doch immer das hilfsbedürftige Kind.«
Sie hatten die Rücklehnen zurückgestellt. Axel und Kathrin waren schon eingeschlafen, obgleich sie doch beteuert hatten, den Flug noch richtig genießen zu wollen.
Und auch Tina war eingeschlafen, den Kopf an Jonathans Schulter gelehnt. Er hatte die Augen geschlossen, aber er schlief nicht. Er hatte nur gewollt, daß Tina schlafen solle. Und das hatte er erreicht. So würde sie den Flug am besten überstehen. Er fühlte unausgesetzt ihren Puls und lauschte auf ihren Atem, immer gegenwärtig, den Kreislauf zu unterstützen, wenn es notwendig sein sollte.
Aber sie schlief ganz ruhig, und ein Lächeln lag auf ihrem Gesicht. Sie wachte tatsächlich erst auf, als das Flugzeug in Frankfurt zur Landung ansetzte.
Verwirrt blickte sie Jonathan an. »Gibt es gar kein Essen?« fragte sie.
»Das haben wir verschlafen«, erwiderte er, »aber wir werden nach der Landung gleich unseren Hunger stillen können.«
»Ich habe die ganze Zeit geschlafen?« staunte sie. »Und du hast mich nicht geweckt?«
»Du hast nichts versäumt, Kleines. Es waren nur schwarzen Wolken unter uns«, sagte Jonathan.
»Und jetzt regnet es wer weiß wie«, sagte Axel unwillig. »Was ist denn eigentlich mit dem Gepäck, wenn wir umsteigen müssen, Papi?«
»Es wird in die andere Maschine verladen«, erwiderte Manfred.
»Hoffentlich geht nichts verloren«, seufzte Sabine.
»Na, das wollen wir doch nicht annehmen«, sagte Jonathan. »Geht es denn gleich weiter? Ich dachte, wir könnten noch essen. Tina hat Hunger.«
»Wir sind schon vor ein Uhr in München. Dort können wir essen«, meinte Manfred. »Da weiß ich besser Bescheid. Hältst du es noch so lange aus, Tina?«
»Ich habe die Lunchpakete einkassiert«, erklärte Axel verschmitzt. »Da sind ganz gute Sachen drin. Ihr habt ja alle geschlafen.«
Eine ganze Tasche voll hatte ihm die Stewardeß eingepackt. Sabine war es richtig peinlich.
»Was hast du denn, Mami, das wird dann sowieso weggeschmissen, und was wir nicht essen, nehme ich meinen Schulfreunden mit, damit sie auch was von der weiten Welt schnuppern.« Ein pfiffiger forscher Junge war er geworden in diesen Wochen, und auch Kathrin war lange nicht mehr so schüchtern.
»Es hat ihnen gut getan«, sagte Sabine nachdenklich, als sie ihre Kinder betrachtete.
»Nun sind wir bald zu Hause«, flüsterte sie. »Ob es Jonathan wohl bei uns gefällt?«
Manfred lächelte. »Sei unbesorgt.«
»Ich muß Ordnung schaffen«, sagte sie. »Alles wird verstaubt sein.«
»Liebe Güte, wir waren ja auch über fünf Wochen weg. Das bißchen Staub wird ihm bestimmt nichts ausmachen. Und übermorgen fahren sie ja gleich zur Insel.«
»Bringen wir sie nicht hin?« fragte Sabine.
»Mit dem alten Klapperkasten? Da haben wir doch gar nicht alle Platz.«
»Du kannst dir doch von Pollmer einen Wagen leihen. Das können wir schon noch abzweigen, Manni.«
»Nur nicht leichtsinnig werden. Du weißt, was wir uns vorgenommen haben. Aber die Welt wird ein Leihwagen nicht kosten.«
*
Dann waren sie endlich daheim. Unterwegs hatten sie gut gegessen, und zur Freude aller hatte auch Tina einen guten Appetit entwickelt.
»Herrgott ist es hier schön«, sagte Jonathan tief aufatmend, als er aus dem Taxi stieg. Zum Glück hatten sie einen freundlichen Taxifahrer erwischt, der nicht über die sechs Personen und das Gepäck gestöhnt hatte. Die Kinder würden ja für einen zählen, hatte er gemeint. Aber froh waren sie doch, als sie aussteigen konnten, denn hier war es warm. Es regnete nicht. Die Sonne lugte zwischen den Wolken hervor. Die Kletterrosen am Haus standen schon in voller Blüte.
»So schön waren sie noch nie«, sagte Sabine innig.
»Und ohne gießen«, brummte Axel.
»Es wird schon genug geregnet haben«, meinte Manfred.
»Gehen wir gleich in den Garten, Jonathan?« fragte Kathrin. »Da wird es ziemlich schlimm aussehen, vor allem im Gemüsegarten«, sagte Sabine rasch, »aber ich werde erst mal das Haus durchlüften, sonst macht Jonathan gleich wieder kehrt.«
Der dachte gar nicht daran. Was störten ihn schon Staub und muffige Luft. Das war alles schnell zu beheben. Er hatte jetzt erst mal so richtig das Gefühl, daß man ihn zur Familie zählte, hier, in heimlichen Gefilden, und das genoß er.
Und so arg sah es nirgends aus, wie sie gefürchtet hatten. Im Gemüsegarten hatten sich anscheinend die Hasen gütlich getan am Kohl, aber das taten sie sonst auch, wenn sie sich unbeobachtet fühlten. Dicke rote Kirschen hingen am Baum, und die Pflaumen waren auch schon teilweise reif.
»Verderbt euch nicht gleich den Magen«, rief Sabine aus dem Wohnzimmer, als Manfred schon eine Leiter herbeischleppte.
»Da können wir nachher gleich noch Zwetschenpfannkuchen machen«, sagte Axel genüßlich.
»Was ist das?« fragte Jonathan interessiert.
»Das wirst du schon sehen«, sagte Tina. »Es wird dir ganz bestimmt schmecken.«
»Kennst du Palatschinken, Jona-than?« fragte Kathrin.
»Was ist das für ein Schinken?« fragte er.
Kathrin kicherte. »Das ist gar kein Schinken, das nennt man bloß so. Das sind ganz dünne Eierkuchen. Ich mag sie am liebsten mit ganz viel Schokolade.«
»Das klingt wirklich nicht nach Schinken«, lachte Jonathan, »aber ihr könnt einem schon die Mund wäßrig machen.Was ich auf meine alten Tage alles noch so kennenlerne!«
»Du sollst nicht sagen, daß du alt bist«, sagte Tina ernst. »Ich will das nicht hören.«
Er nahm alle drei in die Arme. »Ihr sorgt schon dafür, daß ich noch mal jung werde«, sagte er. Sabine sah und hörte es, ebenso wie Manfred, und sie sahen sich an.
»Ich habe so eine Ahnung«, sagte Manfred.
»Was für eine? Meinst du auch, daß er herkommen wird für immer?«
Er nickte. »Er wird sich nach einem Haus umschauen. Ich habe gehört, wie er das zu Harriet sagte. Und er wird sie dann mitbringen.«
»Dann rede du mal mit ihm, und sage ihm, daß wir uns freuen würden, wenn er ein Haus in der Nähe finden würde. Wir könnten ihm ja behilflich sein.«
»Danke, Sabine«, sagte er leise, »du hast deinen Schatten übersprungen. Er nimmt uns Tina nicht weg. Wir haben alle einen sehr guten Freund hinzugewonnen.«
»Einen sehr lieben Opa«, sagte sie.
Es blieb keine geheime Angst in ihr zurück, als Manfred dann Jonathan und Tina zur Insel brachte.
»Ihr besucht uns aber bestimmt«, sagte Tina beim Abschied.
»Worauf du dich verlassen kannst«, erwiderte Sabine.
»Ich verlasse mich auch darauf«, meldete sich Jonathan zu Wort.
Sabine küßte ihn auf beide Wangen.
»Einstweilen Dank für alles, lieber Jonathan«, sagte sie leise. »Ich bin sehr gespannt auf die Insel.«
Das war Jonathan auch. Und dort reichten sich dann zwei Männer die Hände, die sich schon viele Jahre nicht mehr gesehen hatten und einander doch sofort erkannten. Tina war ganz außer sich vor Freude, daß sie mit Jonathan allein in einem der hübschen kleinen Häuschen wohnen konnte, die auf der Insel verstreut lagen und eher den Eindruck einer hübschen Siedlung vermittelten, als jenen, daß es sich um ein Sanatorium handelte. Mario weihte Tina sogleich in die losen Gesetze ein, die auf der Insel herrschten. Jeder konnte tun, wonach ihm der Sinn stand, nur die Therapieanwendungen mußten ganz pünktlich eingehalten werden.
»Da ist mein Papi streng«, sagte Mario.
»Mein Jonathan auch«, sagte Tina. »Das muß auch so sein, wenn man gesund werden will.«
Manfred konnte beruhigt und zufrieden heimwärts fahren. Aber zuvor hatte er noch ein langes, inhaltsreiches Gespräch mit Jonathan unter vier Augen, und danach schieden sie in vollem Einverständnis, den Blick schon in die weite Zukunft gerichtet.
*
Für die Fiebigs kam die Stunde des Abschiednehmens von Lotte Rimmel und Liesl, den Tieren und von diesen beglückenden Wochen. Troll schlich auch trübsinnig herum, aber es nützte ja nun mal nichts. Die Arbeit rief.
Sie nahmen ihre letzte Mahlzeit ein. Auch Danny, dem es sonst immer so gut geschmeckt hatte, zeigte keinen Appetit.
»Nächstes Jahr fahren wir wieder zu Tante Lotte, gell?« fragte er mit tränen-ersticktem Stimmchen.
»Ihr braucht’s doch nicht bis nächstes Jahr warten«, sagte Lotte. »Am Wochenende könnt ihr doch auch mal kommen, und es gibt auch Feiertage. Schön wär’s, wenn ihr Weihnachten bei mir feiern würdet.«
Gerührt sah Claudia die Ältere an. »So gern hast du uns, Tante Lotte?« fragte sie.
»Grad so, als hätte ich nun auch eine Familie, ist es mir«, erwiderte Lotte, »und wenn der Kindergarten Ferien macht, könnt ihr mir doch Danny herbringen. Das wollte ich sagen.«
Danny fiel ihr gleich um den Hals. »Habt ihr das gehört? Papi, Mami, was sagt ihr dazu? Unsere liebe Tante Lotte!«
»Das ist wirklich sehr lieb«, sagte Claudia, »aber…«
»Ach was, kein Aber«, sagte Lotte, »und du läßt dein Geld stecken, Martin. Du hast genug gearbeitet hier. Erspar es mir, daß wir es gegenseitig aufrechnen. Du mußt dich jetzt wieder genug mit Zahlen herumplagen. Wir haben Freundschaft geschlossen. Ich habe sonst niemanden, und wenn ihr meinen Lebensabend mit Freude erfüllt, ist es überflüssig, von Geld zu reden. Ich habe genug und kann es gar nicht verbrauchen. Also macht eurer Tante Lotte die Freude und kommt, so oft ihr könnt.«
»Du bist zu großzügig, Tante Lotte«, sagte Claudia bewegt.
»Martin kann mir ja meine Steuererklärung machen«, sagte sie verschmitzt. »Dann bleibt vielleicht noch ein bißchen mehr übrig. Wenn ihr mir jetzt versprecht, bald wiederzukommen, brauche ich nicht zu heulen.«
Aber als sie sich umarmten, kullerten die Tränen dennoch.
»Wir kommen ja wieder«, versprachen sie, »wie gern kommen wir wieder!«
Lotte winkte ihnen nach, und dann sagte sie zu Liesl: »Jetzt wird es wieder still bei uns, Liesl, aber es war eine schöne Zeit, von der man zehren kann.«
»Und wiederkommen tun s’ auch«, meinte Liesl. »Ja, wie eine ganz richtige Familie kommt es einem schon vor.«
Ja, so war es Lotte auch, und nie zuvor in ihrem Leben hatte sie sich so glücklich gefühlt. Gleich sollte es auch Dr. Norden erfahren, daß er ihr das Glück ins Haus geschickt hatte, und daß er sich darüber freute, brauchte nicht extra betont zu werden.
Er mußte in diesem Zusammenhang an Victor denken, denn auf der Fahrt zu ihm hatte er Claudia und den kleinen Danny kennengelernt, dann hatte er ihrem Mann helfen können, und nun hatte dadurch auch Lotte Rimmel so viel Freude erfahren.
Zur rechten Zeit war Victors Geld auch Tina zugute gekommen, und wiederum war ein weiterer Mensch glücklich geworden. Jonathan Tucker! Wie er sich wohl auf der Insel der Hoffnung fühlte, wie sehr er die Zeit mit Tina genoß, wußten die Nordens bereits von ihren Lieben, und Daniel war nun sehr gespannt, alles über diese großartige Operation zu erfahren. So bald wie möglich wollte er ein Wochenende mit seiner Familie auf der Insel verbringen.
Den kommenden Sonntag hatten allerdings auch die Mainhards für ihren Besuch eingeplant. Sabine hatte ihr Haus wieder in Ordnung gebracht, alles blitzte, wie sie es haben wollte. Berge von Wäsche waren gewaschen und gebügelt. Axel und Kathrin waren von Jonathan mit neuer Kleidung reichlich versorgt worden und ließen sich von den anderen Kindern wegen der duften Pullover bestaunen.
Mit etwas gemischten Gefühlen rief Manfred bei Jochen Burger an und war überrascht, daß dieser ihn gleich mit einem erleichterten Wortschwall überfiel. Eigentlich hatte er ihm nur sagen wollen, daß er das Manuskript zurückziehen wolle, doch dazu kam er gar nicht. Jochen bat ihn dringendst um seinen baldigen Besuch.
Es war ihm dann auch lieber, ihm die Gründe für seinen Entschluß persönlich mitzuteilen, denn verderben mochte er es mit Burger keinesfalls. Er war plötzlich so voller Ideen, so ganz anders als früher, und für ihn war das Schreiben ja nicht nur Lebenszweck, vor allem nicht des Verdienstes wegen, sondern einfach ein Bedürfnis, ja, ein innerer Zwang.
»Ja, ich werde dann morgen nach München fahren«, erklärt er seiner Frau. »Es scheint so, als käme jetzt noch mehr in Schwung, Sabine.«
»Das wäre schön, Manni, aber wir müssen auch daran denken, was mit Victors Geld geschehen soll.«
»Wir werden es in aller Ruhe durchdenken, Liebes. Es trägt ja inzwischen Zinsen«, erwiderte er.
»Und dann müssen wir auch Ausschau halten, ob es in der Nähe nicht ein hübsches Häuschen gibt oder ein schönes Grundstück.«
»Das wollen wir doch lieber mit Jonathan besprechen«, meinte er. »Alles hübsch der Reihe nach.«
*
Der nächste Tag brachte ihm dann so viel Lob und Anerkennung wie nie zuvor, und es fiel ihm nicht leicht, Jochen Burger eine Enttäuschung bereiten zu müssen. Doch seinen Argumenten konnte sich Jochen nicht verschließen.
»Ich habe einen anderen Roman angefangen«, sagte Manfred, »und er ist auch schon ganz hübsch weit gediehen. Vielleicht interessieren Sie sich dafür.«
»Aber ganz gewiß«, erwiderte Jochen. »Und vielleicht denken Sie einmal darüber nach, Ihre Geschichte umzuschreiben in die dritte Person. Ein bißchen was verändern, so daß man keine Rückschlüsse auf das Leben des Autoren schließen kann, und dazu einen Schluß, der keine bangen Fragen offenläßt, der positive Aussage ist und anderen Kranken Hoffnung gibt. Wäre das nicht eine Anregung?«
»Nicht von der Hand zu weisen, aber ein wenig Abstand brauche ich dazu schon noch.«
»Ich verstehe Sie sehr gut. Ich freue mich, daß Ihre kleine Tochter ganz gesund wird, Herr Mainhard. Ich habe viel an Sie gedacht. Ja, Sie haben uns in ganz bestimmter Weise sehr geholfen.«
»Wieso?« fragte Manfred verblüfft.
»Man könnte fast sagen, daß Sie einen Knoten durchschlagen haben. Wir alle, meine Frau, mein Onkel und ich, vielleicht sogar unsere Evi waren so verstrickt darin, einander auszuweichen, nicht merken zu lassen, wie nahe uns Evis Schicksal ging, daß wir uns voneinander entfernten, anstatt mehr zusammenzuhalten. Aber durch das Schicksal Ihrer Tina ist es uns bewußt geworden, was es für ein Kind bedeutet, als wichtiges Glied in einer Familie betrachtet zu werden, auch wenn es ein Leiden hat. Mit Mitleid kann man niemandem helfen, das ist uns sehr bewußt geworden. Und es ist völlig falsch, Evi abzuschirmen. Wir wissen jetzt, daß sie an allem teilnehmen will. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie und Ihre Familie uns bald besuchen würden. Und mein Onkel möchte Sie sehr gern persönlich kennenlernen. Ich habe mir gedacht, daß Ihre Tina, so, wie Sie das Kind geschildert haben, unserer Evi sehr viel geben könnte. Es ist eine Bitte, Herr Mainhard.«
»Die selbstverständlich und gern erfüllt wird, aber Tina ist zur Zeit mit Professor Tucker auf der Insel der Hoffnung.«
»Der Arzt, der die Operation durchführte?« fragte Jochen Burger baß erstaunt.
»Ja, und er ist uns allen ein so guter Freund geworden, daß wir fast sagen möchten, er gehört jetzt zur Familie. Seine besondere Zuneigung gehört natürlich Tina, und sie erwidert diese ebenso. Als ich vor Wochen bei Ihnen war, konnte ich nicht ahnen, wie glückverheißend alles weitergehen würde. Da hatte ich nur Angst, daß es zu spät sein könnte für Tina.«
»Das habe ich aus Ihrem Manuskript herausgelesen, und deshalb denke ich auch, daß sie vielen Verzweifelten helfen und sie auf einen besseren Weg führen können, Herr Mainhard.«
»Daran dachte ich eigentlich nicht, als ich das niederschrieb. Ich wollte mich nur befreien von den quälenden Gedanken, und ich wollte auch selbst den Mut nicht verlieren.«
»Sie konnten an nichts anderes denken als an Tina«, sagte Jochen Burger. »Sie schrieben Sachbücher, weil Sie Ihre Gefühle im Zaum halten wollten. Ich verstehe Sie sehr gut. Aber nun sind Sie befreit und werden keine Sachbücher mehr schreiben, sondern hoffentlich viele schöne Romane.«
»Nun, wir wollen erst mal sehen, wie der erste ankommt«, sagte Manfred.
»Haben Sie schon eine Leseprobe mitgebracht?«
»Nein«, erwiderte Manfred. »Ich dachte, Sie würden schockiert sein, wenn ich das Manuskript zurückziehe.«
»Jetzt wissen Sie genau, was ich denke. Wir werden uns schon einig werden. Wann können wir uns in privater Runde zusammensetzen? Vielleicht schon am Samstag oder Sonntag?«
»Am Sonntag wollen wir Tina und Jonathan auf der Insel besuchen.«
»Dann kommen Sie doch Samstag«, bat Jochen. »Bereiten Sie Ihre Kinder nur bitte vor, daß Evi nicht ganz mit ihnen Schritt halten kann. Geistig schon, körperlich nicht.«
»Unsere Kinder sind nicht brutal«, sagte Manfred.
»Wie könnte es anders sein bei solchem Vater.«
»Meine Frau bitte nicht zu vergessen«, sagte Manfred rasch.
»Sie wird sich mit meiner Frau gewiß sehr gut verstehen. Wir treffen uns dann bei meinem Onkel. Bis dahin haben Sie es nicht weit. Es sind genau zwölf Minuten mit dem Auto.«
»Woher wissen Sie das so genau?« staunte Manfred.
»Weil ich die Strecke gefahren bin. Ich wollte Sie aufsuchen, aber eine mitteilsame Nachbarin sagte mir, daß Sie mit Familie in Kanada wären. Da dachte ich mir, daß Sie vielleicht in der Lotterie gewonnen hätten und das Schreiben ganz aufgeben«, scherzte Jochen Burger.
»Das Schreiben würde ich niemals aufgeben. Aber gerade da hatte meine Frau eine ganz unerwartete Erbschaft gemacht.«
»Zur rechten Zeit«, sagte Jochen Burger. »Und wie ein Unglück selten allein kommt, zieht auch ein Glück meist ein anderes nach.«
»Ja, das kann man sagen. Zuerst läuft alles so dahin, dann schüttet Fortuna ihr Glückshorn aus.«
»Jedem, wie er es verdient«, sagte Jochen. »Bis Samstag also. Wir freuen uns.«
*
Manfred zupfte sich erst mal an den Ohrläppchen, ob das auch Wirklichkeit sei und nicht nur ein Traum. So tat es Tina immer, wenn sie sich eines schönen Erlebens nicht ganz sicher gewesen war.
Am Samstag bei Franz Burger persönlich, murmelte er vor sich hin, und fast wäre er mit einem sehr gewichtigen Mann zusammengestoßen.
»Aufpassen«, sagte der gereizt.
»Gleichfalls«, erwiderte Manfred da schlagfertig, da er sich dicht an einem Schaufenster wiederfand. Der Dicke trabte brummig weiter, aber Manfred blickte in das Schaufenster, und da blitzte und funkelte es. Ringe, Uhren, Ketten und Anhänger präsentierten sich.
Und Manfred dachte, daß er Sabine nie ein kostbares Schmuckstück geschenkt hatte, nicht hatte schenken können, weil sie beide ja immer an Sparen dachten. Doch wie lange hätte es noch gedauert, bis sie das Geld für Tinas Operation beisammen gehabt hätten.
Jetzt aber hatte sich doch ein ganz nettes Sümmchen auf dem Sparkonto angesammelt, und warum sollte er nun nicht mal Sabine mit einem Geschenk überraschen? Es mußte ja nicht gerade eins von den ganz teuren Dingen sein.
Die hübsche Uhr vielleicht, die goldene mit den kleinen Brillanten? Wann soll ich die wohl tragen, vermeinte er Sabines Stimme zu hören. Und so entschied er sich für eine Halskette mit einem Brillantanhänger. Sie gefiel ihm, und die würde sie beim Arbeiten nicht behindern, denn sie sollte ja etwas haben, was sie immer tragen könnte.
Für die Kinder nahm er ein Spiel mit und Süßigkeiten. Und was sie Tina mitbringen wollten bei ihrem Besuch, wollte er lieber mit Sabine gemeinsam entscheiden.
Sie schnappte erst mal nach Luft, als er ihr die Kette um den Hals legte.
»Bist du übergeschnappt, Manni?« ächzte sie. »Wir brauchen Öl, und das ist verflixt teuer.«
»Wir sind am Samstag bei Franz Burger eingeladen, und da mußt du wenigstens ein hübsches Kettchen an deinem hübschen Hals tragen«, scherzte er.
»Bei Franz Burger?« fragte sie fassungslos.
»Es geht aufwärts, Liebes. Vielleicht bekommst du eines Tages doch noch einen berühmten Mann.«
»Ich habe meinen Mann, und ob er berühmt ist oder nicht, tangiert mich nicht«, sagte sie zärtlich. »Und er braucht auch kein Vermögen für mich auszugeben.«
»Und das sagt eine Frau, die einen Millionär beerbt hat«, sagte Manfred nachdenklich.
»Der mit seinem Geld auch nicht glücklich wurde«, meinte sie.
»Aber dankbar müssen wir ihm schon sein«, fuhr sie leise fort. »Es ist grad so, als würde er als Schutzengel da droben über uns wachen.«
»Es ist gut, daß du jetzt so denkst, Sabine. Vielleicht hat er seine Krankheit als Strafe empfunden, und sie war doch nichts anderes, als ein unausweichliches Schicksal. Ihm konnte kein Arzt helfen und für einen, der selbst Arzt war, muß das wohl besonders schlimm gewesen sein.«
*
Für sie aber zählte das Leben und die Freude. Vorbereitet auf Evis Behinderung, schienen Axel und Kathrin diese gar nicht wahrzunehmen. Die Kinder spielten im Garten, während die Erwachsenen sich angeregt unterhielten. Und auch hier bahnte sich eine freundschaftliche Beziehung an.
Zwei Mütter unterhielten sich über ihre Kinder, und sie lauschten, wenn helles Lachen zu ihnen empordrang.
»So habe ich Evi noch nie lachen hören«, sagte Gundi Burger. »Axel und Kathrin verstehen es aber auch ganz reizend, mit ihr zu spielen.«
»Sie ist auch ein reizendes Kind, Frau Burger«, sagte Sabine. Und da kam Evi angelaufen. »Ich habe einen Ball gefangen, Mami«, rief sie jauchzend. »Richtig gefangen. Schau doch mal.«
Gundis Augen wurden naß, aber es waren Tränen der Freude, die emporstiegen.
»Axel und Kathrin dürfen doch oft kommen, Mami?« fragte Evi bittend.
»Du kannst aber auch zu uns kommen, Evi«, sagte Sabine.
»Bei uns ist es schön, nur nicht so fein«, sagte Axel, und damit hatte er die Lacher auf seiner Seite. Auch die Männer stimmten ein.
So schön, so unbeschwert konnte das Leben sein, hier, an diesem Tage, wie auch am nächsten auf der Insel der Hoffnung. Da wurde auch von Evi erzählt, und Manfreds beruflichen Plänen und auch von denen Jonathans, die nun schon ganz konkret festgelegt wurden.
»Wir haben uns überlegt, daß unser Grundstück groß genug ist, um noch ein Haus hineinzustellen, Jonathan«, sagte Sabine, denn Manfred hatte es für gut befunden, daß der Vorschlag von ihr kommen würde. »Wenn du einverstanden bist, kann ein Haus für dich und Harriet dort hineingebaut werden. Manfred war schon beim Amt und hat sich erkundigt. Es wird keine Schwierigkeiten geben. Wenn du einverstanden bist…« Sie kam gar nicht weiter, denn er sprang auf und umarmte sie.
»Wann wird es fertig sein können?« fragte er.
»Nächstes Jahr im Herbst, aber ihr dürft ruhig schon im Sommer kommen«, sagte Manfred. »Dann rücken wir für ein paar Wochen enger zusammen.«
»Ist das wirklich wahr?« fragte Tina bebend vor Freude.
»Es liegt nur an Jonathan«, sagte Sabine. »Vielleicht gibt es hier einen Architekten, der die Pläne machen kann.«
»Wir haben uns schon aus einem Katalog ein schönes Fertighaus ausgesucht«, sagte Tina. »Das geht ganz schnell, wenn man ein Grundstück hat, und das haben wir ja. Und dann wären wir immer beisammen. Jonathan kann seine Memoiren schreiben und Papi seine Bücher.«
»Und einen Verleger haben wir auch schon«, lachte Manfred. »Da kann ja nichts mehr passieren.«
Hoffentlich nicht, dachte Sabine, denn daß alles glattgehen könnte fortan in ihrem Leben, daran konnte sie noch gar nicht glauben.
Aber es ging glatt, wenngleich sie sich nun auch der Macht des Geldes bewußt werden sollten. Eine große Spende für den Kindergarten, der schon lange gebaut werden sollte, und für den die Mittel fehlten, trug dazu bei, wie auch eine weitere Spende für das Altersheim, und dann auch noch für einen Notarztwagen. Pingelig war man nicht auf der Gemeinde, als man geschnuppert hatte, daß die Mainhards viel für die Wohltätigkeit übrig hatten, viel mehr als jene, die in den prächtigen Villen wohnten. Aber es war ja Victors Geld, was sie dafür gaben. Es sollte Segen spenden, und auch Jonathan wollte sich nicht lumpen lassen. Er dachte jetzt nicht mehr so wehmütig an den Abschied, der immer näherrückte, er dachte schon vielmehr an das Wiedersehen im nächsten Jahr.
Mit Daniel Norden und Johannes Cornelius hatte er noch ein langes Gespräch geführt über die Operation, aber als Daniel sagte, daß man ihm hier nicht viel Ruhe gönnen würde, wenn es erst bekannt wurde, daß er seinen Wohnsitz bei München nehmen würde, schüttelte er den Kopf.
»Wenn man mich mal als Berater braucht, stehe ich in einem besonderen Fall schon zur Verfügung, aber das Skalpell nehme ich dann nicht mehr in die Hand. Nur noch den Federhalter. Da ist es nicht so schlimm, wenn man einmal zittert.«
*
Das Jahr ging dahin. Es wurde gebaut, und es gab viel Krach, aber der machte selbst Manfred nichts aus. Er schrieb bereits an seinem zweiten Roman und der erste, generös honoriert von Franz Burger, sollte dann auf den Markt kommen, wenn Jonathan und Harriet eintrafen. So richtig zur Begrüßung, wie Tina meinte, die lange Briefe an Jonathan schrieb, die mit langen Telefongesprächen beantwortet wurden.
Oft waren sie mit Evi beisammen, und wie es sich Jochen und Gundi Burger ersehnt hatten, war Tina die richtige Freundin für Evi geworden. Kind unter lieben Kindern zu sein, war für das kleine Mädchen die beste Lebenshilfe. Sie fand sich schnell zurecht in einer Welt, die so vielen anderen verschlossen blieb, denen nicht soviel Verständnis und Zuneigung entgegengebracht wurde. Sie war es, die dann ihren Eltern sagte, wie schön es doch wäre, wenn sie auch ein Geschwisterchen hätte. Sie wäre doch nun schon groß und könne vieles selbst tun. Und so überwand Gundi auch diesen Schatten, der so viele Jahre ihr Leben begleitet hatte. Evi war in eine größere, in eine liebevolle Welt hineingewachsen. Es schien auch fast, als hätten ihre Ärmchen sich gestreckt, weil sie viel beweglicher geworden waren. Sie lernte schreiben, sie konnte Gabel und Löffel selbst zum Mund führen, und es war kein Zufall mehr, wenn sie Bälle auffing.
Als der Frühling kam, stellte sich bei den Fiebigs Nachwuchs ein, und das war für Lotte Rimmel ein Grund, wieder einmal in die Stadt zu fahren und auch Dr. Norden aufzusuchen. Sie brachte ihm eine wunderschöne holzgeschnitzte Madonna, die sehr kostbar und schon dreihundert Jahre im Besitz ihrer Familie war.
»Ich weiß, daß Sie so etwas mögen«, sagte sie, »und ich habe dafür lebendiges Glück geschenkt bekommen. Martin hat seine Versetzung durchgedrückt, und er klettert sogar eine Stufe hinauf. Die Kinder können bei mir wohnen, viel weiter hat er es auch nicht zur Kreisstadt, als hier bis zum Amt. Und er kann sein Hobby pflegen. Jetzt brauch’ ich keine Feriengäste mehr, lieber Dr. Norden, aber ein herzliches Vergelt’s Gott möcht’ ich doch sagen, daß Sie mir dazu verholfen haben.« Und dann hatte sie es schrecklich eilig, in die Leitner-Klinik zu kommen, wo sie schon von Martin und Danny erwartet wurde. Und bald darauf konnten sie auch die kleine Charlotte anschauen, die lauthals ihr Erdendasein ankündigte.
»So ein Püppchen, so ein liebes Püppchen«, stammelte Tante Lotte, als sie das Baby im Arm halten durfte, und Tränen der Freude rannen über ihre Wangen.
*
Viel Liebe, viel Glück, das galt auch für die Mainhards an jenem Augusttag, als sie am Flughafen standen und voller Ungeduld auf die Ankunft der Maschine warteten, die Jonathan und Harriet bringen sollte.
»Jonathan wird mächtig staunen, daß das Haus schon fertig ist«, sagte Axel.
»Da hat Papi aber auch Dampf gemacht«, meinte Kathrin.
Tina sagte nichts. Ihre Daumen drückten sich fest in die Handflächen, wie damals vor der Operation. Und sie lösten sich erst, als die Maschine gelandet war. Zu einem bildhübschen Teenager mauserte sie sich jetzt, aber als dann Jonathan sichtbar wurde, war sie wieder das überglückliche kleine Mädchen, das sich ungestüm den Weg bahnte, um ihm an den Hals zu fliegen.
»Endlich«, sagte er nur heiser und drückte sie an sich.
»Es ist überstanden«, sagte Harriet trocken, als sie Axel und Kathrin in die Arme nahm. »Der Jonathan hat mich bald geschafft, bis wir endlich Boden unter den Füßen hatten. Ich muß schon sagen, das war das längste Jahr, seit ich ihn kenne, aber meinetwegen können die Jahre jetzt vierundzwanzig Monate haben.«
Die Zeit würde sich nicht aufhalten lassen. Die Uhren würden ihre Zeiger drehen wie eh und je, aber nun waren sie beisammen, und es gab keinen Abschied mehr.
»Ich spiel jetzt sogar Tennis, Jona-than«, sagte Tina, »und es macht mir gar nichts aus.«
»Na, dann fange ich auch noch mal an«, meinte er.
»Und Maschinenschreiben kann ich auch schon ganz gut, damit ich deine Memoiren abtippen kann«, sage Tina.
»Den Sommer wollen wir aber erst genießen«, meinte er verschmitzt. »Hier sind doch jetzt Ferien. Ich hab’ es nicht vergessen. – Und was sehe ich da?« rief er aus und steuerte auf den Bücherstand zu. Ganz weit waren seine Augen geworden, als er den Buchtitel las. Unser Jonathan, lautete der.
»Von Manfred Mainhard«, raunte ihm Tina zu.
»Das muß ich mir kaufen«, brummte Jonathan.
»Du bekommst eins geschenkt, Jonathan«, meinte Manfred.
»Das könnte dir so passen. Wenn man mir schon zu Lebzeiten ein Denkmal setzt, gebe ich mein Scherflein auch dazu.«
»Du weißt ja gar nicht, was drin steht«, meinte Manfred hintergründig.
»Mich kennt hier ja keiner«, lachte Jonathan. »Und wer weiß, ob ein Buch gekauft wird. Wer schaut denn schon auf so einen Titel. Da hätte ich mir was anderes ausgedacht. Aber eins hast du wenigstens verkauft, Manfred. Und ich werde es sogar gleich lesen.«
»Zuerst schaust du dir aber dein Haus an, Jonathan«, sagte Sabine.
Das war dann die nächste Überraschung für ihn und Harriet, denn es wartete schon, geschmackvoll eingerichtet und mit Blumensträußen in jedem Zimmer. Eine Blumengirlande hatten die Kinder geflochten. Willkommen zu Hause stand darin.
»Was sagst du nun, Harriet?« brummte Jonathan gerührt.
»Jetzt wissen wir, wohin wir gehören«, sagte sie leise.
»Und ich sage gar nichts mehr, nur danke«, murmelte Jonathan.
Schon wenige Monate später konnten sie den Erfolg von Manfreds Buch feiern. Da waren sie in Jonathans Haus versammelt, die Burgers, die Nordens und die Mainhards.
»Wenn ich wirklich so wäre, wie Manfred mich geschildert hat, müßte ich mit einem Heiligenschein einherwandeln«, brummte Jonathan.
»Der begleitet so manchen unsichtbar«, sagte Daniel voller Wärme.
»Dann lassen wir mal die Gläser klingen auf unseren Jonathan«, sagte Sabine.
»Aber bitte auch auf unsere Tina und euch alle«, sagte Jonathan. »Aber eigentlich ist es doch üblich, daß der Autor geehrt wird.«
»Der ist nichts ohne Inspiration«, wehrte Manfred ab. Er nahm Sabine in den Arm. »Wir haben allen zu danken, die hier versammelt sind.«
»Wir aber auch«, sagten Jochen und Gundi Burger wie aus einem Mund. »Das nächste große Fest findet bei uns statt, anläßlich der Taufe unseres zweiten Kindes.«
Die wurde sechs Monate später gefeiert, und Evis kerngesundes Brüderchen wurde auf den Namen Jochen Jonathan Franz getauft.
»Ich sag’ einfach Jojo zu ihm«, meinte Evi tiefsinnig. »Meinst du, Tina, daß ich ihn auch mal in die Arme nehmen kann?«
»Du kannst es bestimmt, Evi«, sagte Tina. »Man kann alles, was man von Herzen will. Aber die Hauptsache ist, daß du ihn liebhast.«