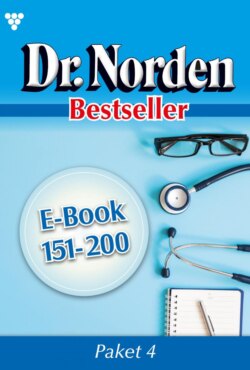Читать книгу Dr. Norden Bestseller Paket 4 – Arztroman - Patricia Vandenberg - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеDie Grippe grassierte wieder mal, und so brauchte es Dr. Norden nicht zu wundern, daß er dringend zu Dr. Stahl gerufen wurde, dessen Sohn Tobias besonders anfällig für Infektionskrankheiten war.
Zu ihm fuhr der Arzt auch sofort, und als er vor dem hübschen Reihenhaus hielt, stand der Chefingenieur der Stahlwerke auch schon in der Tür.
»Gott sei Dank, daß Sie so schnell kommen, Dr. Norden. Diesmal ist es wieder besonders schlimm«, sagte der hochgewachsene, breitschultrige Mann. »Toby hat 39,8 Fieber. Ich habe es gerade noch mal gemessen.«
»Sind Sie wieder mal allein?« erkundigte sich Dr. Norden bestürzt.
»Wir reden nachher darüber«, erwiderte Jochen Stahl mit einem tiefen Seufzer. »Zuerst kommt Toby.«
Dr. Norden hatte sich schon manchmal gefragt, wie dieser starke Mann zu einem so zarten Sohn kam, aber als Marianne Stahl dann vor einem Jahr an einer schweren Nierenkrankheit gestorben war, kam ihm doch der Gedanke, daß der zehnjährige Tobias schon von Geburt an belastet sein könnte, obgleich sich nur die Anfälligkeit für Erkältungskrankheiten bei ihm wiederholte.
Aus einem fieberheißen Gesichtchen blickten Dr. Norden etwas trübe dunkle Augen an. »Hallo, Doktor«, sagte der Junge heiser, »wieder mal das Theater. Warum muß es immer mich erwischen? Papi regt sich auf.«
»Das haben wir bald wieder im Griff, Toby«, sagte Dr. Norden. »Wer hat dich denn diesmal angesteckt?«
»Die blöde Lisa. Ich bin froh, daß sie weg ist.«
Also wieder mal, dachte Dr. Norden, denn lange blieb eine Haushälterin nie bei Dr. Jochen Stahl.
Lisa war schon die fünfte innerhalb eines Jahres. An wem mochte es wohl liegen, daß es keine aushielt? An dem Jungen oder an Dr. Stahl? Solche Gedanken gingen ihm durch den Kopf, während er Tobias untersuchte.
Es war nicht so schlimm, wie er gefürchtet hatte. Tobias bekam nur immer gleich so hohes Fieber. Die Lungen waren nicht betroffen, auch die Mandeln waren nicht entzündet. Und Dr. Norden kannte den Jungen nun schon zwei Jahre und wußte genau, auf welche Medikamente er ansprach.
»Morgen ist es schon wieder besser«, sagte er tröstend. »Du schläfst jetzt schön, Toby, und morgen früh schaue ich nach dir.«
»Ich reg’ mich nur auf, weil Papi bald weg muß«, wisperte der kleine Patient. »Aber das brauchen Sie ihm nicht sagen.« Er verstummte sofort, als sein Vater wieder ins Zimmer trat.
»Ist nicht so schlimm, Papia, murmelte er. »Ich schlafe jetzt.«
»Wenn du etwas brauchst, kannst du mich rufen, Tobya, sagte Jochen Stahl. Er strich dem Jungen das feuchte Haar aus der Stirn und küßte ihn auf die Wange. »Werd nur bald gesund, mein Kleiner.«
Als er dann aber Dr. Norden in die Augen blickte, war seine Miene düster.
»Ich muß Anfang nächsten Monats für sechs Wochen nach Ägypten, Dr. Norden. Ich kann mich nicht drücken. Es ist zu wichtig für unsere Firma. Was soll ich nur mit Toby machen? Ich kann ihn doch nicht mitnehmen.«
»Auf keinen Fall«, sagte Dr. Norden rasch. »Aber da fangen doch die Ferien an. Sie könnten ihn in ein Heim geben.«
Dr. Stahls Miene verdüsterte sich noch mehr. »Und gerade das wollte ich vermeiden«, sagte er tonlos. »Wir haben ihn doch aus einem Heim geholt.«
Dr. Norden sah ihn fassungslos an. »Toby ist nicht Ihr Kind?« fragte er. Warum haben Sie mir das noch nicht gesagt?«
»Er ist mein Kind«, sagte Dr. Stahl ruhig. »Ich liebe ihn über alles. Ich habe gedacht, Marianne würde ihre Depressionen überwinden, wenn sie das Kind hätte, aber ich wußte lange nicht, daß ihr Leiden auch organischer Natur war. Leider sind wir da anscheinend immer an die falschen Ärzte geraten, die uns keine Aufklärung gaben. Sie wissen, daß meine Frau an Urämie starb. Die Depressionen waren nur Nebenerscheinungen. Als wir Tobias adoptierten, war sie glücklich. Für mich spielt es keine Rolle, wer seine Eltern waren. Ich könnte ein eigenes Kind nicht mehr lieben als ihn. Aber ich habe eben leider auch einen Beruf, und außerdem bekommt man keine Hilfe, der man ein so sensibles Kind wirklich anvertrauen kann. Diese Weiber denken immer nur daran, sich bei einem Witwer ein angenehmes Leben zu verschaffen oder ihn gar aufs Standesamt schleppen zu können. Bitte, seien Sie nicht böse, wenn ich das so drastisch sage, aber leider habe ich es nun oft genug mitgemacht. Die letzte, diese Lisa, war besonders schlimm. Als sie merkte, daß sie nicht bei mir landen konnte, hustete sie den Jungen buchstäblich an. Ich würde das wahrscheinlich nicht so deutlich sagen, wenn ich nicht solche Wut im Bauch hätte.«
»Sprechen Sie sich ruhig aus, für den Hausarzt ist das wirklich ganz interessant«, sagte Dr. Norden. »Wenn ich schon vorher gewußt hätte, daß Tobias ein adoptiertes Kind ist, hätte ich nicht an mir selbst zweifeln müssen.«
»Wie meinen Sie das?« fragte Dr. Stahl erstaunt.
Dr. Norden betrachtete ihn, sein kluges, interessantes Gesicht, das eine große Willenstärke verriet, die dunklen Augen, die einen fast melancholischen Ausdruck hatten, den Mund, der das Lachen verlernt zu haben schien.
»Ich habe Tobias auf Herz und Nieren untersucht, wie man so sagt. Er hat kein organisches Leiden«, erklärte Dr. Norden. »So habe ich immer überlegt, woher diese Überempfindlichkeit kommt.«
»Weil er diese Weiber nicht ausstehen konnte«, sagte Jochen Stahl. »Mir ist das jetzt klargeworden. Ich bin kein Frauenverächter, Dr. Norden, aber anscheinend gerate ich immer an die Falschen und Toby hat mehr Instinkt als ich. Das nächste Mal soll er die Haushälterin aussuchen. Aber vorerst muß ich den Jungen irgendwo unterbringen, wo er bestens versorgt wird.«
»Dabei kann ich Ihnen behilflich sein«, sagte Dr. Norden. »Es gibt mehrere Heime, die mir bekannt sind.«
»Dann sagen Sie mir das allerbeste. Ich will es mir anschauen, bevor ich für Wochen von hier weg und mich von dem Jungen trennen muß.«
Dr. Norden überlegte. »Da Toby Höhenluft gut tun würde, könnte ich den Tannenhof vorschlagen. Es fragt sich nur, ob man dort noch Platz hat. Wenn es Ihnen recht ist, rufe ich morgen an. Es ist das beste Heim, allerdings auch das teuerste.«
»Das ist nebensächlich«, sagte Dr. Stahl. »Und noch eins, Dr. Norden, Toby darf nie erfahren, daß er ein adoptiertes Kind ist. Er darf nie daran zweifeln, daß ich sein Vater bin. Sie können mich für sentimental halten, aber dieses Kind bedeutet mir alles.«
»Von mir wird er es bestimmt nicht erfahren, daß er nicht Ihr Kind ist«, sagte Dr. Norden, aber als er nach Hause fuhr, kam ihm der Gedanke, ob Tobias nicht doch Jochen Stahls Sohn sein könnte. Gab es denn das, daß ein Mann ein fremdes Kind so lieben konnte? Ein Mann, wie dieser Jochen Stahl?
Doch an diesem Tag konnte Dr. Norden noch nicht ahnen, wie aufregend sich Dr. Jochen Stahls und seines Sohnes Tobias Leben noch gestalten sollte.
*
»Ruf doch bitte morgen mal im Tannenhof an, Fee«, bat Daniel Norden seine Frau. »Du kommst mit Mutter Hedwig am besten zurecht.«
»Wenn du mir sagen würdest, worum es geht, mein Schatz?« fragte Fee mit einem nachsichtigen Lächeln.
»Um Tobias Stahl. Sein Vater muß für sechs Wochen ins Ausland.«
»Ist ihm die Haushälterin schon wieder mal davongelaufen?« fragte Fee.
»Du hast es erfaßt, Feelein.«
»Woran mag das nur liegen?« meinte sie schelmisch.
»Wahrscheinlich weißt du das auch besser als ich«, erwiderte Daniel nachdenklich.
»Ein gutaussehender Mann in bester Position und in den besten Jahren«, sagte sie. »Da sind die Interessen gewisser Frauen sehr einseitig.«
»Es scheint so. Er ist ein sympathischer Mann. Die nächste Hausdame wird er von Tobias aussuchen lassen.«
Fee lachte leise. »Ich finde es besonders sympathisch, daß er auf die Meinung seines Sohnes etwas gibt.«
»Nur auf seine«, bemerkte Daniel, aber er war diesmal nicht bereit, Fee zu sagen, daß Tobias ein adoptiertes Kind war. Er hielt sich an sein Wort. »Er würde den Jungen auch mitnehmen, aber Ägypten wäre bestimmt nicht das richtige Klima für Tobias.«
»Ägypten könnte mich auch interessieren«, bemerkte Fee.
»Könntest du nicht mit der Tutanchamon-Ausstellung vorliebnehmen?« fragte er lächelnd.
»Nur, wenn du mitkommst!«
»Soll ich mich stundenlang anstellen? Liebe Güte, mute mir das nicht zu. Ich bin wohl ein Kunstbanause, Fee. Abgesehen von Musik. In ein Konzert könnten wir mal wieder gehen.«
»Ich werde mich bemühen, Karten zu bekommen. Hoffentlich hast du dann aber auch Zeit«, sagte sie gleichmütig. »Also keine Aussicht, mal nach Ägypten zu reisen?«
»Wenn du unbedingt willst«, seufzte er.
»Es muß nicht sein. Die Einladungen nach Amerika, England, Frankreich, Spanien und Schweden stapeln sich schon. Aber es ist abzusehen, daß ich liebe Dankesbriefe schreiben und der Hoffnung Ausdruck geben muß, daß man sich in München mal wiedersieht. Dann werde ich also morgen Mutter Hedwig anrufen, damit Tobias gut untergebracht wird.«
Und sie tat es. Da konnte Fee dann auch große Freude erleben, denn Hedwig Scheibele, die im Tannenhof Mutter Hedwig genannt wurde, gehörte zu Dr. Nordens dankbarsten Patientinnen. Durch ihn war die ehemals schilddrüsenkranke Frau gesund geworden und hatte diese Lebensstellung gefunden, in der sie aufging. Und wenn sie etwas für Dr. Norden tun konnte, tat sie es auch.
»Wir richten das schon ein, Frau Doktor«, bekam Fee zur Antwort auf ihre Bitte. »Sagen Sie mir nur Bescheid, wann der Junge kommt.«
*
Das konnte Dr. Norden dann Jochen Stahl berichten. »Wenn nur Toby einverstanden ist«, seufzte der. »Das ist meine größte Sorge.«
»Ich erkläre es ihm«, sagte Dr. Norden, und wieder emmal konnte er beweisen, wie gut er mit Kindern umzugehen verstand.
»Heute geht es ja schon wieder viel besser, Toby«, begann er.
»Jetzt brauche ich mich auch nicht mehr über Lisa aufzuregen«, flüsterte der Junge, aber dabei schielte er immer zur Tür.
»Wir können uns allein unterhalten. Dein Papi muß noch dringende Telefonate erledigen«, erklärte Daniel Norden. »Gestern hast du gesagt, daß es dich aufregt, weil dein Papi wegfahren muß. Aber das muß nun mal sein, Toby. Es ist sein Beruf, dort die Aufsicht zu führen, wo etwas Wichtiges gebaut wird. Ich meine, du kannst stolz sein, daß er das Vertrauen des obersten Chefs genießt.«
»Ich bin auch stolz auf meinen Papi. Aber ich kann doch nicht allein hierbleiben, und wenn er mich mitnimmt und ich dort krank werde, ist es auch schlimm für ihn.«
»Darf ich dir mal einen Vorschlag machen, Toby?« fragte Dr. Norden väterlich.
»Bloß nicht wieder so ’ne Hausdame!« stöhnte der Junge.
»Nein, keine Hausdame. Ich weiß ein sehr hübsches Kindererholungsheim. Es ist ein richtiges Schloß, und Mutter Hedwig ist eine gute Bekannte von mir.
Da sind nur nette Kinder, die alle oft mal krank sind. Die Luftveränderung würde dir auch sehr gut tun, und wenn dein Papi dann wieder zurückkommt, bist du quietschvergnügt und darfst dir selbst aussuchen, wer Hausdame bei euch werden soll.«
»Ich darf selbst eine für uns suchen?« fragte Toby ganz aufgeregt. »Die Linda kommt bestimmt nicht ins Haus?«
»Welche Linda?« fragte Dr. Norden aufhorchend.
»Papis Sekretärin, die Linda Krauss. Die macht ihm doch auch schöne Augen. Ich bin doch nicht mehr doof«, sagte Toby.
Dr. Norden verkniff sich ein Lachen. Er freute sich, daß der Junge wieder so munter war und außerdem auch darüber, daß er Augen und Ohren anscheinend doch ganz auf dem rechten Fleck hatte.
»Dein Papi hat mir gesagt, daß er es dir überläßt, eine Haushälterin zu suchen«, erklärte er.
»Eine Hausdame«, sagte Toby, »aber es muß eine richtige Dame sein, nicht eine, die im Bademantel herumscharwenzelt, wenn Papi aufsteht. Das mag ich nämlich gar nicht.«
»Mir gefällt so was auch nicht«, sagte Daniel. »Na, wie wäre es, wenn du dich im Tannenhof mal richtig erholen würdest? Mutter Hedwig ist eine feine ältere Dame, es ist wunderschön dort. Du wirst es sechs Wochen leicht aushalten, vielleicht gar nicht mehr wegwollen.«
»Ich bin aber lieber bei Papi, als im schönsten Heim«, sagte Toby. »Aber wenn Sie es meinen, gehe ich dahin, Doktor.«
»Du bist sehr vernünftig, Toby«, wurde er gelobt. »Dein Papi wird beruhigt sein. Er will doch nur das Beste für dich.«
»Das weiß ich ja. Wir verstehen uns prima. Er muß ja auch zum General halten. Der hat genug Ärger mit seinem Sohn.«
»Wieso General?« fragte Daniel verblüfft.
»Na, der Generaldirektor Wellinger. Ich kenne nämlich die Kathrin. Der ihr Vater ist der Sohn vom General. Meine Güte, die hat bloß Angst vor ihrem Vater. Ich möchte solchen Vater wirklich nicht haben, der so gemein ist. Deswegen hat ihre Mutter nämlich auch einen anderen geheiratet.«
So, nun wußte Dr. Norden mal wieder etwas, womit er nichts anfangen konnte, aber Toby hatte sich ausgesprochen. Das war gut, und noch besser war es, daß Toby auch damit einverstanden war, in das Kinderheim zu gehen.
Jochen Stahl staunte. »Wie haben Sie das so schnell fertiggebracht, Dr. Norden?« fragte er.
»Es hat sich im Gespräch ergeben. Toby war heute sehr mitteilsam. Er sieht auch ein, daß sich der General auf Sie verlassen muß, weil sein Sohn anscheinend nichts taugt.«
»Der arme Wellinger ist tatsächlich geschlagen mit seinem Sohn«, sagte Jochen Stahl impulsiv. »Vergessen Sie’s«, fügte er dann aber rasch hinzu. »Mir steht es nicht zu, mich darüber zu äußern. Aber Sie haben wirklich eine Art jeden zum Reden zu bringen.«
»Die Taktik eines Arztes, der sich und das Vertrauen seiner Patienten bemüht«, sagte Daniel lächelnd. »Übrigens sollten Sie es Toby verschweigen, falls Sie von einer gewissen Linda Kraus nach Ägypten begleitet werden, wenn ich das bemerken darf.«
Da wurde Jochen Stahl tatsächlich verlegen. »Das ist meine Sekretärin«, erwiderte er. »Danke für den Hinweis. Sie wird uns tatsächlich begleiten. Ich weiß nicht, was Toby gegen sie hat.«
»Vielleicht hat er prinzipiell etwas gegen Frauen, die Ihnen nahe kommen«, meinte Dr. Norden hintergründig. »Man muß bei Kindern diesbezüglich sehr diplomatisch sein.«
»Sie sind wirklich ein guter Arzt, auch ein Seelenarzt«, sagte Jochen Stahl lachelnd. »Herzlichen Dank für Ihre Hilfe.«
»Schauen Sie sich das Heim an. Sie werden zufrieden sein«, sagte Dr. Norden.
»Kann ich Toby schon am Wochenende hinbringen?« fragte Jochen.
»Dem steht nichts im Wege. lch rufe Mutter Hedwig an.«
»Falls ich mal krank werden sollte, brauche ich wenigstens nicht lange nach einem Arzt zu suchen«, meinte Jochen.
»Mir sind die Gesunden lieber«, erwiderte Daniel. »An Arbeit habe ich keinen Mangel. Alles Gute für Sie, falls wir uns nicht mehr sehen sollten.«
Ein fester Händedruck, dann ging Dr. Norden und setzte seine Hausbesuche fort.
Er kam wieder spät heim, denn die Grippekranken mehrten sich. Das machten sie jedes Jahr zweimal mit. Fee Norden war immer heilfroh, wenn Ihr Mann verschont blieb.
Ihm war es wieder wohl, als er gegessen hatte und faulenzen konnte. Fee sorgte dafür, daß er es bequem hatte.
Aber sie wunderte sich, daß er dann fragte, ob sie etwas über den jungen Wellinger wüßte.
»Wie kommst du denn auf den?« fragte sie.
»Ach, Toby hat da etwas gesagt, was mir gerade wieder einfällt. Wenn ich mich recht erinnere, ist er in der Behnisch-Klinik mal am Blinddarm operiert worden.«
»Du hast ein gutes Gedächtnis. Das ist schon ein paar Jahre her. Inzwischen ist er geschieden und macht Jagd auf schöne Frauen. Aber das hat er wohl immer getan. Jetzt scheint Georgia Stafford Favoritin zu sein.«
»Die Opernsängerin. Die Frau hat doch Format«, sagte Daniel staunend.
»Und er heißt Wellinger und ist Alleinerbe. Er soll sehr charmant sein.«
»Toby sagt, daß seine Tochter Angst vor ihm hat.«
»Nun, als Vater kann ich ihn mir wirklich nicht vorstellen. Und Martina Frantzen hat sich ja auch von ihm getrennt. Sie hat sich vor einem Jahr scheiden lassen. Das weiß ich alles aus der Boulevardpresse«, erklärte sie lächelnd. »Was wahr ist, kann ich nicht beurteilen. Wahr ist jedenfalls, daß Martina Frantzen es sich leisten konnte, sich von ihm zu trennen. Sie hat nämlich kürzlich einen Baron von Tammen geheiratet. Die Tochter wurde ihr zugesprochen. Genügt dir das?«
»Recht interessant«, sagte Daniel.
Fee staunte. »Du hast tatsächlich zugehört? Ich habe das wirklich nur den Klatschspalten entnommen. Martina Frantzen habe ich allerdings früher mal kennengelernt. Vor unserer Ehe. Steinreiche Familie, im wahrsten Sinne des Wortes. Diamanten-Frantzen!«
»Wie lange war sie mit diesem Wellinger verheiratet?«
»Sieben Jahre.«
»Wie alt ist das Kind?«
»Sechs Jahre, soviel ich weiß. Seit wann interessierst du dich für die oberen Hundert?«
»Mich interessiert nur, woher Toby die kleine Kathrin kennt.«
„Du kannst ihn ja fragen«, meinte Fee neckend.
»So neugierig wollen wir auch wieder nicht sein, mein Schatz. Aber Toby ist so ein eigenartiges Kind. Er sagte, daß Kathrin Angst vor Ihrem Vater hat.«
»Ja, das sagtest du schon. Aber sie ist doch bei der Mutter.«
»Für Toby wird es gut sein, wenn er unter anderen Kindern ist«, sagte Daniel nachdenklich. »Und hoffentlich entscheidet sich Stahl für eine nette Frau, falls er an eine Wiederheirat denkt.«
»Du hast Toby sehr ins Herz geschlossen«, stellte Fee nachdenklich fest.
»Er ist ein lieber Junge. Übrigens ist er ein adoptiertes Kind.«
»Jetzt bin ich aber platt«, entfuhr es Fee.
»Ich war auch ziemlich aus der Fassung gebracht, mein Schatz. Stahl hängt mit einer Liebe an dem Jungen, die mancher richtige Vater nicht für seine Kinder aufbringt, und der Junge hängt an ihm. Hoffentlich wird er nicht wieder krank vor lauter Sehnsucht, wenn Stahl in Ägypten ist.«
»Im Tannenhof werden sie es schon verstehen, ihn abzulenken. Mutter Hellwig bietet Garantie dafür.«
*
Linda Krauss war hocherfreut, als Jochen Stahl ihr sagte, daß er Toby am Wochenende in ein Heim bringen würde. Freilich war sie klug genug, diese Freude nicht zu zeigen. Sie war nicht nur sehr intelligent, sondern auch sehr attraktiv. Da sie sich bei Christoph Wellinger keine Chancen ausrechnen konnte, hatte sich ihr Interesse auf Jochen Stahl konzentriert, der für eine Frau ja auch eine erstrebenswerte Partie war. Nur da stand ihr das Kind im Wege, denn Jochen verbrachte jede freie Minute mit Toby. Nun würde sie ihn aber sechs Wochen für sich haben, und diese Zeit wollte sie nützen.
»Hoffentlich ist er dort gut untergebracht«, sagte sie.
»Ja, das hoffe ich auch«, erwiderte Jochen. Nachdenklich betrachtete er sie, als sie sich an ihren Schreibtisch setzte. Sie bot einen wahrhaft erfreulichen Anblick. Immer gepflegt, immer elegant gekleidet, aber durchaus nicht auffallend. Sie entsprach genau den Vorstellungen, die man sich von einer perfekten Sekretärin machte.
Aber sie war auch eine begehrenswerte Frau. Auch das war nicht zu übersehen. Was konnte Toby gegen sie haben? Er hatte sie bisher ja nur zweimal gesehen, und tatsächlich waren diese Zusammentreffen rein zufällige gewesen.
Alles, was recht ist, dachte Jochen Stahl, aber ganz darf ich mich von Toby doch nicht unterjochen lassen.
Doch dann mußte er wieder lächeln. Betrachtete er den Jungen nicht auch als eine Art Schutzengel, der ihn schon vor manchem unüberlegten Schritt bewahrt hatte. Zum Beispiel die Hausdame Carla, der er fast ins Netz gegangen war, wäre eben nicht Toby als rettender Engel dazwischengetreten, um mit einem Dreitagefieber mal wieder alle Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.
Übersensibel sei der Junge, hatte Dr. Norden gesagt, aber wenn man es genau betrachtete, wurde er immer dann krank, wenn irgendeine Frau sein Mißfallen erregte.
Ja, Jochen Stahl hatte allen Grund, sich Sorgen zu machen, daß Toby auch dann krank werden würde, wenn er ihn in das Heim brachte, doch seine Sorge sollte sich als überflüssig erweisen.
Toby wußte genau, was für seinen heißgeliebten Papi beruflich auf dem Spiel stand. Er äußerte nur einen Wunsch, bevor die Reise losgehen sollte. Er wollte die kleine Kathrin noch einmal besuchen.
Wie diese Kinderfreundschaft entstanden war, hätte Jochen Stahl Dr. Norden leicht erklären können, hätte er geahnt, daß ihn dies so sehr interessierte. Jochen war nämlich mit Jobst von Tammen eng befreundet, und er war der erste gewesen, der von der Romanze wußte, die sich zwischen Jobst und Martina Wellinger anspann.
Er war auch Trauzeuge bei ihnen gewesen, ohne fürchten zu müssen, sich damit den Unwillen des alten Wellinger zuzuziehen. Es war ganz offensichtlich, daß Karl Friedrich Wellinger von seinem Sohn Christoph nicht das geringste hielt und Martina seine Zuneigung auch nach der Scheidung nicht entzog.
Obwohl Martina in unbeschreiblichem Luxus aufgewachsen war, besaß sie ein liebenswertes Wesen. Daß sie sich im Alter von neunzehn Jahren in den charmanten Christoph Wellinger verliebte, war verzeihlich, denn da hatte er sich von seiner Schokoladenseite gezeigt, und der alte Wellinger hatte gehofft, daß die reizende Martina einen guten Einfluß auf ihn ausüben würde. Doch auch diese Hoffnung sollte sich nicht erfüllen. Christoph Wellinger liebte das leichte Leben, und er wollte umschwärmt und von Frauen angebetet werden. Daß Martina dieses bösen Spiels einmal überdrüssig werden könnte, hatte er nicht einkalkuliert, noch weniger, daß sie sich zu einer Scheidung entschließen würde und dieses von ihrem Schwiegervater sogar gebilligt würde.
Christoph Wellinger mußte nun sogar erleben, daß ihm der Geldhahn beträchtlich zugedreht wurde und er auf das von seiner Mutter ererbte Vermögen zurückgreifen mußte. Noch lebte er munter drauflos, aber er hielt doch schon Ausschau nach einer reichen Frau, da sein Vater sich unversöhnlich zeigte.
Als Martina dann so bald nach der Scheidung Jobst von Tammen heiratete, einen Adligen, der dazu auch noch vermögend war, erlitt seine Eitelkeit einen heftigen Schlag, und seither versuchte er immer wieder, das neue Glück Martinas zu stören, da er vom Vormundschaftsgericht zugebilligt bekam, Kathrin einmal im Monat zu sehen. Davon machte er nur Gebrauch, um Martina zu treffen, um sie stets erneut in Angst zu versetzen.
Und selbstverständlich gab er auch nicht die Einwilligung dazu, daß Kathrin von Jobst von Tammen adoptiert werden konnte. Selbst mit einer beträchtlichen Summe, die Martina ihm bot, war er dazu nicht zu bewegen.
Als Jochen nun mit Tobias den Abschiedsbesuch bei der kleinen Kathrin machte, sollte er eine Überraschung erleben.
»Warum hast du es uns nicht vorher gesagt, daß du Toby in ein Heim bringst?« fragte Martina.
»Es hat sich alles so schnell ergeben. Ich kann den Jungen doch nicht mitnehmen nach Ägypten«, erwiderte er.
»Wir hätten Kathrin dann auch dorthin bringen können«, sagte sie leise. »Sie beginnt schon zu zittern, wenn der Tag naht, an dem Christoph sie holt. Und er tut es, obgleich er doch nichts für das Kind übrig hat. Wenn Kathrin mit Toby beisammen sein kann, würde sie gewiß kein Heimweh bekommen.«
»Warum sollte es nicht möglich zu machen sein, daß sie auch im Tannenhof aufgenommen wird«, meinte Jochen. »Ich kann mich erkundigen, und dann bringst du das Kind hin, Martina. Sprich doch auch mal mit Dr. Norden. Wenn er Kathrin aus gesundheitlichen Gründen eine Kur verordnet, kann dieser Filou gar nichts unternehmen.«
»Ich hatte nie gedacht, daß er so unfair sein würde, nach allem, was er mir zugemutet hat«, sagte sie leise. »Ich fürchte, daß Jobst bald überkocht und es zu einer schweren Auseinandersetzung kommt.«
»Eine Tracht Prügel würde dem Kerl nicht schaden«, sagte Jochen. »Er treibt es noch soweit, daß der Boß einen Herzinfarkt bekommt, und was dann passiert, können wir uns ausrechnen.«
»Ich wünsche Papa ein langes Leben«, sagte Martina leise, »aber ich weiß, daß er in jeder Hinsicht vorgesorgt hat. Christoph wird nicht die Möglichkeit haben, das Unternehmen zu zerstören. Wenn es aber so weitergeht, wird er uns seelisch zermürben.« Sie lachte bitter auf. »Von wegen Scheidung im beiderseitigen Einvernehmen.«
Währenddessen unterhielten sich Toby und Kathrin, und auch die Kleine hatte gesagt, wie gern sie mit ihm in das Heim gehen würde.
»Schön wär es schon«, meinte Toby. »Ich würde auf dich aufpassen, da brauchte sich deine Mami keine Sorgen zu machen.«
Wenn man die beiden nebeneinander sah, konnte man sogar eine gewisse Ähnlichkeit zwischen ihnen feststellen. Beide hatten lockiges blondes Haar und blaugraue Augen, beide waren feinknochig und zart zu nennen. Zu keinem anderen Kind hatte der zehnjährige Toby einen so innigen Kontakt gefunden, wie zu der um vier Jahre jüngeren Kathrin und für einen Jungen, der in wenigen Monaten schon auf das Gymnasium gehen würde, war das recht ungewöhnlich.
Sie ahnten nicht, daß nur für sie schon eine Vorentscheidung getroffen wurde.
»Ich fahre mit Kathrin jetzt gleich zu Dr. Norden«, erklärte Martina. »Vielleicht ist es zu ermöglichen, daß wir die Kinder morgen gemeinsam zum Tannenhof bringen können. Jobst ist heute auf dem Gericht, um zu erwirken, daß Christoph das Kind nicht mehr abholen darf. Wir können doch nicht zulassen, daß es seelischen Schaden nimmt. Man muß doch auch Kindern das Recht zubilligen, selbst zu entscheiden, bei wem sie sein wollen. Man kann doch nicht nach Paragraphen gehen.«
»Sein Lebenswandel sollte eigentlich auch dem Gericht bekannt sein«, sagt Jochen. »Als ob er nicht genug mit seinen Weibern zu tun hat. Wenn er doch nur mal an eine geraten würde, an der er sich die Zähne ausbeißt.«
»Wenn sogar eine Georgia Stafford auf ihn hereinfällt, kann man drauf kaum hoffen«, sagte Martina leise. »Und er ist eben nicht irgendwer. Er ist ein Wellinger!«
*
So lernte Dr. Daniel Norden an diesem Tag Martina von Tammen, geschiedene Wellinger, geborene Frantzen auch persönlich kennen, und er konnte nur angenehm überrascht sein.
Man konnte sie nicht schön nennen, aber sie war von einer fast madonnenhaften Anmut, und man konnte sie sich schlecht an der Seite eines Mannes vorstellen, der als Playboy stadtbekannt war. Nun, mit ihrem zweiten Ehemann schien sie Glück zu haben, das konnte Dr. Norden zumindest vermuten, als sie ihm ihre Sorgen schilderte.
Und wieder einmal innerhalb weniger Tage wurde Mutter Hedwig angerufen.
»Wir sind zwar voll belegt«, sagte sie, »aber Ihnen kann ich ja keinen Wunsch abschlagen. Irgendwie werden wir auch das Kind unterbringen.«
»Und bitte unter dem Namen von Tammen«, sagte Dr. Norden.
»Ich werde mich noch mit der Mutter unterhalten«, erklärte Mutter Hedwig.
Martinas Gesicht hellte sich auf, als er ihr diese gute Nachricht weitergeben konnte.
»Wäre ich doch nur früher zu Ihnen gekommen«, sagte sie. »Aber für Kathrin hatte ich immer den Kinderarzt Dr. Bertram.«
»Der ein ausgezeichneter Arzt ist«, warf Daniel ein.
»Ja, gewiß, aber bezüglich der jetzigen Situation ist er stark beeinflußt von Christoph Wellinger. Sie sind im gleichen Tennisclub, und unter anderen Menschen ist er eben der Sonnyboy. Da ich so bald wieder geheiratet habe, schiebt man mir natürlich alle Schuld zu, und Christoph posaunt auch überall herum, daß er mir großzügigerweise die Freiheit geschenkt hat. Sehen Sie, Herr Dr. Norden, ich bin eine Frau, die einen Halt braucht. Ich bin so erzogen und kann aus meiner Haut nicht heraus. Und es steht auch ein beträchtliches Vermögen auf dem Spiel. Von geschäftlichen Dingen verstehe ich leider gar nichts. Mein Vater ist vor zwei Jahren gestorben, meine Mutter ist ständig auf Reisen. Ich bin so froh, in Jobst einen zuverlässigen Partner gefunden zu haben. Sie brauchen nicht skeptisch zu schauen. Er hatte keine finanziellen Interessen.«
Ein bißchen Menschenkenntnis besaß sie also doch. Er hatte tatsächlich skeptisch geschaut, und nun wurde er deshalb verlegen.
»Ich hoffe, daß für Sie auch alles gut wird, gnädige Frau«, sagte er. »Kathrin ist bestimmt gut untergebracht. Und wenn Sie ein ärztliches Zeugnis für das Gericht brauchen, bin ich gern dazu bereit, es zu erstellen. Das Wohl des Kindes muß voran stehen.«
Am nächsten Morgen ging die kurze Reise los. Es waren ja nur knapp zwei Stunden Fahrt bis zum Kindererholungsheim Tannenhof. Sie saßen in einem Wagen, die beiden Väter vorn, Martina mit den Kindern hinten. Kathrin freute sich unheimlich, sechs Wochen mit Toby beisammen sein zu dürfen. Und sie brauchte den Vater nicht zu sehen. Für sie war ja Jobst der Papi, und ihn hatte sie lieb. So verstand sie schon gar nicht, daß sie auch zu Christoph noch Papa sagen sollte. Und er ermahnte sie immer wieder dazu.
In Tobys Kinderseele sah es ein wenig anders aus. Er liebte seinen Papi heiß und innig, und er hatte immer Angst, daß es doch mal eine Frau geben könnte, die dann für immer zu ihnen kommen würde. Daß sie dann zwischen ihnen stehen würde, stand für Toby fest.
Die Trennung von Jochen tat ihm weh, aber er war doch schon so vernünftig einzusehen, daß Jochen einen verantwortungsvollen Posten bekleidete, dem sie schließlich auch ein gutes Leben zu verdanken hatten.
Er unterdrückte tapfer seinen Kummer, und daß Kathrin bei ihm sein konnte, tröstete ihn.
Etwas wohler wurde ihm dann schon, als sie vor dem Tannenhof hielten. Das Gebäude verriet den Stil eines herrschaftlichen Gutshauses, mehr in die Breite, als in die Höhe gebaut, sich schön in die hügelige Landschaft einfügend, umgeben von hohen Tannenwäldern, und ganz besonders gefiel es beiden Kindern, daß ein paar putzige mittelgroße Hunde herumtollten, die zutraulich näher kamen. Von den Kindern war noch nichts zu sehen, aber Mutter Hedwig, ziemlich groß und von gemütlicher Rundheit dazu, kam ihnen entgegen und begrüßte sie mit freundlichem Lächeln.
Es wurde zuerst viel von Dr. Norden gesprochen, dem sie ihre Gesundheit zu verdanken hätte, die ihr auch die Möglichkeit gäbe, diesen verantwortungsvollen Posten auszufüllen.
Jochen konnte ebenso zufrieden sein wie Martina und Jobst von Tammen, denn das Haus war auch innen sehr behaglich und ganz darauf eingerichtet, daß Kinder sich wohl fühlen konnten. Es war alles vorhanden, woran sie Spaß haben konnten: ein großer Spielsaal, ein Turnsaal, auch ein Schwimmbad, eine riesige Sonnenterrasse und ein Park, in dem nichts fehlte, womit die Kinder sich die Zeit vertreiben konnten.
»Und wo sind die Kinder?« fragte Kathrin.
»Die sind jetzt bei einer Hochzeit, bilden sie Spalier und singen in der Kirche. Aber sie werden bald kommen.«
»Und die Verehrerinnen?« fragte Toby.
»Bei uns heißen sie Tanten. Sie werden euch gefallen. Euch beide wird Tante Annabel betreuen.«
Und die gefiel dann beiden sofort. Die Kinder, vierzig an der Zahl, schauten neugierig nach den »Neuen« aus, wurden dann aber gleich in den Waschraum zitiert.
Nur »Tante Annabel« blieb bei den Gästen. Sie war etwas mehr als mittelgroß, schlank und hatte langes blondes Haar, das zu einem Zopf geflochten war. Vielleicht sah sie dadurch jünger aus als sie war. Sie hatte ein ausdrucksvolles Gesicht, große graue Augen, die von dem langen Wimpernkranz umrahmt waren, und ein fast klassisch zu nennendes Gesicht.
Martina faßte sofort eine spontane Zuneigung zu ihr, weil sie so unaufdringlich war und die Kinder mit einem warmen Lächeln betrachtete.
Sie hatte eine warme, melodische Stimme. Dr. Norden war wieder einmal sehr zufrieden gewesen mit Mutter Hedwig, da sie genau die richtige Betreuerin für die beiden Kinder ausgewählt hatte.
»Insgesamt werdet ihr eine Achtergruppe sein«, erklärte Annabel, »aber ich kann euch versprechen, daß die andern genauso lieb sind wie ihr.«
Jochen Stahl betrachtete die junge Frau staunend. Ihre Anmut faszinierte ihn, dabei aber war sie nur auf die Kinder konzentriert, und nur mit Martina wechselte sie einige Worte.
»Ich werde Sie jede Woche schriftlich unterrichten, wie es den Kindern geht«, sagte sie ruhig. »Würden Sie bitte Anweisung geben, an welche Adressen ich die Berichte schicken soll?«
»Mein Papi muß nach Ägypten fliegen«, sagte Tobias.
Zum ersten Mal sah Annabel Jochen Stahl voll an, aber ihr Blick war kühl.
»Sie können die Berichte per Luftpost schicken«, sagte er. »Ich habe eine ständige Adresse.«
»Wir können uns auch um Toby kümmern, falls etwas sein sollte, Jochen«, warf Jobst von Tammen ein.
»Die Kinder werden hier bestens betreut«, sagte Annabel. »Wir haben auch ständig einen Kinderarzt, der jederzeit erreichbar ist.« Dann wandte sie sich an Martina. »Mutter Hedwig möchte noch mit Ihnen sprechen, Frau Baronin. Und ihr könnt jetzt gleich mit in den Speisesaal kommen«, sagte sie zu den Kindern. »Verabschiedet euch von euren Eltern.«
Toby drehte sich um und warf sich in Jochens Arme. »Du schreibst mir doch, Papi«, flüsterte er.
»Aber klar, Toby«, erwiderte Jochen, »jeden Tag.«
»Bleib schön gesund, und ich bete jeden Tag, daß dir nichts passiert, Papi.«
»Ich auch, mein Junge«, sagte Jochen zärtlich. »Ich weiß dich gut aufgehoben, das beruhigt mich.« Dabei warf er Annabel einen bittenden Blick zu.
Kathrin umarmte Jobst auch, aber sie sagte nichts. Sie griff dann nur gleich wieder nach Tobys Hand. Seine andere nahm Annabel, und Kathrins Linke nahm Martina.
»Alles recht erfreulich«, sagte Jobst rauh. »Augenblicklich sind beide hier besser aufgehoben als anderswo. Wir hätten Toby ja genommen, aber so ist es wohl doch besser. Wenn du mal hörst, daß Wellinger was passiert ist, bete für mich, Jochen.«
»Menschenskind, mach dich nicht unglücklich«, sagte Jochen. »Das ist er doch nicht wert, daß Martina und Kathrin dann auch noch leiden müssen.«
»Er ist es nicht wert zu leben. Für Karl Friedrich wäre es auch besser, wenn er…«
»Hör auf, Jobst, das will ich nicht hören. Gottes Mühlen mahlen zwar langsam, aber einmal wird es auch ihn erwischen. Dazu braucht er nicht zu sterben. Wenn der Boß doch den Mut aufbringen würde, klaren Tisch zu machen, wäre alles besser.«
»Es geht ja auch um seinen Namen. Ich verstehe ihn. Er ist ein Ehrenmann. Warum muß er mit seinem einzigen Sohn so gestraft sein! Wie ist er bloß zu dem gekommen. Manchmal denke ich, man hat ihm da ein Kuckucksei ins Nest gelegt. Von der feinsten Art war seine Frau ja nicht.«
»Du bist sehr aggressiv, Jobst«, sagte Jochen warnend.
»Ich will nicht, daß Martina diffamiert wird, daß Kathrin leiden muß. Ich werde den Mund nicht länger halten, Jochen. Ich spreche morgen mit dem Boß. Er muß seinen Einfluß geltend machen.«
»Okay, aber die Kinder sind hier gut aufgehoben. Wie ich von Dr. Norden gehört habe, ist auf Mutter Hedwig Verlaß. Ihr dürft nur niemandem sagen, daß Kathrin hier ist. Und du sollst nicht den Verstand verlieren.«
»Ich war gestern auf dem Gericht, Jochen. Ich kann es Martina nicht sagen. Christoph hat beantragt, daß ihr das Sorgerecht entzogen wird. Deshalb muß sich der Senior äußern. Christoph verschanzt sich hinter dem Namen Wellinger, und dagegen komme ich nicht an. Uns wird es immer angekreidet, daß wir geheiratet haben. Es kommt immer darauf an, wie Gesetze ausgelegt werden und von wem. Aber kein Wort zu Martina.«
*
Martina sprach mit Mutter Hedwig. Ohne Beschönigung schilderte sie ihre Situation.
Voll mütterlichen Mitgefühls betrachtete Mutter Hedwig die junge Frau.
»Ja, dann können wir nur hoffen, daß dieser Herr Wellinger junior nicht herausfindet, wo sich Kathrin befindet«, sagte sie. »Ich könnte mich dauernd mit diesen Vormundschaftsrichtern anlegen, Frau von Tammen. Sie ahnen ja nicht, was es alles gibt, wodurch Kinder krank gemacht werden. Von denen, die hier sind, stammen dreißig aus zerrütteten Verhältnissen. Geld ist genug da bei allen. Die Kinder werden aus den unterschiedlichsten Gründen abgeschoben. Ich bin richtig froh, wenn mal Kinder zu uns kommen, die noch richtig geliebt werden. Diese vertraue ich dann auch unserer Annabel an. Sie hat das richtige Gespür.«
»Sie ist mir sehr sympathisch«, sagte Martina.
»Ja, sie ist für mich wie ein Kind. Ich hatte ja nie eins. Ich hatte auch nie einen Mann, aber manchmal ist es besser, man findet keinen, als einen, der einem nur das Leben vergällt.«
»Mein Mann, mein jetziger Mann, möchte Kathrins Vater sein«, sagte Martina leise.
»Wir werden schon was dazu beitragen, Frau von Tammen«, sagte Mutter Hedwig. »Mein guter Dr. Norden«, fuhr sie dann gedankenverloren fort, »er weiß, was mir gut tut. Jetzt haben wir wieder mal zwei Kinder, die man behalten will. Der Herr Dr. Stahl macht ja auch einen guten Eindruck.«
»Er liebt seinen Sohn über alles. Leider ist seine Frau ja lange krank gewesen und früh verstorben«, sagte Martina.
»Und dann kommen andere Frauen, die sich einen Mann, der so gut aussieht, unter den Nagel reißen wollen«, brummte Mutter Hedwig. »Das kenne ich. Ihm traue ich schon Verstand zu.«
»Das dürfen Sie, Mutter Hedwig«, sagte Martina. »Wie oft dürfen wir die Kinder besuchen?«
»Am besten gar nicht. In Ihrem Fall wäre das sogar ein bißchen gefährlich, weil der Wellinger ja nicht wissen soll, wo Kathrin ist. Machen Sie sich nur keine Sorgen. Sie werden erleben, wie wohl sich die Kinder hier fühlen. Die Zeit vergeht ja so schnell, viel zu schnell für die, die eben doch schon älter sind. Bei den Kindern spielt es keine Rolle. Anrufen können Sie mich natürlich jederzeit.«
»Ich möchte aber nicht, daß uns Kathrin entfremdet wird«, sagte Martina.
»Auch darum brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Annabel hat Fingerspitzengefühl. Sie ist geschulte Pädagogin. Sie wollte sich behinderten Kindern widmen, aber das hat sie physisch nicht geschafft. Nicht wegen der Kinder etwa, sondern wegen deren Eltern. Sie kann sehr viel Liebe geben.«
»Eine so junge aparte Frau«, sagte Martina gedankenvoll. »Man sollte meinen, daß sie selbst Kinder haben möchte.«
»Vielleicht hat sie mal eine Enttäuschung erlebt«, sagte Mutter Hedwig. »Sie spricht nicht darüber. Sie geht ganz in der Fürsorge für die Kinder auf. Ich sagte ja schon, daß sie mir besonders nahe steht, daß ich mir solch ein Kind gewünscht hätte. Ich hoffe daß sie mir lange erhalten bleibt.«
»Ich wünschte mir eine solche Freundin«, sagte Martina. »Aber wenn man reich geboren ist, findet man keine ehrliche Freundin. Sie sind neidisch. Manchmal verfluche ich das Geld, das mir kein Glück gebracht hat. Sagen Sie mir, was Sie für den Tannenhof brauchen, Mutter Hedwig.«
»Ach, brauchen können wir viel«, erwiderte Mutter Hedwig lächelnd. »Der Wohltätigkeit sind keine Grenzen gesetzt. Manchmal möchte ich auch Kinder aufnehmen, deren Eltern nicht zahlungsfähig sind, und die gern etwas für ihre kranken Kinder tun würden.«
»Nehmen Sie solche Kinder auf, und schicken Sie mir die Rechnungen«, sagte Martina.
Mutter Hedwig riß die Augen auf. »Sie sind die Erste, die so was sagt«, platzte sie heraus. »Ich nehme Sie beim Wort!«
»Das hoffe ich«, sagte Martina. »Danke für dieses Gespräch. Es hat mir sehr geholfen. Sie ahnen nicht, wie sehr. Ich habe Mut. Ich werde kämpfen. Ich werde nicht dulden, daß Kathrins Kindheit zerstört wird. Danke Mutter Hedwig!« Und dann wurde die Ältere auch noch umarmt und auf die Wange geküßt.
Sie faltete die Hände, als sich die Tür hinter Martina von Tammen schloß.
»Ab und zu schickst du uns doch ein Zeichen deiner Güte, Herrgott«, murmelte sie. »Verzeih mir, wenn ich manchmal daran zweifle, aber heute mußt du wohl besonders freigiebig sein.«
*
»Kann ich nicht mit Kathrin in einem Zimmer sein, Tante Annabel?« fragte Toby. »Wir kennen uns doch schon.«
»Das geht leider nicht, Toby. Wir haben unsere Bestimmungen«, erwiderte Annabel. »Du hast das Zimmer mit Jan, und Kathrin teilt es mit Nadine. Du mußt das verstehen, Toby. Ihr seid beide schon zehn Jahre, und das sind noch kleine Mädchen. Tagsüber könnt ihr immer beisammen sein.«
»Aber wenn Kathrin weint, darf ich sie doch trösten?« fragte er.
Annabel fuhr ihm mit der Hand durch das dichte Haar. »Wir kommen schon zurecht, Toby«, sagte sie leise. Und sie konnte sich nicht erklären, warum ihr Herz ausgerechnet diesem Jungen entgegenschlug.
»Papi konnte mich ja nicht mitnehmen«, flüsterte Toby traurig. »Aber dich mag ich. Hätten wir doch nur mal so eine Hausdame gehabt.«
Ein flüchtiges Lächeln huschte um Annabels weichen Mund. »Hattet ihr schon mehrere?« fragte sie.
»Fünf in vierzehn Monaten. Da war Mama gestorben, aber sie war sehr krank. Die Hausdamen waren nur immer hinter Papi her, aber um mich haben sie sich nicht viel gekümmert. Es gefällt mir gut hier. Und ich bin froh, daß Kathrin auch hier ist. Ich kann mich schwer an andere Kinder gewöhnen. Ist das schlimm?«
»Nein, das ist nicht schlimm, Toby. Es geht anderen auch so. Jan zum Beispiel. Du wirst dich bestimmt mit ihm verstehen. Er redet nur nicht viel. Du bist schon gescheiter. Er könnte viel von dir lernen.«
»Kommt er auch aufs Gymnasium im Herbst?«
»Nein, das wird nicht möglich sein. Er bleibt noch länger hier.«
»Ist er richtig krank?« fragte Toby. »Ich stecke mich nämlich leicht an.«
»Er ist nicht ansteckend krank. Er ist nur sehr traurig. Seine Eltern sind bei einem Unfall ums Leben gekommen. Ich muß dir das sagen. Sprich bitte nicht von Flugzeugen.«
Toby starrte sie an. »Sie sind mit dem Flugzeug verunglückt?« fragte er bebend. »Mein Papi muß aber auch fliegen, bis nach Ägypten.«
»Deinem Papi passiert schon nichts«, sagte Annabel hastig. »Das war so ein kleines Flugzeug. Du brauchst keine Angst zu haben, Toby.«
»Du hast jetzt ja auch Angst«, sagte er.
»Ich hätte nicht davon reden sollen«, sagte sie leise.
»Ich habe aber schreckliche Angst, daß meinem Papi was passiert«, flüsterte Toby. »Ich habe ihn doch so lieb, Tante Annabel. Du weißt nicht, wie ich ihn liebhabe. Er ist der beste Papi auf der ganzen Welt.«
Und warum habe ich diesen Jungen so lieb, so spontan? fragte sich Annabel.
Eine Stunde später saß sie Mutter Hedwig gegenüber. »Ja, jetzt haben wir zwei Problemkinder, in die es sich lohnt, sich richtig reinzuhängen, Annabel«, sagte Mutter Hedwig. »Schau dir die Unterlagen an. Auf die kleine Kathrin müssen wir besonders achtgeben.
Der Name Wellinger darf hier nicht fallen.«
»Wellinger?« wiederholte Annabel tonlos.
»Frau von Tammen war zuerst mit einem Christoph Wellinger verheiratet. Kathrin stammt aus dieser Ehe. Der Mann war so ein Playboy. Jetzt hat sie einen ordentlichen Mann, aber der Vater von Kathrin, dieser Wellinger, läßt das arme Kind nicht in Ruhe. Ich muß dich einweihen. Wenn der hier aufkreuzen sollte, weiß niemand was von einer Kathrin Wellinger. Bei Tobias sind die Verhältnisse klarer. Der Vater ist verwitwet. Er liebt den Jungen über alles, muß beruflich aber nach Ägypten. Dr. Stahl und Herr Baron von Tammen sind Freunde. Die Kinder kennen sich. Frau von Tammen ist sehr großzügig. So hat sich hier noch niemand gezeigt: Ich möchte, daß du dich dieser beiden Kinder besonders annimmst, Annabel.«
»Die andern sechs brauchen auch Hilfe«, sagte Annabel.
»Ja, gewiß. Du machst das schon. Aber durch Frau von Tammens Großzügigkeit können wir dann auch ein paar Kinder nehmen, die arme Eltern haben. Das haben wir uns doch immer gewünscht, du und ich, Annabel.«
»Ja, Mutter Hedwig«, sagte Annabel leise.
»Auf dich kann ich mich verlassen«, sagte die Ältere. »Die andern haben ja immer noch Träume. Warum sprichst du dich nicht mal aus, mein Kind?«
»Ich fühle mich hier sehr wohl«, erwiderte Annabel ausweichend.
»Ich möchte dich auch nicht missen. Andererseits aber würde ich dir schon ein privates Glück wünschen, Annabel. Du hättest es wahrhaft verdient.«
Annabel blickte sie aus traurigen Augen an. »Ich habe ein Glück verschenkt, Mutter Hedwig. Das ist mir zu spät bewußt geworden. Ich möchte darüber nicht sprechen«, fügte sie rasch hinzu.
*
Schneller als gedacht lebten sich die beiden Kinder auf dem Tannenhof ein. Mit dem stillen, verschlossenen Jan freundete sich Tobias rasch an. Die lebhafte Nadine gab es bald auf, Kathrin herumzukommandieren, als sie merkte, daß diese auch eigensinnig sein konnte, und so paßten sie sich einander an. Annabel kam mit ihrer Gruppe sehr gut zurecht, aber Mutter Hedwig blieb es nicht verborgen, daß sie zu Tobias eine ganz besondere Zuneigung gefaßt hatte, und der Junge zu ihr. Wann immer sich ihm die Gelegenheit bot, mal ein paar Minuten mit Annabel allein zu sein, nützte er es aus. Das fiel allerdings nur Jan auf.
»Du magst Tante Anabell wohl mächtig gern?« fragte er. »Meine Mami war auch so lieb.« Gleich füllten sich seine Augen mit Tränen, doch er schluckte sie hinunter und fuhr leise fort: »Vielleicht darf mich Maxi holen, wenn alles geregelt ist.«
»Wer ist Maxi?« fragte Toby.
»Mamis Schwester. Maximiliane heißt sie. Aber sie muß erst einen Mann haben.«
Mehr darüber zu sagen, war er vorerst nicht bereit, und Toby fragte nicht. Er ließ sich auch nicht gern ausfragen.
Toby sollte Maxi allerdings bald kennenlernen. Sie kam Jan besuchen. Sie war jung und hübsch, aber man sah ihr an, daß sie viel Kummer gehabt hatte.
»Kommst du mich jetzt holen, Maxi?« fragte Jan.
»Nein, es geht leider noch nicht«, erwiderte sie bekümmert. »Aber ich werde mir hier in der Nähe eine Stellung suchen, damit ich dich öfter besuchen kann, Jan.«
»Frag doch mal Mutter Hedwig«, meinte er. »Sie kennt viele Leute.«
Mutter Hedwig kannte Maximilianes Kummer. Ihre Verlobung war in die Brüche gegangen, weil sie darauf bestanden hatte, Jan zu sich zu nehmen. Sie wollte nun auch weg aus Nürnberg, da sie im gleichen Betrieb wie ihr ehemaliger Verlobter beschäftigt war. Und Mutter Hedwig konnte auch gleich einen Vorschlag machen.
»Wir könnten schon eine tüchtige Bürokraft brauchen«, sagte sie. »Annabel macht das nebenbei, aber es wird ein bißchen viel für sie. Wenn Sie sich entschließen könnten, unser Landleben zu teilen, Fräulein Greiter, könnten Sie gern hier anfangen.«
»Das wäre wunderbar«, sagte Max leise.
»Wann könnten Sie anfangen?«
»Wenn ich gleich kündige, zum nächsten Ersten.«
»Fein, dann freue ich mich.«
»Und ich erst«, sagte Maxi. »Ich kann bei Jan sein. Ich habe doch nur noch ihn.«
Vielerlei Schicksale erfuhr Mutter Hedwig, und sie war immer von Herzen froh, wenn sie helfen konnte. Und auch Jan strahlte. Noch nie hatte sie diese Augen so leuchten sehen.
»Dann bist du da, wenn Toby wieder weggehen muß«, sagte er. »Er ist nämlich ein richtiger Freund. Aber wenn du da bist, bin ich nicht so traurig, wenn sein Papi ihn wiederholt.«
Auch Annabel freute sich, denn Maxi war ihr sehr sympathisch. »Wir werden uns bestimmt gut verstehen«, sagte sie.
»Davon bin ich überzeugt«, erwiderte Maxi. »Hoffentlich bleiben Sie recht lange hier, Annabel.«
»Ganz bestimmt«, erwiderte Annabel überzeugt und nicht ahnend, daß es dann doch ganz anders kommen sollte.
*
Für Jochen Stahl war die erste Woche seines Aufenthaltes in Ägypten auch schnell vergangen. Sehr viel Arbeit hielt ihn in Atem. Ganz so hatte es sich Linda Krauss nicht vorgestellt. Nur die Mahlzeiten nahmen sie gemeinsam ein. Von einem Ausflug oder gar einem abendlichen Beisammensein war nicht die Rede. Zu ihrem Unwillen war Jochen hier doch bedeutend zurückhaltender als daheim.
Gelöster wirkte er nur, als der erste Brief vom Tannenhof eintraf. Einen kurzen Bericht von Annabel enthielt er, in dem sie ihm mitteilte, daß Toby sich sehr rasch eingelebt hätte und daß es ihm gesundheitlich sehr gut gehe. Er hätte schon ein Kilo zugenommen. Mehr hatte sie nicht geschrieben, aber Toby hatte dafür einen zwei Seiten langen Bericht niedergeschrieben, dem er mehr entnehmen konnte.
Mein lieber Papi, hier ist es viel schöner, als ich dachte. Tante Annabel ist sehr lieb. Jan ist mein Freund. Wir streiten nie. Kathrin verträgt sich auch mit Nadine recht gut, und überhaupt sind die Kinder in unserer Gruppe nett. Aber Tante Annabel versteht es auch sehr gut, viel besser, als die anderen Tanten. Sie ist sehr gescheit und schimpft nie. Oft denke ich, daß es sehr schön wäre, wenn sie unsere Hausdame wäre. Sie ist nämlich wirklich eine Dame, wie Tante Martina. Ich würde sie sehr gern fragen, ob sie nicht zu uns kommen machte, aber ich traue mich nicht. Mutter Hedwig hat Annabel nämlich auch sehr gern. Wie geht es Dir? Hast Du viel Arbeit? Ich warte schon sehr auf einen Brief, aber Du bist ja erst ein paar Tage weg, und Annabel sagt, so schnell geht die Post nicht, auch nicht per Luftpost. Ägypten ist schon ziemlich weit. Annabel erzählt mir viel davon. Sie war nämlich schon mal da und hat die Pyramiden besucht. Sie hat mir auch schöne Bücher gezeigt mit Fotografien. Wenn Du wieder zu Hause bist, können wir sie doch wenigstens mal einladen. Bitte, lieber Papi. Ich vermisse Dich sehr, aber es wäre viel schlimmer, wenn ich Annabel nicht hätte.
Annabel, Annabel und immer wieder Annabel! Jochen hatte gedacht, Toby würde viel mehr von Kathrin schreiben.
Seltsamerweise konnte er sich auch sehr genau an diese Annabel erinnern. Doch jetzt wurde er von Linda aus den Gedanken gerissen.
»Na, was hört man vom Sohn?« fragte sie forsch.
»Es geht ihm gut. Er fühlt sich wohl.«
»Also kein Grund, sich Gedanken zu machen«, sagte sie mit einem ironischen Unterton, der ihn störte. »Könnten wir nicht auch mal ein bißchen Freizeit genießen?«
Er blickte auf. »Genießen Sie doch«, sagte er, ebenfalls ironisch.
Ihre Augen verengten sich. »Ich habe es mir schon ein bißchen anders vorgestellt«, sagte sie.
»Wie anders?« fragte er.
»Sie sind ein seltsamer Heiliger«, stellte sie sarkastisch fest. »Beruf und Sohn, was anderes gibt es wohl nicht für Sie.
Komisch, dachte Jochen, eigentlich hat sie mir doch sehr gut gefallen, und wenn Dr. Norden nicht diese Bemerkung gemacht hätte…, aber schon irrten seine Gedanken wieder ab, wanderten zu Toby, der von allen erwachsenen weiblichen Wesen bisher nur Martina akzeptiert hatte.
Jetzt hatte er nicht die geringste Neigung, ein paar Stunden mit ihr zu verbringen. Er fühlte sich auch seltsam schlapp. Das Klima sagte ihm gar nicht zu, und das Essen schmeckte ihm nicht. Und nun sagte Linda gerade in diesem Augenblick: »Wollen wir nicht wenigstens mal anständig essen gehen?«
Er schüttelte den Kopf. »Ich muß die Pläne durchsehen. Irgend etwas stimmt da nicht«, erwiderte er. »Brock wird bestimmt gern mit Ihnen ausgehen, Linda.«
»Sind Sie etwa eifersüchtig?« entfuhr es ihr.
»Wieso denn das?« fragte er kühl.
Sie drehte sich auf dem Absatz um und verließ grußlos das Zimmer.
Jochen setzte sich an den Schreibtisch und schrieb den zweiten Brief an Toby. »Du hast mich ganz schön dressiert, mein lieber Junge«, murmelte er. Aber dann erhellte ein Lächeln sein Gesicht. Hast mich auch schon vor mancher Dummheit bewahrt, ging es ihm durch den Sinn. Und Linda würde bestimmt nicht zu uns passen.
*
Dr. Norden bekam an diesem Vormittag unerwarteten und unangenehmen Besuch.
»Ein Herr Wellinger wartet, Chef«, sagte Loni.
»Na, dann«, erwiderte er brummig. »Er wird sich gedulden müssen, es sind noch drei Patienten da.«
»Dieser eingebildete Schnösel spielt sich auf, als ob er der Kaiser persönlich wäre«, sagte Loni gereizt.
»Auch der Kaiser müßte warten, wenn er sich nicht angemeldet hat«, erklärte Dr. Norden gelassen. Er brauchte nicht zu überlegen, warum Christoph Wellinger hier erschien.
Und als der dann sein Sprechzimmer betrat, setzte Daniel Norden seine eisigste Miene auf.
Augenblicklich schien Christoph Wellinger verblüfft zu sein. Er stand einem Mann gegenüber, der noch um einiges attraktiver war als er, der dazu eine Persönlichkeit darstellte. was man von dem jungen Wellinger wahrhaftig nicht sagen konnte. Der war nichts als ein charmanter Playboy, doch sein Charme schien verlorengegangen zu sein.
»Ich habe meine Zeit nicht gestohlen«, stieß Christoph Wellinger hervor. »Sie wissen anscheinend nicht, mit wem Sie es zu tun haben.«
»Meine Zeit ist knapp bemessen, und Sie sind kein Patient«, erwiderte Dr. Norden eisig.
»Sie haben es gewagt, dem Vormundschaftsgericht zu schreiben, daß meine Tochter psychische Störungen bekommt, wenn ich sie zu mir hole. Das wird Sie teuer zu stehen kommen, Herr Dr. Norden.«
»Beweisen Sie das Gegenteil«, sagte Daniel. »Ich kann meine Diagnose rechtfertigen.«
»Das Kind wird nur von seiner Mutter gegen mich aufgehetzt«, ereiferte sich Christoph Wellinger. »Kathrin wird jetzt vor mir versteckt, und das haben Sie veranlaßt.«
Daniel musterte ihn mit einem vernichtenden Blick. »Wenn Sie meinen, etwas gegen mich unternehmen zu müssen, es steht Ihnen frei, Herr Wellinger«, sagte er ruhig. »Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Die Angelegenheit wird vor dem Vormundschaftsgericht verhandelt werden. Selbstverständlich wird ein Amtsarzt hinzugezogen.«
»Dr. Bertram hat meine Tochter jahrelang behandelt und keine seelischen Störungen feststellen können«, sagte Christoph Wellinger etwas aggressiv.
»Während dieser Zeit haben Sie sich anscheinend weniger um das Kind bemüht als jetzt«, sagte Dr. Norden ruhig. »Ich würde Ihnen zu einer vernünftigeren Einstellung raten.«
»Ich habe Sie nicht um einen Rat gebeten.«
»Dann darf ich diese Unterredung als beendet betrachten«, sagte Dr. Norden.
»Ihre Arroganz wird Ihnen schon noch vergehen!«
»Warten wir es ab«, sagte Dr. Norden gelassen.
Christoph Wellinger fuhr zu seinem Vater. Seit Wochen hatte er das Haus nicht betreten, aber nun brannte es ihm doch auf den Nägeln. Er hatte in letzter Zeit so manche Niederlage einstecken müssen, und das behagte ihm gar nicht.
Karl Friedrich Wellinger zeigte eine steinerne Miene, als sein Sohn in sein Arbeitszimmer stürmte.
»Ich habe zu tun«, sagte er hart.
»Und ich muß dich sprechen, Vater«, sagte Christoph.
Vater und Sohn, aber wie grundverschieden waren sie. Der ältere war untersetzt und hatte ein markantes, flächiges Gesicht. Nein, es war nicht die geringste Ähnlichkeit festzustellen.
»Du hättest dich anmelden sollen«, sagte der alte Wellinger gleichmütig.
»Bin ich dein Angestellter oder dein Sohn?« fragte Christoph gereizt.
»Es wäre um einiges erfreulicher, wenn du ein arbeitender Sohn wärest«, sagte Karl Friedrich Wellinger sarkastisch.
»Ich will ja arbeiten, aber ich lasse mich doch nicht von irgendwelchen Leuten herumkommandieren. Du gibst mir keine Chance.«
»Wer befehlen will, muß etwas leisten. Du kennst meinen Standpunkt. Ich kann meine guten Leute nicht von einem Großmaul vergraulen lassen.« Das war ein sehr hartes Wort. Christoph zuckte zusammen.
»Um es ganz deutlich zu sagen: Du bist für eine Führungsposition nicht geeignet. Dir fehlt die Intelligenz und das Fingerspitzengefühl«, fuhr Karl Friedrich Wellinger fort. »Also, was willst du?«
»Es geht um Kathrin. Martina hat sie an einen unbekannten Ort gebracht, und ein gewisser Dr. Norden hat…«
»Ich weiß Bescheid«, wurde er unterbrochen. »Und ich halte das für durchaus richtig. Warum soll das Kind auch noch verdorben, werden? Deine Mutter hat mit ihrer Affenliebe genug angerichtet. Ihr hübsches Söhnchen durfte sich ja nicht die Finger schmutzig machen, er mußte in Samt und Seide gekleidet werden und wurde auf dem Präsentierteller herumgereicht. Aber ich habe ja von Anfang an gewußt, daß aus dir nichts wird als eben ein Playboy, der den Weiberröcken nachjagt. Von mir kannst du keine Unterstützung erwarten, was Kathrin betrifft. Im Gegenteil. Ich werde aussagen, daß dein Lebenswandel nur einen schädlichen Einfluß auf das Kind haben kann.«
Christoph wurde kreidebleich. Haß glomm in seinen Augen auf. »Du wirst nicht ewig leben«, stieß er hervor, »und dann…«
»Freu dich nicht zu früh«, fiel ihm sein Vater ins Wort. »Mein Testament ist gemacht, und es ist unanfechtbar.«
»Ich bin der letzte Wellinger, das scheinst du zu vergessen«, schrie ihn Christoph an.
»Nein, das bist du nicht, und das weißt du sehr gut.«
Christoph wich zurück. Fassungslos starrte er seinen Vater an.
»Nun bist du sprachlos«, sagte der Ältere. »Es kann ja leicht möglich sein, daß du mehr als ein anständiges Mädchen ins Unglück gebracht hast, aber über eines bin ich bestens informiert. Es wird wieder einen Wellinger geben, und nun streng dein Spatzenhirn mal an, wer das wohl sein könnte.«
Christoph rang nach Worten. Er sah unglaublich töricht aus. »Du hast dich täuschen lassen, Vater«, stammelte er.
»Ich lasse mich nicht täuschen. Ich gehe den Dingen auf den Grund. Aber mehr wirst du von mir nicht erfahren. Das Leben dieses Kindes wird nicht in Gefahr gebracht. Und dir kann ich nur raten, dein Leben zu ändern, sonst wirst du bald vor dem Nichts stehen. Von mir bekommst du keinen roten Heller, und wenn du Martina weiterhin Schwierigkeiten bereitest, werde ich mich nicht scheuen, es publik zu machen, daß Karl Friedrich Wellinger seinen Sohn vor die Tür gesetzt hat. Ich habe nichts zu verlieren. Ist das deutlich genug?«
»Vater, ich bitte dich, ich weiß nicht, wovon du redest«, murmelte Christoph.
»Du warst schon immer verlogen«, sagte sein Vater hart. »Die Sonne bringt es an den Tag. Alle Schuld rächt sich auf Erden, kann man auch sagen.«
»Ich würde ein Kind doch nicht verleugnen«, sagte Christoph tonlos.
»Ja, ich weiß, die Frauen sind an allem schuld. Du hast eine anständige Frau bekommen, und ich habe gehofft, daß du dich ändern würdest, deshalb habe ich beide Augen zugedrückt, aber das ist vorbei. Wage es nicht, dich hinter dern Namen Wellinger zu verschanzen. Ich gebe dir noch eine letzte Chance. Pack deine Sachen, und verlaß München und dieses Land. Du kannst dir aussuchen, wo du leben willst, aber komm mir nicht mehr unter die Augen.«
Christoph warf den Kopf zurück. »So kannst du nicht mit mir reden, Vater, so nicht. Ich will jetzt wissen, wer mir ein Kind unterschieben will.«
»Du wirst es erfahren, aber nicht von mir. Aber du wirst an den Jungen nicht herankommen, das schwöre ich dir.«
»Ich kann mich jedenfalls nicht erinnern. Meinetwegen laß du dich für dumm verkaufen. Mich legt keine aufs Kreuz.«
»Nein, das besorgst du«, sagte Karl Friedrich Wellinger mit klirrender Stimme. »Ich habe übrigens dem Vormundschaftsgericht empfohlen, dir jeden Kontakt zu verbieten. Und wenn du Martina belästigst, wäre es mir nur recht, wenn dir Jobst eine Tracht Prügel verabreicht, die du dein Leben lang nicht vergessen wirst. Ich habe das ja leider versäumt, weil deine Mama das Mimöschen so verpäppelt hat.«
»Willst du nun auch meine Mutter beleidigen, meine tote Mutter?« zischte Christoph.
»Wenn sie nur noch leben würde, dann könnte sie jetzt was zu hören bekommen. Aber vielleicht gelingt es mir auch jetzt noch zu beweisen, daß ich nicht dein Vater bin. So, nun weißt du es, nun weißt du auch, warum ich nicht das geringste fühlen würde, wenn du vor die Hunde gehst.«
»Das ist infam, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich werde dich wegen Verleumdung verklagen!«
»Tu es doch, ja, tu es, dann wird mich wenigstens keiner mehr bedauern, daß ich so einen Sohn habe.«
Er hatte sich in Zorn geredet, der alte Wellinger. Er hatte mehr gesagt, als er sagen wollte. Seine Stirnadern waren angeschwollen, in seinen Augen brannte Verachtung, tödliche Verachtung. Christoph zog es vor, das Feld zu räumen. Was er da zu hören bekam, ging sogar ihm unter die Haut, obgleich er so abgebrüht war. Ja, er sah all seine Felle davonschwimmen, und jetzt brauchte er einen Menschen, der kühl und sachlich denken konnte, der auch zuhören würde. Und dieser Mensch war Georgia Stafford.
Sie hatte sich in keine intime Affäre mit ihm eingelassen, aber sie hatte ihm Zeit gewidmet, ihn abgeholt, und ihr hatte er schon manches gesagt, was er sonst noch niemandem erzählt hatte. Aber er war nicht klug genug, um zu erkennen. daß Georgia es meisterhaft verstanden hatte, ihn auszuhorchen. Und als er sie anrief und fragte, ob sie Zeit hätte für ihn, war er nur erfreut, daß sie zustimmte. Er konnte nicht ahnen, daß er nun vom Regen in die Traufe kommen würde.
*
Georgia Stafford war neununddreißig Jahre alt, aber man sah ihr diese nicht an. Sie war eine schöne Frau im besten Sinne des Wortes, und ihre glanzvolle Karriere hatte sie auch mit diesem Umstand zu verdanken, denn ihre Stimme hatte sich erst in den letzten Jahren entwickelt. Man sprach nicht mehr davon, daß sie sich als Operettensängerin und vorher sogar in Nachtclubs ihr Geld verdient hatte, mehr im Schatten als im Licht der Scheinwerfer. Sie hatte ein hartes Leben hinter sich, aber das hatte ihre Persönlichkeit geformt und ihrer Schönheit nicht geschadet.
Daß Christoph überhaupt an sie herangekommen war, hatte er ganz besonderen Umständen zu verdanken, und vor allem dem, daß er Wellinger hieß. Dafür hatte sie es sogar in Kauf genommen, daß ihre besten Freunde darüber spöttelten.
Jetzt wußte sie, daß sie ihr Ziel erreicht hatte. In der Stunde ihres Triumphes wirkte sie noch schöner, noch begehrenswerter, obgleich ihre Augen jetzt einen eiskalten Glanz hatten.
Doch dessen wurde sich Christoph nicht bewußt. Er legte ihr einen großen Strauß dunkelroter Rosen in den Arm. »Wir müssen über wichtige Dinge sprechen, bevor du deine Tournee beginnst, Georgia«, sagte er.
»Was du nicht sagst«, meinte sie mit einem unergründlichen Lächeln.
»Ich werde dich nämlich begleiten.«
In ihren Augen blitzte es auf. »Wie stellst du dir das vor?« fragte sie ein ganz klein wenig unsicher, denn so etwas zu hören, hatte sie nicht erwartet.
»Ich bin frei, unabhängig, und ich habe keine Lust, mich hier anöden zu lassen. Ich gehe mit dir, wohin du willst.«
»Wohin ich will«, sagte sie gedankenvoll, »darum geht es nicht. Wohin ich muß, um meine Verträge zu erfüllen. Und dabei kann ich keinen Pagen gebrauchen, lieber Christoph. Ich bin auch frei und unabhängig, und ich habe meinen Manager, der mir alles aus dem Wege räumt.«
»Dieser hölzerne Tyrann«, sagte er unwillig.
Georgia legte den Kopf zurück. Sie mußte sich jetzt wahnsinnig beherrschen, damit ihr kein unbedachtes Wort entschlüpfte, aber sie wollte Christoph ja nicht verscheuchen. Sie wollte hören, was ihn so erregte, denn er war erregt.
Doch da läutete das Telefon, und schnell nahm sie den Hörer auf.
Sie drehte Christoph den Rücken zu. »Ich habe gerade Besuch. Ich rufe später zurück«, sagte sie mit vibrierender Stimme. Und dann: »Das können Sie beruhigt ganz mir überlassen.«
»Wer war das?« fragte Christoph neugleng.
»Eine geschäftliche Angelegenheit«, erwiderte sie. »Nun schieß mal los. Welche Laus ist dir denn über die Leber gekrochen?«
»Ich hatte mal wieder Ärger mit meinem Vater, aber er läßt mir jetzt völlig freie Hand. Ich habe mich schon durchgesetzt. Er war einem Schlaganfall nahe. Lange macht er es bestimmt nicht mehr, und dann kann ich dir ein herrliches Leben bieten, Georgia. Du bist die einzige Frau, die mich wirklich festhalten kann.«
»So, bin ich das? Ich will dich aber nicht festhalten, Christoph.«
»Aber ich kann dir ein sorgloses Leben bieten. Du kannst alles haben. Du brauchst nur zu wünschen. Ich weiß doch, daß es dir nicht immer gutging, und wer weiß, wie lange du noch singen kannst.«
»Nun, ich habe für mein Alter vorgesorgt«, sagte sie spöttisch. »Aber ich erkläre dir auch gern, warum ich viele Jahre finanzielle Sorgen hatte. Ich hatte nämlich eine Schwester, die von einem miesen Kerl mit einem Kind sitzengelassen wurde. Sie war seit der Geburt schwerkrank. Ich mußte für sie und das Kind sorgen, denn der Vater hatte sich aus dem Staub gemacht, und das arrne Ding wußte nicht mal seinen richtigen Namen. Den haben wir dann aber kurz vor ihrem Tod durch einen Zufall herausbekommen. Sein Name ist Christoph Wellinger. Du bist der Schuft, der meine Schwester Isabel ins Elend getrieben hat.«
»Das ist nicht wahr. Das ist eine infame Lüge«, stieß er hervor.
»Ich kann alles beweisen«, sagte Georgia völlig ruhig, und als er aufsprang und auf sie zustürzen wollte, fuhr sie ebenso ruhig fort: »Und wenn du mich auf der Stelle umbringst, wird es dir nichts nützen. Es ist alles schriftlich niedergelegt, und dein Vater weiß Bescheid. Ich habe auf diese Stunde gewartet. Ich konnte warten. Für meinen Neffen Christoph ist alles gesichert. Du kannst dich nicht mehr herausreden.«
»Aber ich wußte das doch nicht. Höre mich doch an, Georgia.«
»Das will ich ja. Dafür habe ich mir Zeit genommen«, sagte sie.
»Sie hieß Isabel, ja, ich kann mich erinnern. Isabel, an den Nachnamen kann ich mich nicht erinnern. Stafford lautete er jedenfalls nicht.«
»Isabel Schultz, schlicht und einfach Schultz. Stafford ist der Name meines Mannes. Er hat auch nichts getaugt, aber solch ein Lump wie du war er nicht. Und Isabel kannte dich unter dem Namen Schlüter. Ich habe herausgebracht, daß es der Mädchenname deiner Mutter war. Und jetzt wirst du mir zuhören, Christoph Wellinger, oder wie du sonst eigentlich heißen müßtest. Ich glaube nämlich an übersinnliche Kräfte. Meine Erfolge habe ich einem Hellseher zu verdanken und auch, daß ich dich gefunden habe. Ja, ich habe deine Bekanntschaft gesucht.«
»Ich höre mir diesen Schmarrn nicht an!« brauste er auf.
»Nun, dann wird dieser Schmarrn eben morgen oder übermorgen in allen Zeitungen stehen, wohlgemerkt mit Genehmigung deines Vaters. Aber vielleicht solltest du lieber zuhören. Es könnte dich vor weiteren unüberlegten Schritten bewahren, was mir lieb wäre im Interesse deines hochachtbaren Vaters, der meinen Worten und Beweisen Glauben schenkte. Diesem Mann will ich nicht schaden, aber ich weiß, daß er so aufrichtig ist, mir nichts in den Weg zu legen, um deine abscheulichen Taten aufzudecken.«
»Nun, ich höre«, sagte er. »Aber du wirst dir auch gefallen lassen müssen, daß ich rechtliche Schritte gegen diese Behauptungen unternehme.«
»Bitte, es steht dir frei. Wie schon gesagt, es ist alles schriftlich bei einem Anwalt niedergelegt. Beginnen wir also mit meiner Schwester Isabel. Was vorher war, habe ich nicht verfolgt, sonst aber habe ich eine hübsche Liste zusammengebracht von deinen Missetaten.«
»Alles mit Hilfe eines Hellsehers«, höhnte er.
»Du sagst es. Daß Isabel ein Kind zur Welt gebracht hat, erfuhr ich erst, als ich von einem Arzt informiert wurde, daß ihr Zustand lebensbedrohend sei. Das ist jetzt zwölf Jahre her, um dir diese Zeit in die Erinnerung zurückzurufen. Isabel glaubte damals immer noch an dich. Du hattest ihr weisgemacht, daß du beruflich ins Ausland müßtest und sie nachholen würdest. Aber es kam keine Nachricht von dir. Ich habe vergeblich nach einem Christian Schlüter geforscht. Isabel lebte zwischen Traum und Tag, zwischen Angst und Hoffnung, dich wiederzusehen. Sie hat dich geliebt, Christoph. Sie hat an dich geglaubt. Das Kind, es ist ein Junge, bekam den Namen Christoph. Seltsam, nicht wahr? Ausgerechnet deinen richtigen Namen, obgleich Isabel den nicht kannte. Aber der wurde dir dann zum Verhängnis. Sie besaß nämlich ein Foto von dir. Heimlich hatte sie dich fotografiert. Ich konnte nicht ständig nach diesem Mann forschen. Ich mußte Geld verdienen, um die Kosten für Isabel und das Kind aufzubringen. Sie war nämlich nicht einmal versichert, da sie noch auf der Modeschule war, als sie dir in die Hände fiel.
Aber es war in München gewesen. Sie hätte dann bei einer alten Tante im Allgäu Zuflucht gesucht. Und dort hatte sie auch das Kind zur Welt gebracht. Nach der Geburt war sie körperlich und seelisch zermürbt. Sie war ein zerstörter Mensch. Aus einem bildhübschen Mädchen war ein Wrack geworden, aber das Kind war gesund.
In mir wuchs ein Haß ohnegleichen, Christoph Wellinger. Und dann lernte ich diesen Hellseher kennen. Ich zeigte ihm das Foto, das Isabel von dir gemacht hat. Er sagte mir, daß du anders heißen würdest, nur der Vorname wäre ähnlich. Und dann zeigte er mir eines Tages auch ein Bild in einer Illustrierten, unter dem dein richtiger Name stand. Da war Isabel schon tot. Sie hat es glücklicherweise nicht mehr erfahren, welchem Lumpenkerl sie einen prächtigen Sohn geboren hatte. Und nun begann ich Jagd auf dich zu machen. Leider mußte ich meine Verträge einhalten. Ich wollte ja meinem Neffen, den ich über alles liebe, eine anständige Ausbildung zuteil werden lassen. Aber ich verdiente genug, um das Privatleben der Familie Wellinger zu erforschen, und siehe da, ich brachte auch in Erfahrung, daß Vera Schlüter während ihrer Ehe ein recht lustiges Leben geführt hatte. Es gab da einige nette Affären, die natürlich vertuscht wurden, denn sie stammte ja aus einer sehr angesehenen, sehr vermögenden Familie. Ich brachte auch in Erfahrung, daß du erst nach achtjähriger Ehe geboren wurdest, und da gab es einen Mann im Leben deiner Mutter, der Pierre Montand hieß. Das war zufällig ein Opernsänger. Es hat mich ein schönes Stück Geld gekostet, dies alles herauszubringen, aber eine Vera Schlüter war zu jener Zeit genauso bekannt wie ein Christoph Wellinger heute. Man brauchte nur in Illustrierten zu forschen. Vor zweiunddreißig Jahren gab es derer noch nicht so viele, und es gab auch noch nicht viele Reiche. Man fing ja ganz von vorne an. Dein Vater mußte hart arbeiten. Er konnte seiner lebenshungrlgen Frau nicht viel Zeit widmen. Nun, ich will es kurz machen. Ich suchte diesen Pierre Montand auf. Inzwischen war ich ja auch eine Opernsängerin. Er hatte große Erfolge gehabt, er war glücklich verheiratet und hatte drei Kinder. An eine Vera Schlüter wollte er sich nicht gern erinnern. Aber ich stellte etwas fest. Du siehst ihm verblüffend ähnlich.«
Ihre Augen waren kalt wie Eiskristalle, als sie auf Christoph herabblickte, der zusammengesunken in dem Sessel saß.
»Und was noch?« murmelte er.
»Ich nahm mir die Freiheit, deinen Vater aufzusuchen und lernte einen Mann kennen, vor dem ich höchsten Respekt habe. Ich habe auch eine mißglückte Ehe hinter mir, und ich kann keine Kinder bekommen. Ich werde deinen Vater heiraten, Christoph.«
Er sprang auf. »Du bist ja wahnsinnig wie deine Schwester«, schrie er.
»Weil er achtzehn Jahre älter ist als ich?« fragte sie sarkastisch. »Er ist ein Mann, den ich bewundere. Und es wird einen Christoph Wellinger geben, auf den er stolz sein kann. Er sieht ihm sogar ähnlich.«
»Und das hat dir alles dieser Hellseher eingeflößt«, sagte er höhnisch.
»Nein, das nicht, aber etwas anderes. Er sagte mir nämlich, daß du noch ein Kind hast, genau genommen noch zwei Kinder, wenn man Kathrin einbezieht. Und dieses Kind werden wir auch suchen, dein Vater und ich. Und es wird auch zu seinem Recht kommen.«
»Und ihr landet im Irrenhaus, dafür werde ich sorgen«, stieß Christoph wild hervor. »Und du, du bekommst kein Bein mehr auf eine Bühne, du Primadonna!«
»Wie jämmerlich du bist«, sagte Georgia verächtlich. »Ich würde dir empfehlen, das Land so schnell wie nur möglich zu verlassen. Du wirst dafür noch eine hübsche Summe bekommen. Ich fahre jetzt zu meinem zukünftigen Mann. Er war es, der vorhin anrief.«
»Ich bringe dich um«, zischte Christoph wutentbrannt.
Sie schüttelte den Kopf. »Dazu bist du zu feige«, sagte sie. »Verschwinde. Du ekelst mich an.«
Und da ging er tatsächlich. Krachend flog die Tür ins Schloß, aber schon kurz darauf griff Georgia zum Telefon.
»Es ist vollbracht, Frieder«, sagte sie verhalten. »Ich komme jetzt zu dir. Es ist ausgestanden.«
Nun. Karl Friedrich Wellinger glaubte dies noch nicht, aber er atmete auf, als er Georgia kommen sah und eilte ihr mit ausgestreckten Armen entgegen.
»Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll«, sagte er leise.
»Oh, ich könnte das gleiche sagen. Aber ich denke. daß wir Chris noch eine Zeit im Internat lassen.«
Er küßte ihr beide Hände. »Du sollst es nie bereuen, Georgia, daß du dem alten Wellinger doch noch Glück ins Haus gebracht hast.«
Sie lachte leise. »Sag nicht, daß du alt bist, mein Freund. Wir haben beide allerhand mitgemacht, aber so manches Schöne werden wir schon noch erleben. Daß es so kommen würde, hätte ich mir allerdings nicht träumen lassen, als ich das erste Mal dieses Haus betrat. Zum ersten Mal in meinem Leben fühle ich mich geborgen.«
»Und ich bin zum ersten Mal richtig glücklich«. sagte er fast andächtig. »Ich habe nicht geglaubt, daß du meinen Antrag annehmen würdest.«
Sie lächelte hinreißend. »Zuerst hast du es ja nur so gedacht, damit Chris ohne Aufhebens zu seinen Rechten kommt«, meinte sie neckend. »Aber nur deshalb allein hätte ich nie ja gesagt, Frieder. Ich habe noch nie einen Mann wie dich kennengelernt, einen Mann, der durch Geld nicht verdorben wurde, der durch Schicksalschläge nicht resignierte und sich auch über grausame Wahrheiten würdevoll hinwegsetzen kann.«
»Nun, würdevoll habe ich diesen Lump heute nicht aus dem Hause gewiesen«, sagte er. »Ich kann ihn nicht mehr sehen, Ich könnte seinen Anblick nicht mehr ertragen, Georgia.«
»Ich auch nicht, aber ich mußte ja erst alle Beweise beisammen haben, bevor ich meine Trümpfe ausspielen konnte.«
»Und die Tournee hast du abgesagt, Georgia?«
»Ich werde noch in Paris und Rom singen, dann ist Schluß.«
»Reut es dich nicht?«
Ihr Blick wanderte in die Ferne. »Es war ein weiter, steiniger Weg, um nach oben zu kommen, Frieder. Es ist ein gutes Gefühl, abtreten zu können auf einem Höhepunkt. Ich bin des Herumreisens müde, und Chris wird es auch genießen, ein richtiges Zuhause haben zu konnen.«
»Du sagtest, er wäre mir ähnlich, aber wenn ich nicht Christophs Vater bin, wie sollte er mir da ähnlich sein?«
»Das habe ich mich auch gefragt. Es ist ja nicht die äußerliche Ähnlichkeit, es sind seine Eigenheiten. Er ist so beharrlich, so aufrichtig, so mutig.«
»Das mag er von dir haben«, sagte Karl Friedrich Wellinger.
»Ich bin ja nicht seine Mutter. Isabel war weich und nachgiebig.«
»Aber du bist seine Tante. Diesbezüglich besteht Blutsverwandtschaft. Ich hoffe, daß er dir äußerlich ähnlich ist.«
»Er ist ein richtiger Junge«, sagte sie lächelnd. »Du wirst es bald feststellen können, Frieder.«
»Frieder hat auch noch niemand zu mir gesagt«, murmelte er, sie in die Arme ziehend.
»Das beanspruche ich auch für mich ganz allein«, erwiderte sie innig, und dann bekam er einen langen, zärtlichen Kuß.
*
Christoph Wellinger raste die Autobahn entlang. Er holte aus dem Wagen heraus, was möglich war, und das war nicht wenig.
Die, an denen er wie der Wind vorbeifuhr, schüttelten den Kopf. Einen Verrückten nannten sie ihn, und vielleicht war er jetzt wirklich so zu nennen. Es war zuviel gewesen, was er zu hören bekommen hatte. Einigermaßen klaren Verstand hatte er nur solange bewahrt, bis er erfahren hatte, wo Pierre Montand lebte, und das war nicht schwierig gewesen. Er kannte ja die Konzertagenten, seit er sich für Georgia Stafford interessiert hatte. Daß sie, ausgerechnet sie, ihm zum Verhängnis werden sollte, hätte er niemals erwartet, und das hätte auch Fee Norden nicht gedacht.
Sie hatte die Samstagszeitung mal wieder sehr aufmerksam gelesen, weil Daniel sich sehr gern von ihr über alles Wichtige informieren ließ, während er mal in aller Ruhe frühstücken konnte.
»He«, rief Fee plötzlich aus, »was sagst du dazu, Georgia Stafford hat ihre Konzerttournee abgesagt. Sie tritt nur noch in Paris und Rom auf. Dann sagt sie der Bühne Adieu.«
»Warum?« fragte Daniel.
»Aus privaten Gründen. Meine Güte, sie wird doch nicht den jungen Wellinger heiraten wollen.«
»Frauen sind unberechenbar«, meinte Daniel schmunzelnd.
»Werde bloß nicht frech«, sagte Fee. »Jedenfalls wäre ich dann nachträglich sehr von ihr enttäuscht.«
»Was hat ihre Stimme mit ihrem Charakter zu tun?« meinte Daniel gelassen.
»Eine Stimme wird nur von der Persönlichkeit geprägt. Mich hat keine Mimi so beeindruckt wie sie.«
»Die arme Mimi starb an einer Lungenkrankheit«, sagte Daniel gleichmütig. »Und wenn eine Opernsängerin sich mit jeder Rolle identifiziert, stirbt sie tausend Tode. Die würde sie wohl auch sterben, wenn sie diesen Widerling heiratet. Na, jedenfalls habe ich den alten Wellinger auf meiner Seite.«
Fee horchte auf. »Das ist ja was Neues«, rief sie aus.
»Ein sehr sympathischer Mann«, sagte Daniel. »Jetzt verstehe ich Stahl, daß er sagte, er wisse nicht, wie er zu diesem Sohn gekommen sei. Ich meine Wellinger zu seinem Sohn. Der wird ihn ja kaum aus einem Heim geholt haben wie Jochen Stahl. Aber ich muß sagen, daß der besser bedient ist.«
»Man weiß nie genau, wie sich ein Kind entwickelt«, sagte Fee nachdenklich. »Du hast noch nicht erklärt, wie du Wellinger auf deine Seite gebracht hast.«
»Ich hab gar nichts getan. Er hat von sich aus dem Vormundschaftsgericht mitgeteilt, daß sein Sohn nicht geeignet sei, einen guten Einfluß auf Kathrin auszuüben, daß mein Attest von ihm nur bestätigt werden könne. Ich denke, daß alles geregelt sein wird, wenn Kathrin wieder vom Tannenhof heimkommt, und daß Jobst von Tammen dann auch die Adoption einleiten kann.«
Danny stürmte ins Zimmer. »Trara, die Post ist da«, schrie er lauthals.
»Wir sind nicht schwerhörig«, brummte Daniel.
»’tschuldigung«, sagte Danny, und dann knallte er die Postsachen auf den Tisch. »Kommst du spielen, Papi?« fragte er.
»Laßt Papi doch noch ein bißchen Ruhe«, sagte Fee. »Laßt ihn wenigstens die Post anschauen.«
»Machst du doch sowieso, Mami«, sagte Danny. »Papi will nur das Angenehme wissen.« Er grinste lausbubenhaft.
»Hast ja recht. Danny«, sagte sein Vater.
»Da ist aber ein Brief von Toby dabei«, sagte Fee.
Danny war schon wieder im Garten. »Das finde ich rührend«, fuhr Fee fort.
»Er wird doch nicht Heimweh bekommen?« meinte Daniel.
So klingt es nicht. Hör mal zu. Lieber Dr. Norden, vielen Dank, daß Sie dafür gesorgt haben, daß Kathrin und ich zum Tannenhof gekommen sind. Es gefällt uns nämlich sehr gut. Tante Annabel ist sehr, sehr lieb. Sie verstehen doch alles so gut. Könnten Sie nicht auch fertigbringen, daß Annabel ganz zu uns kommt, wenn Papi wieder nach Haus kommt? Ich schreibe das heimlich. Aber Ihnen konnte ich doch immer alles sagen. Tante Martina hat Annabel auch sehr gern. Würden Sie bitte mal mit ihr sprechen? Papi hat zu mir gesagt, daß ich die nächste Hausdame selber aussuchen darf, aber ich möchte nur Annabel haben. Wenn Sie mir helfen, habe ich Sie noch mal so lieb. Ihr Toby.
»Da könnten einem die Tränen kommen«, sagte Fee leise.
»Seltsam ist es schon, wenn Toby sich für ein weibliches Wesen so begeistern kann«, sagte Daniel. »Diese Annabel hat auch auf mich einen guten Eindruck gemacht. Aparte Erscheinung und Martina schien sie auch gleich sehr zu gefallen. Ich werde mal mit ihr sprechen.«
»Es wäre ein schlechter Dank für die gute Mutter Hedwig«, gab Fee zu bedenken. »So leicht bekommt sie doch in dieser Abgeschiedenheit keine guten Hilfskräfte.«
»Aber schade wäre es auch, wenn so eine Frau wie diese Annabel nicht eine bessere Chance bekommen würde. Toby ist sehr beharrlich, wie es scheint. Er wird nicht so schnell locker lassen. Er hat Vertrauen zu mir, Fee. Ich darf ihn nicht enttäuschen.«
»Aber es würde doch wohl zu weit gehen, Stahl mit dieser Annabel verkuppeln zu wollen.«
»Davon kann doch wirklich keine Rede sein. Das würde eher Martina fertigbringen.« Er zwinkerte Fee zu. »Bei ihr werde ich auch einen Stein im Brett haben, wenn Kathrin jetzt nicht mehr von Wellinger verängstigt wird. Mich freut’s, Fee. Ist doch mal wieder ein schneller und guter Erfolg.«
»Toby schreibt schon sehr gut«, sagte Fee, als sie den Brief noch mal gelesen hatte.
»Er ist ein kluger Junge, Fee. Zehn Jahre, und er kommt aufs Gymnasium.«
»Ob Danny auch mal mit zehn Jahren solche Briefe schreiben kann?« meinte Fee.
»Na, reden tut er doch wahrhaftig genug«, lachte Daniel, »nur so sauber wird er wohl niemals schreiben. In seinem Zeugnis steht es ja. Die Schrift könnte besser sein.«
»Und was hat er zu seiner Lehrerin gesagt?« lächelte Fee. »Da müßten Sie erst mal sehen, wie mein Papi schreibt.«
»So ein Schlingel«, lachte Daniel schallend.
»Dein Sohn!«
»Unser Sohn! Den Doktors billigt man doch eine Klaue zu.«
»Ich liebe deine Schrift«, sagte Fee.
»Ich deine auch. Wenn du schreibst: Meinem Herzensmann, oder meinem innigstgeliebten Daniel, kann ich jeden Buchstaben lesen.«
Schnell bekam er einen Kuß. »Ich brauche auch nicht zu überlegen, was du niedergeschrieben hast«, sagte sie zärtlich. »Bei Danny muß ich da schon mehr studieren. Aber im Lesen ist er der Klasse weit voraus, das ist auch was wert.«
»Kommst du endlich, Papi?« rief jetzt Anneka, und da erhob er sich. »Schreibst du Toby ein paar Zeilen, Fee?« fragte er. »Maschinenschrift kann er besser lesen. Ich unterschreibe dann.«
Sie lachte leise hinter ihm her. Aber zweimal brauchte er sie nie um etwas zu bitten.
*
Freundlicher Gedanken war Christoph Wellinger nicht fähig. Ich zahle es euch heim, sagte er immer wieder vor sich hin.
Die Grenze nach Frankreich hatte er schon hinter sich gelassen. Aus dem Autoradio schallten französische Chansons. Er mochte sie, aber jetzt rauschten sie an seinen Ohren vorbei.
Pierre Montand, nur dieser Name dröhnte in seinen Ohren. Oh, er wollte es Georgia schon beweisen, daß er sich nicht schocken ließ. Er war ein Wellinger! Irgendwie war es ihm doch bewußt, daß es der Name war, der ihm alle Türen geöffnet hatte, der ihm überall Kredit einräumte.
An Isabel und die anderen Mädchen, denen er seinen richtigen Namen nicht gesagt hatte, wollte er nicht denken. Diese törichten Mädchen, die ihn mit Haut und Haaren haben wollten, hatte er schnell aus seinem Gedächtnis verbannt. Aber doch nicht so ganz, wie ihm nun bewußt wurde. Schattenhaft zogen doch ein paar Gesichter an ihm vorbei. Aber beweisen sollte man es ihm erst einmal, daß er der Vater dieses oder jenes Kindes sei.
Glühender Haß auf Georgia und auf seinen Vater brannte in ihm. Aber sie sollten es noch bereuen, ihn so abschieben, ihn so ausschalten zu wollen.
Dann war er in Paris, und eine andere Erinnerung erwachte in ihm, die ihn plötzlich in schlimme Beklemmungen brachte. Elf Jahre war es her. Er war einundzwanzig geworden und hatte diesen Tag mit ein paar Freunden in Paris gefeiert. Und da hatte ihm ein Mädchen gefallen, das gar nichts von ihm wissen wollte.
Unbewußt machte er eine abwehrende Handbewegung. Warum sollte er darüber jetzt noch nachdenken. Er hatte andere Sorgen. Für ihn stand ein reiches Erbe auf dem Spiel. Er mußte diesen Pierre Montand sprechen, und der mußte den Eid darauf leisten. daß er keine intimen Beziehungen zu seiner Mutter gehabt hatte.
Es war zu spät geworden, um zu dem Vorort zu fahren, in dem Pierre Montand wohnte. Christoph Wellinger suchte das Hotel auf, in dem er schon öfter gewohnt hatte. Auch damals vor elf Jahren. Ein Nobel-Hotel, das seine Preise hatte, aber Geld hatte er ja noch genug, und er war überzeugt, daß sein Vater ihn nicht fallen lassen würde. Bestimmt nicht dann, wenn er ihm den Beweis brachte, daß Georgia log.
Der alte Narr hatte sich von Georgia einfangen lassen. Ihr war jedes Mittel recht, an das ganz große Geld zu kommen. Immer mehr steigerte er sich in solche Gedanken hinein.
Nachdem er zwei Whisky getrunken hatte. Doppelte und pur, griff er zum Telefon Pierre Montands Nummer hatte er bereits in München bekommen und notiert.
Eine helle Stimme sagte »Hallo«. Christoph schluckte.
»Monsieur Montand, bitte.«
Eme undeutliche Antwort kam. Anscheinend war ein Kind am Telefon. Dann aber tönte eine Männerstimme an Christophs Ohr.
Als Christoph seinen Namen nannte, vernahm er einen keuchenden Atemzug.
»Ich muß Sie sprechen. Monsieur Montand, wann kann ich Sie morgen aufsuchen«, fragte er hastig.
»Bitte nicht. Sagen Sie, wo ich Sie treffen kann. Bitte. Ich bin morgen in der Stadt.«
»Gut. Kommen Sie ins Hotel. Gegen zwölf Uhr.« Ein höhnisches Lächeln verzerrte Christophs Gesicht, als Montand sich mit zittriger Stimme bedankte.
Er war überzeugt, mit diesem Mann leichtes Spiel zu haben. Er hatte Familie. Er war in Panik versetzt.
Christoph genehmigte sich noch einen Whisky und ging dann zu Bett. Er schlief bis in den hellen Vormittag hinein. Um den Schlaf hatte ihn bisher noch nichts bringen können. Er ließ sich das Frühstück bringen. nachdem er geduscht hatte und stellte dann fast, daß seine Armbanduhr stehengeblieben war. Da wurde ihm auch schon telefonisch der Besuch von Monsieur Montand angekündigt. Christoph aß weiter, aber ihm blieb dann der Bissen im Halse stecken, als Pierre Montand das Zimmer betrat, denn er sah sein wohl doppelt so altes Ebenbild. Er verschluckte sich, mußte husten, und vielleicht gab diese Tatsache Pierre Montand etwas mehr Sicherheit, obgleich auch er den Jüngeren mit schrekkensweiten Augen anblickte.
»Wir hätten uns besser an einem neutralen Ort treffen sollen«, sagte er rauh, nachdem sich Christophs Husten legte und er mit blaurotem Gesicht noch nach Luft rang.
Christoph war völlig sprachlos, ja, er stand unter einem schweren Schock.
»Das habe ich nicht geahnt«, brachte er endlich mühsam über die blassen Lippen.
»Es tut mir leid, für Sie und auch für mich«, sagte Pierre Montand leise. »Ich habe Familie. Ich bin glücklich verheiratet. Ich ahnte nicht, daß es nach diesen vielen Jahren noch bekannt werden würde. Frau Stafford versprach mir, daß es nicht publik werden würde. Sie hat mir nicht einmal gesagt, welches Interesse sie an dieser alten Affäre hat. Sie hat mich angesehen und gesagt: Es genügt. Das war alles. Und jetzt weiß ich, warum sie es sagte. Wir sollten uns nebeneinander vor einen Spiegel stellen.«
Christoph kniff die Augen zusammen. »Nein, danke, mir genügt es auch«, sagte er gereizt. »Ich werde dafür gestraft, ich bin das unschuldige Opfer.«
»Mußt du so mit mir sprechen?« fragte Montand leise. »Hattest du dir nie etwas vorzuwerfen?«
»Gehen Sie«, sagte Christoph heiser, »gehen Sie mir aus den Augen. Sie haben kein Recht, mir etwas vorzuwerfen.«
»Ich wollte Vera heiraten«, sagte Montand leise. »Aber das wollte sie nicht. Ich hätte ihr nicht das bieten können, was sie gewöhnt war.«
Christoph hielt sich die Ohren zu. »Ich will das nicht hören. Ich will nichts mehr hören.. Wären Sie doch auch tot, dann wäre es niemals bekannt geworden.«
Montand starrte ihn blicklos an. »Adieu«, sagte er leise. »Ich wäre auch froh, wenn wir uns nie begegnet wären, wenn die Vergangenheit mich nicht eingeholt hätte. Ich hoffe, daß Sie nicht auch so sehr für einen Fehler bezahlen müssen wie ich.«
»Ich verliere mehr als Sie«, sagte Christoph schrilI, und dann deutete er auf die Tür. Er wußte, daß er auch diese Runde verloren hatte.
Pierre Montand zeigte jetzt Haltung, ja sogar Würde. »Ich hätte gern gesagt, daß ich nicht Ihr Vater bin«, sagte er tonlos, »aber leider spricht die Ähnlichkeit eine deutliche Sprache. Ich bedauere das zutiefst.«
Dann schloß sich die Tür hinter ihm, bevor Christoph noch etwas sagen konnte.
Und nun hatte die Erinnerung auch ihn eingeholt, sogar doppelt und dreifach. Er wurde von innerer Unruhe getrieben. Um sich abzulenken, beschloß er einen Stadtbummel zu machen und nach ein paar alten Bekannten Ausschau zu halten, weiblichen Bekannten natürlich.
Als er das Hotel verließ, saß an der Reception ein junges blondes Mädchen, und da war wieder die Vision. Auch vor elf Jahren hatte da ein junges blondes Mädchen gesessen. Ein bildhübsches Mädchen. Er hatte seinen ganzen Charme aufgewendet, um sie zu einem Rendezvous zu überreden, aber sie hatte nur den Kopf geschüttelt. Und dann war der Abend gekommen, oder besser die Nacht, in der er sie im Lift traf.
Das Mädchen, das jetzt an der Reception saß, wurde gerade abgelöst.
Anmutig schritt sie an ihm vorbei, warf ihm einen kurzen Blick zu und ging schnell hinaus. Er folgte ihr. »Hallo«, sagte er. Sie wandte kurz den Kopf und maß ihn mit einem spöttischen Blick. Dann ging sie weiter, und schon kam ein breitschultriger junger Mann auf sie zu, ein sehr sportlicher Typ. Er küßte das Mädchen, sie sagte etwas zu ihm, und dann traf Christoph ein funkelnder Blick. Er zog es vor, schnell ein Taxi zu besteigen, das gerade am Straßenrand hielt. Christoph ließ sich zu den Champs Elysees bringen. Dort bummelte er ziellos herum, bis sein Blick dann auf das Plakat fiel, das das Gastspiel von Georgia Stafford ankündigte. In drei Tagen würde sie hier sein. Seine Augen wurden ganz eng. Nun, er würde bleiben, und sie würde ein Zusammentreffen nicht verhindern können. Langweilen würde er sich bis dahin bestimmt nicht.
Aber es war seltsam, überall, wohin er auch ging, sah er blonde grazile Mädchen, und immer wieder meinte er ein ganz bestimmtes zu sehen, in dessen Augen tödliche Verachtung brannte. Und damals, vor elf Jahren, hatte er zum ersten Mal aus einem schönen Mund die Worte gehört: Sie Lump, widerwärtiger Lump. Und nun verfolgten ihn diese Worte auf Schritt und Tritt und flößten ihm eine Angst ein, der er nicht Herr werden konnte.
*
»Ich werde dich nach Paris begleiten, Georgia«, sagte Karl Friedrich Wellinger.
»Du kannst doch nicht weg, Frieder«, erwiderte sie nachsichtig.
»Warum denn nicht? Es wird auch ohne mich gehen. Ich habe so ein dummes Gefühl. Christoph ist nicht mehr in München. Er weiß von deinen Gastspielen in Paris und Rom, und dort könnte er dir auflauern. Ich habe hier keine ruhige Minute.«
»Er ist feige, Frieder«, sagte Georgia ruhig. »Nichts ist ihm soviel wert wie sein Leben und seine Freiheit.«
»Aber bisher hat er sich sicher gefühlt als mein Sohn«, sagte der Mann. »Ich komme mit.«
»Gut, dann können wir einen kurzen Besuch bei Chris machen. Ich weiß ja, wie sehr du darauf brennst, ihn zu sehen.«
Zur gleichen Stunde weilte Dr. Norden bei Martina von Tammen. Ihr Mann hatte ihn um seinen Besuch gebeten, weil Martina sich nicht wohl fühlte. Jobst von Tammen war der Meinung, daß die Aufregungen der letzten Wochen seiner Frau geschadet haben könnten, doch diesbezüglich konnte Dr. Norden das Ehepaar beruhigen. Ein freudiges Ereignis stand ins Haus, das konnte er ihnen sagen, und damit vertrieb er augenblicklich alle noch vorhandenen Sorgen.
Es herrschte eine so freudige Stimmung, daß er auch von Tobys heimlichen Wünschen erzählen konnte.
Ein wenig überrascht war Martina schon, aber dann lächelte sie vergnügt. »Den richtigen Instinkt hat der Junge schon«, sagte sie gedankenvoll. »Ein ungemein liebes Geschöpf ist diese Annabel. Ja, solche Frau würden wir Jochen wünschen.«
»Toby denkt wohl einstweilen nur an eine Hausdame, die nach seinem Geschmack ist«, meinte Daniel Norden.
»Kinder haben ihre Träume, sie sprechen nicht immer darüber«, sagte Martina sinnend. »Ich weiß noch genau, wie Kathrin zum ersten Mal sagte: Warum kann ich nicht einen Papi haben wie Onkel Jobst. Eigentlich ging mir da erst ein Licht auf, daß ich meinem wahren Glück selbst im Wege stand. Und plötzlich fielen dann all die Hemmungen von mir ab. Ich war nicht mehr bereit, Konzessionen zu machen.«
»Und ich hatte endlich den Mut, Martina zu sagen, wie sehr ich mir wünschte, sie aus dieser Hölle endlich zu befreien«, warf Jobst ein. »Ich werde es übernehmen, mit Jochen zu sprechen. Wir sind schon lange Freunde.«
»Kannten Sie ihn schon vor seiner Heirat?« fragte Dr. Norden aufhorchend.
»Nein, erst seit er bei Wellinger anfing. Karl Friedrich lud uns öfter mal zu einem Essen ein. Jochens Frau kränkelte damals schon, und er hatte es auch immer eilig, heimzukommen zu seinem Jungen. Er machte mir erst bewußt, wie unterschiedlich Väter sein können, denn Christoph nahm von Kathrin kaum Notiz. Ich wollte, es wäre so geblieben, dann wäre uns auch wirklich viel Kummer erspart geblieben.«
»Aber nun ist auch das bald durchgestanden«, sagte Dr. Norden.
»Und das haben wir nicht zuletzt Ihnen zu verdanken«, sagte Martina voller Wärme.
»Wohl doch in erster Linie dem alten Wellinger«, sagte Dr. Norden.
»Sagen Sie bloß nicht alt, wir haben heute von ihm selbst erfahren, daß er Georgia Stafford heiraten wird.«
»Georgia Stafford?« rief Dr. Norden staunend aus. »Wurde sie nicht im Zusammenhang mit dem jungen Wellinger genannt?«
»Ja, das wurde sie«, bestätigte Martina, »aber ich konnte mir gleich nicht vorstellen, daß eine Frau von ihrem Format auf ihn hereinfällt, eine reife Frau, die die Welt schon gesehen und die Menschen kennengelernt hat.« Sie errötete. »Ich verstehe mich heute auch nicht mehr«, fügte sie verlegen hinzu.
»Es ist vorbei, mein Liebes«, sagte Jobst. »Ich bin gespannt, was Kathrin sagen wird, daß sie ein Geschwisterchen bekommen wird.«
»Das weiß ich jetzt schon«, lächelte Martina, »sie wünscht sich einen Bruder, und wir wollen hoffen, daß wir ihr diesen Wunsch erfüllen können. Ich bin sehr glücklich.«
»Ich auch«, sagte Jobst, »auch wenn es ein Mädchen sein wird.«
Dr. Norden konnte zufrieden heimfahren, und er pfiff vergnügt vor sich hin, als er sein Haus betrat.
»Du bist aber gut gelaunt«, meinte Fee.
»Immer, wenn ich bei euch bin«, erwiderte er.
»Aber meistens brauchst du schon eine Ruhepause, bevor du vergnügt bist«, sagte sie.
»Ich bringe auch gute Nachrichten, mein Schatz. Bei den Tammen hat sich Nachwuchs angekündigt.«
»Oh, das freut mich«, sagte Fee.
»Und Jobst von Tammen wird Dr. Stahl mal wegen der netten Annabel einheizen. Aber jetzt möchte ich mein Familienleben genießen. Wer weiß, wie lange mir das vergönnt ist.«
Wenigstens zwei Stunden verliefen ungestört, dann wurde er zu einem dringenden Hausbesuch gerufen.
*
Annabel machte sich an diesem Abend Sorgen um Toby. Er war schon ziemlich teilnahmslos gewesen, seit die Post verteilt worden war, obgleich er einen Brief aus Ägypten bekommen hatte.
Doch Annabel war es aufgefallen, daß die Anschrift mit der Maschine geschrieben war und nicht in Jochen Stahls großzügiger Handschrift.
Als sie das Zimmer der beiden Buben betrat, lag Toby schon im Bett.
»Ich glaube, Toby ist richtig krank, Tante Annabel«, sagte Jan. »Er hat überall rote Flecken. Ich wollte dich gerade rufen.«
Rote Flecken? So was war immer ein Alarmsignal für die Betreuerinnen. Aber die beiden Krankenzimmer waren schon mit anderen Kindern belegt.
»Geht es sehr schlecht, Toby?« fragte sie besorgt, »oder kannst du laufen? Ich möchte dich nämlich in mein Zimmer bringen, bis der Arzt kommt.«
In ihr Zimmer, hatte sie gesagt, und da hätte Toby ganz schnell laufen können. Was ihn drückte, war nur ein gewaltiger Kummer, und er wußte ja schon, daß er dann immer diese roten Flecken bekam.
»Es geht schon«, brummte er. »Anstecken will ich Jan nicht.«
Jan war sehr traurig, aber er wollte doch nicht, daß Toby richtig krank sein sollte, und selbst krank werden wollte er auch nicht, damit er wiederum seiner Maxi keinen Kummer bereitete.
»Ist nicht schlimm, Annabel«, sagte Toby, als sie in ihrem Zimmer angekommen waren. »Ich kenne so was schon. Ich wollte bloß lieber allein mit dir sprechem Alles braucht Jan auch nicht zu wissen. Es ist nämlich wegen dieser blöden Ziege. Sie hat mir geschrieben.«
»Welche blöde Ziege?« fragte Annabel.
»Papis Sekretärin. Ich weiß doch, daß sie es auf ihn abgesehen hat. Du kannst den Brief ruhig lesen. Ich muß nämlich mit dir reden, weil ich nicht weiß, was ich Papi schreiben soll.«
Der Brief war schon ganz zerknautscht, der Annabel jetzt in die Hand gedrückt wurde.
»Sie schreibt so, als ob ich noch ein Baby bin«, knurrte Toby. »Das ist auch so ein Weib, das kann ich dir sagen. Du ahnst ja nicht, was ich schon alles mitgemacht habe.«
Annabel unterdrückte ein Lächeln, aber insgeheim dachte sie doch, ob Tobys interessanter Vater daran nicht auch ein bißchen schuld sei.
»Lies nur!« sagte Toby.
»Ich muß Dr. Brettschneider anrufen, Toby«, sagte Annabel.
»Brauchst du nicht. Ich kenne das schon. Die Flecken kommen immer, wenn ich mich aufrege. Die gehen auch wieder weg.«
»Wir müssen aber wenigstens Fieber messen«, sagte sie.
»Mache ich«, erklärte sich Toby bereit.
Er steckte das Fieberthermometer auch gleich in den Mund. Darin hatte er schon beträchtliche Übung. Aber dabei beobachtete er Annabel, als sie den Brief las.
Lieber Toby, heute schreibe ich Dir, weil Dein Papi so arg viel zu tun hat. Er hat mich zwar nicht darum gebeten, aber ich tue es gern. Das Klima hier bekommt ihm auch nicht gerade gut, und weil Du dauernd von dieser Annabel schreibst, macht er sich auch Sorgen, daß Du ihn nicht mehr so lieb haben könntest. Es wird ja nicht mehr lange dauern, bis wir wieder zu Hause sind, und dann ist auch bald Dein Geburtstag. Den werden wir gemeinsam feiern, und Du darfst Dir auch von mir etwas ganz Schönes wünschen. Dein Papi würde sich bestimmt sehr freuen, wenn Du auch mal an mich schreiben würdest. Und einen ganz langen Wunschzettel kannst Du beifügen. Ich weiß ja, wie so einem kleinen Jungen zumute ist, wenn er plötzlich in einer fremden Umgebung ist, und ob so eine Tante auch nett zu ihm ist. Aber sie muß ja zu allen Kindern nett sein. Dafür wird sie bezahlt. Ich habe Dich aber gern, weil ich mich auch mit Deinem Papi gut verstehe, und das wollte ich Dir sagen. Du brauchst es ihm ja nicht gleich wieder zu schreiben. Es grüßt Dich herzlich, Deine Linda.
»Ich bin sauer«, sagte Toby, als Annabel den Brief sinken ließ.
»Warum bist du sauer?« fragte Annabel.
»Weil sie weiß, was ich an Papi schreibe. Ich kann mir nicht vorstellen, daß er mit ihr darüber redet. Was wir uns zu sagen haben, darüber reden wir nämlich mit niemandem.«
»Mit mir redest du doch aber auch über deinen Papi, Toby«, sagte Annabel sanft.
»Das ist ganz was anderes«, sagte der Junge. »Die Krauss kann ich nicht leiden. Sie ist immer so aufgetakelt. Und Papi hat mir außerdem versprochen, daß niemand ins Haus kommt, den ich nicht leiden kann. Er will ja nicht, daß ich krank werde.«
Fieber hatte er jedenfalls nicht, und nun verblaßten die Flecken auch schon wieder. Annabel kannte solche Zustände. Sie kannte sie aus eigener Erfahrung. Sie war auch so sensibel.
»Sie soll mir bloß nichts schenken«, knurrte Toby. »Das gucke ich gar nicht an.«
»Wann hast du eigentlich Geburtstag?« fragte Annabel.
»Am zwanzigsten September. Da werde ich zehn, und da gehe ich dann schon aufs Gymnasium.«
Annabel zuckte zusammen. »Am zwanzigsten September«, wiederholte sie leise.
»Und dich lade ich ein, aber nur dich«, sagte Toby. »Kommst du auch, Annabel?«
»Ich kann hier doch nicht weg, Toby«, sagte sie.
»Doch, das ist ein Sonntag, und da hast du doch manchmal frei. Und außerdem ist dann auch Jans Tante Maxi schon hier. Ich habe schon alles überlegt.«
»Ich kann es dir wirklich nicht versprechen, Toby«, erwiderte Annabel mit belegter Stimme.
»Aber wenn ich krank wäre, dann würdest du mich schon besuchen«, sagte er drängend.
»Warte doch erst mal ab, bis dein Papi wiederkommt«, sagte sie leise. »Du weißt doch gar nicht, wie er denkt.«
»Doch, das weiß ich. Du kannst ja auch den letzten Brief von ihm lesen. Mein Papi freut sich, daß ich mich so gut mit dir verstehe, und deshalb lügt die Linda Krauss auch. Sie will ihn bloß für sich haben, aber da kann sie sich die Zähne ausbeißen«, sagte Toby grimmig. »Da ist auch der Brief von Papi.«
Aber den wollte Annabel nicht lesen, doch sie mußte. Er drängte solange, bis sie ihn auseinanderfaltete.
Mein lieber Toby, ich bin sehr froh, daß Du Dich wohl fühlst und Dich mit Annabel so gut verstehst. Aber Du schreibst meist von ihr. Bist Du mit Kathrin nicht mehr soviel beisammen. Hoffentlich gefällt es ihr genauso gut. Natürlich freut es mich auch, daß Jan Dein Freund ist. Es ist gut, wenn man einen Freund hat. Ich vermisse es sehr, daß ich mich mit niemandem ernsthaft unterhalten kann. Allerdings bin ich abends auch immer sehr müde. Das Klima ist anders als bei uns, und ich muß mich tatsächlich um alles kümmern. lch bin froh, wenn die Zeit um ist und wir wieder zu Hause sein werden. Aber Du scheinst fast lieber im Tannenhof zu sein. Bitte, versteh, daß ich Deine Annabel nicht einfach fragen kann, ob sie für immer zu uns kommen würde. Sie ist Erzieherin und keine Hausdame. Es geht nicht darum, ob ich ihr das gleiche Gehalt zahlen könnte. Daran würde es bestimmt nicht liegen, mein Junge. Du weißt, daß ich zu allem bereit bin, was Dich glücklich macht. lch habe große Sehnsucht nach Dir und verspreche Dir, daß ich nie was tun würde, was Dich betrüben könnte. Du bist für mich das Wichtigste in meinem Leben. Mit lieben Gedanken und Grüßen, Dein Papi.
Tief berührt wurde Annabel von diesem innigen Brief. Sie hatte schon viele gelesen, die Väter ihren Kindern geschrieben hatten, die sie vorlesen mußte, weil die Kinder selbst nicht lesen konnten, aber niemals hatte sie aus den Zeilen eine so innige Verbundenheit gespürt.
»Ja, ich hab’s geschrieben, daß ich dich am liebsten immer bei uns haben möchte, Annabel«, sagte Toby. »Ich weiß doch selber nicht, warum ich dich so lieb habe. Ich habe dich eben einfach lieb, und deshalb bin ich gern auf dem Tannenhof. Nicht wegen Kathrin. Sie ist ja noch so klein. Sie sagt immer, daß sie mich mal heiraten will, wenn wir erwachsen sind, aber man weiß doch nie, wie alles kommt. Das ist doch jetzt bloß so ein Gerede. Aber ich darf doch sagen, daß ich dich lieb habe. Oder willst du das nicht?« fragte er ängstlich.
»Doch, es macht mich glücklich, Toby«, sagte sie leise. »Man kann nicht alle Kinder, die man betreut, gleich liebhaben, und dich habe ich nun mal sehr lieb, wenn ich das auch nicht sagen dürfte.«
»Ich sag’s ja auch nicht weiter«, flüsterte er. »Aber ich bin so froh, wenn ich mal mit dir allein sein kann. Dafür würde ich auch mal wieder krank sein.«
»Um Himmels willen, bloß nicht, dann dürfte ich ja gar nicht zu dir«, rief sie aus. Und dann nahm sie ihn in die Arme und streichelte sein krauses Haar. Aber was sie dabei fühlte, konnte auch der Junge nicht ermessen. Er fühlte sich nur geborgen.
»Und nun schreibe ich der Krauss erst recht nicht, aber Papi schreibe ich, daß er ihr sagen soll, daß ich nicht will, daß sie mir schreibt, und daß sie mir ja nichts schenken soll. Und ich schicke ihm auch das Bild, wo wir beide drauf sind, nur wir beide, wenn Jan es auch ein bißchen verwackelt hat. Oder darf ich dich mal fotografieren, Annabel?«
»Meinetwegen darfst du auch das«, erwiderte sie, denn in dieser Stunde hätte sie ihm keinen Wunsch abgeschlagen.
Schon am nächsten Tag machte Toby, frei von allen roten Flecken, die Fotos von Annabel, und sie entwickelte den Film und machte die Abzüge selbst. Das war ihr Hobby und bewies, wie vielseitig sie war. Toby konnte seinem Vater wieder nur Erfreuliches berichten und seinem Brief auch Fotos von sich und Jan und von Kathrin und Nadine beifügen. Es waren alles sehr gelungene Aufnahmen, auf die er ebenso stolz sein konnte wie Annabel. Und an diesem Tag begaben sich Karl Friedrich Wellinger und Georgia auf die Reise nach Paris, die im Schwarzwald für ein paar Stunden unterbrochen werden sollte.
»Wir werden Chris erst alles sagen, wenn wir ihn zu uns holen«, sagte Georgia. »Darum bitte ich dich, Frieder. Ich möchte nicht, daß der Junge jetzt in Unruhe versetzt wird.«
»Aber wir werden ihm sagen, daß wir heiraten«, erklärte er.
Sie lächelte weich. »Das ist doch vorerst die Voraussetzung, daß er ein richtiges Zuhause bekommt. Was sollte er sonst denken? Ganz sacht müssen wir ihn mit den Tatsachen vertraut machen. Ich muß dir noch etwas sagen, Frieder.«
»Nur heraus mit der Sprache. Ich bin von dir auf einiges gefaßt. Nur darfst du nicht sagen, daß du dich doch für die Karriere entschieden hast.«
»Das bestimmt nicht. Ich wollte dich nur vorbereiten, daß du nicht erstaunt bist, wenn Chris Mami zu mir sagt. Das hat er von Anfang an getan, und ich habe es ihm nicht ausgeredet.«
Karl Friedrich Wellinger drückte schnell ihre Hand. »Du hast ja auch wie eine liebevolle Mutter für ihn gesorgt, Georgia«, sagte er.
»Dafür bekomme ich jetzt eine richtige Familie«, sagte sie jetzt glücklich.
Dann, als sie bei dem Internat ankamen, hatte er doch plötzlich so ein ganz eigenartig leeres Gefühl in sich, eine Mischung von atemloser Erwartung und Bangigkeit.
Aber da kam ein Junge herangestürmt, blond und kräftig, aber Georgia auf unverkennbare Weise ähnlich.
»Mami, Mami«, schrie er lauthals und umarmte sie stürmisch, daß sie sich nur halten konnte, weil Karl Friedrich sie stützte.
Und dann blickten ihn Augen an, die die Farbe dunklen Bernsteins hatten.
»Das ist Karl Friedrich Wellinger, Chris«, sagte Georgia mit schwingender Stimme, »der Mann, den ich heiraten will.«
Will betonte sie und erntete dafür einen dankbaren Blick von ihm.
»Ich hoffe, daß du einverstanden bist, Chris«, sagte er stockend.
»Wir werden schon zurechtkommen«, sagte der Junge. »Wenn Mam dich mag, muß schon was an dir dran sein. Na, du bist wenigstens ein richtiger Mann.«
Das war kein Anpasser, kein Jasager aus Egoismus, das war ein richtiger Junge, wie Karl Friedrich Wellinger sich einen Sohn gewünscht hätte, und er wußte, daß es Georgia zu verdanken war, daß Chris so geworden war.
»Wir werden uns bestimmt gut verstehen«, sagte er. »Wann gibt es Zeugnisse?«
»Nächste Woche schon«, erwiderte Chris. »Aber es hapert nur mit Latein. Und außerdem bin ich kein Streber.«
»Aber seine Zeugnisse waren immer gut«, warf Georgia ein.
»Dann wird es wohl auch in München nicht viel schlechter werden«. meinte Karl Friedrich. »Wir wollen dich dann nämlich gleich abholen, Chris.«
»Aber heiraten dürft ihr vorher nicht. Da will ich dabei sein«, erklärte der Junge.
»Das ist doch Ehrensache«, sagte der Mann. »Ich begleite Georgia jetzt nach Paris, und auf dem Rückweg holen wir dich ab. Einverstanden?«
»Toll, aber später möchte ich auch mal nach Paris«, sagte Chris. »Wenn es euch auch Spaß macht«, fügte er aber rasch hinzu.
»Es wird sich alles finden, Chris«, sagte Georgia. »Es gibt schönere Plätze als die Großstädte. Du lernst erst mal München richtig kennen.«
»Der Tierpark soll toll sein«, sagte Chris. »Das hat mir schon ein Schulfreund erzählt.« Dann zwinkerte er Karl Friedrich zu. »Gehn wir auch mal ins Olympiastadion zu einem Fußballspiel?«
»Meinetwegen auch das.«
»Und wie soll ich zu dir sagen?« fragte Chris.
»Das kannst du dir aussuchen.«
»Dann sage ich Paps, das klingt nicht so kindisch, okay?«
»Okay«, erwiderte Karl Friedrich Wellinger.
»Bist du zufrieden, Frieder?« fragte Georgia, als sie weiterfuhren.
»Mehr als das«, erwiderte er gedankenverloren. »Mein Leben hat doch noch einen Sinn. »Wenn ich ihn adoptiere, wird er auch Wellinger heißen. Er bräuchte nicht zu erfahren, daß sein Vater so mies ist.«
»Er soll es erfahren, Frieder. Er soll unterscheiden lernen zwischen gut und böse. Er wird es verkraften, wenn er dich als Vorbild hat. Er soll ein ganzer Mann werden, wie du.«
»Du wirst alles richtig machen«, sagte er und drückte schnell ihre Hand.
*
Für Christoph Wellinger hatte Paris allen Reiz verloren. Claudine war verreist, Anik zeigte ihm die kalte Schulter. Sie war seit drei Wochen verlobt und hatte ihm sarkastisch zu verstehen gegeben, daß es verläßlichere Männer gäbe als ihn. Und er litt unter der Zwangsvorstellung, daß Georgia seinem Vater auch noch andere Beweise seiner unrühmlichen Vergangenheit präsentieren könne. Er sah abwechselnd die schemenhaften Gestalten zweier blonder Mädchen, und das artete zum Verfolgungswahn aus.
Jetzt dachte er nicht mehr daran, an Georgia Rache zu nehmen. Er wollte ihr entfliehen, so weit wie nur möglich. Er wollte an nichts mehr erinnert werden.
Weg von Paris, war sein einziger Gedanke, als er seinen Koffer in den Wagen warf und Richtung Süden fuhr. Die Cote d’ Azur, vielleicht Monte Carlo, ja da konnte er sich auf andere Gedanken bringen, und wenn er jetzt schon kein Glück in der Liebe hatte, hatte er es vielleicht im Spiel.
Er raste die Autobahn entlang, ein Geschwindigkeitsrausch erfaßte ihn. Da brauchte er nicht zu denken, da brauchte er nur das Gaspedal niederzudrücken. Der Wagen gehorchte ihm, den beherrschte er, der muckte nicht auf. Wirklich nicht? Was waren das für Geräusche, die selbst die laute Radiomusik übertönten, diese Stimmen, die in seinen Ohren dröhnten. Du Lump, du widerlicher Lump, rühr mich nicht an, wage es nicht.
»Hört auf, hört endlich auf!« schrie Christoph, aber dann war es ihm, als wären vor ihm unzählige blonde Mädchen, die einen wilden Reigen vollführten. Zu spät wurde ihm bewußt, daß ein gelber Wagen einen silberfarbenen überholte. Er wollte noch an dem gelben vorbei, aber er verlor die Gewalt über den Wagen und mit irrsinniger Geschwindigkeit prallte er gegen die Begrenzungsplanke. Das Krachen vernahm er schon gar nicht mehr.
Ein bewußtloser Mann hing über dem Steuer des gelben Wagens, eine völlig benommene junge Frau kletterte aus dem demolierten silberfarbenen. Kinder schrien und auf der Autobahn herrschte das totale Chaos.
Viele harte Flüche wurden dem toten Christoph Wellinger in die Ewigkeit nachgeschickt. Viele Tränen waren seinetwegen geweint worden, Blut und Tränen hinterließ er bei seinem Tod.
*
Karl Friedrich Wellinger wußte, in welchem Hotel Christoph abstieg, wenn er in Paris war, und er rief dort an, um sich zu erkundigen, ob er dort sei. Er erfuhr, daß er mittags abgereist wäre.
»Er hat gewaltigen Respekt vor dir, Georgia«, sagte er sarkastisch. »Er ist nicht in Paris geblieben.«
»Vielleicht ist er in ein anderes Hotel umgezogen«, meinte sie skeptisch.
»Nein, ich kenne ihn. Nur das Teuerste ist gut genug für ihn. Er war hier. Er ist erst heute abgereist. Er wußte, daß du heute hier eintreffen würdest. Ich denke, daß er sich dafür entschlossen hat, nicht alles aufs Spiel zu setzen und sich nun doch mit dem zu begnügen, was ich ihm angeboten habe. Auf Geld verzichtet er schwerer als auf Frauen. Und er weiß. daß ich nicht mit mir spaßen lasse.«
Georgia überlegte. »Vielleicht ist er nach Paris gekommen, um Pierre Montand zu sprechen«, sagte sie nachdenklich. »Das werde ich bald in Erfahrung bringen. Willst du mit ihm sprechen, Frieder?«
Zuerst schüttelte er den Kopf, aber dann sagte er: »Warum eigentlich nicht, wenn er dazu bereit ist?«
»Ich werde das arrangieren«, sagte Georgia. »Wahrscheinlich werde ich ihn auf der Probe treffen. Man beschäftigt ihn noch. Seine gute Zeit ist vorbei, und er hat Familie.«
»Er tut dir also leid!«
»In gewisser Weise schon. Ich habe da etwas heraufbeschworen, was er vergessen glaubte.«
Und weit entfernt von Hans im Kinderheim Tannenhof, gab es auch einen Menschen, in dem Erinnerungen wach wurden, die lange Jahre verdrängt worden waren.
Annabel Frank wanderte zu abendlicher Stunde, als die Kinder nun alle schliefen, durch den Park und versuchte, ihre innere Ruhe wiederzufinden. Toby hatte so viel in ihr geweckt, was sie verdrängt hatte. Seine Anhänglichkeit, seine immer wiederkehrende Bitte, doch zu ihnen zu kommen, hatte sie in einen tiefen Zwiespalt gestürzt.
Ihr Blick wanderte zum Sternenhimmel empor, als könne ihr von dort Hilfe kommen. Aber zu lange schon hatte sie sich von Gott verlassen gefühlt, als daß sie noch Hoffnung haben konnte. Doch plötzlich war es ihr, als würde eine Last von ihr genommen, die sie mit sich herumgeschleppt hatte. Auf eine unerklärliche Welse fühlte sie sich befreit, aber erst viel später sollte sie erfahren, warum dies geschah, an diesem Tag und zu dieser Stunde.
*
Georgia war zur Verständigungsprobe gefahren. Sie hatte Karl Friedrich überreden konnen, im Hotel zu bleiben und sich auszuruhen.
»Ich fahre mit dem Taxi hin und komme so auch wieder zurück. Du brauchst dir keine Gedanken zu machen, Frieder«, hatte sie gesagt. Es ist besser, wenn Montand dich nicht gleich sieht. Laß mich erst mit ihm reden. Wenn er einverstanden ist, bringe ich ihn nachher mit.«
Er überließ es ihr gern, die Entscheidungen zu treffen. Alles, was sie tat, war wohlüberlegt und doch mit vom Gefühl bestimmt. Für ihn war diese Frau ein Wunder, ihr Mut, ihre Intelligenz, ihre Herzenswärme und die Zielstrebigkeit, etwas Begonnenes auch zu Ende zu führen, forderte Respekt, eine Hochachtung, wie er sie nie für eine Frau vorher empfunden hatte.
Und nicht nur sie, auch Chris, dieser frische Junge, würden fortan Freude in sein bisher so freudloses Leben bringen So alt hatte er werden müssen, um nun sogar träumen zu können. Er schaltete das Radio ein. Ein Kammerorchester spielte. Auch Musik würde nun sein Leben mit Georgia begleiten. Für ihn würde sie singen, nur für ihn, nicht für diese Menschen, die ihr morgen noch einmal zujubeln konnten.
Dann verstummte die Musik, und die Nachrichten kamen. Nachrichten aus aller Welt, die an seinen Ohren vorüberrauschten, bis er dann emporgeschreckt wurde durch seinen eigenen Namen.
»Das Unglück ereignete sich auf der Autobahn. Erst jetzt konnte der Unglücksfahrer, der anscheinend die Gewalt über seinen schnellen Sportwagen verloren hatte, identifiziert werden. Es handelt sich um den Sohn des Großindustriellen Wellinger.«
Obgleich Karl Friedrich Wellinger die französische Sprache gut beherrschte, hatte er nicht alles verstanden. Er hatte ja auch nicht aufmerksam zugehört, weil er nicht ahnen konnte, was er da hören würde.
Jetzt sprang er auf. Ein paar Minuten lief er durch den Raum. Dann griff er zum Telefon und bat den Hoteldirektor zu sich.
Der kam sofort, und man sah es ihm an, daß er die Nachrichten ebenfalls gehört hatte.
Er drückte höflich, aber doch reserviert sein Bedauern aus, und er war sichtlich erstaunt, als sein prominenter Gast ruhig sagte, daß er doch bitte genaue Informationen über den Unfallvorgang in Erfahrung bringen möge.
»Ich werde mich bemühen«, sagte er.
»Man wird mich informieren wollen. Sagen Sie bitte, daß ich hier zu erreichen bin«, entgegnete Karl Friedrich Wellinger.
In der Oper hatte man keine Nachrichten gehört. Da stand Georgia im Mittelpunkt, und sie wurde von Fragen bestürmt, warum sie von der Bühne Abschied nehmen wolle.
»Ich werde heiraten und mich ins Privatleben zurückziehen«, erklärte sie lächelnd. Sie war die Ruhe selbst und erklärte sich auch zu einem Interview bereit.
Dann entdeckte sie Pierre Montand. Sie ging auf ihn zu. Ein nervöses Zucken lief über sein Gesicht. Er vemeigte sich tief.
»Ich habe sehr gehofft, Sie kurz sprechen zu dürfen«, sagte er leise.
»Warten Sie nachher bitte draußen auf mich«, bat Georgia. »Ich möchte Sie auch sprechen.«
Und sie war froh, als sie den Reportern endlich entkommen konnte. Jetzt genoß sie es nicht mehr, berühmt zu sein. Sie wollte ihre Ruhe haben. Es bereitete ihr Genugtuung, jetzt abtreten zu können. Als sie gesagt hatte, daß sie Karl Friedrich Wellinger heiraten würde, hatte sie sich an der Sprachlosigkeit der Frager weiden können. Pierre Montand hatte es nicht gehört, sonst hätte er wohl die Flucht ergriffen.
Er wartete draußen, bescheiden und zurückhaltend, und er war maßlos überrascht, als Georgia seinen Arm ergriff und ihn zum Taxi dirigierte.
»Ich möchte Sie bitten, mich ins Hotel zu begleiten, Pierre«, sagte sie freundlich. »Mein zukünftiger Mann möchte Sie kennenlernen.«
»Mich? Warum mich?« fragte er konsterniert.
»Mein zukünftiger Mann heißt Karl Friedrich Wellinger«, erwiderte sie mit einem feinen Lächeln.
»Mon dieu«, rief er aus. »Oh, ich möchte nicht…«
»Sie haben nichts zu befürchten, Pierre, gar nichts«, sagte Georgia sanft.
»Christoph hat mit mir gesprochen«. murmelte Pierre. »Es war unerfreulich. Die Ähnlichkeit mit mir hat ihn aggressiv gemacht.«
»Das kann ich mir denken«, sagte Georgia ernst. »Aber ich mußte es ihm sagen, Pierre. Aus ganz bestimmten Gründen mußte ich das leider tun.«
»Weil Sie seinen Vater heiraten wollen«, murmelte er.
»Das hat sich aus einem anderen Anlaß ergeben. Ich gestehe gern ein, daß aus einer scheußlichen Geschichte für mich das große Glück erwuchs. Ich bin dem Mann begegnet, mit dem ich gern noch möglichst lange mein Leben teilen möchte.«
»Dann freue ich mich für Sie, Georgia. und auch für ihn«, sagte Pierre leise. »So wird er für manches, was er ertragen mußte, reich entschädigt.«
Georgia sah ihn lange an. So ähnlich er Christoph auch war, er wirkte sympathischer. Vielleicht ändert sich Christoph doch noch, dachte sie, nicht ahnend, mit welcher Nachricht sie und Pierre empfangen werden würden.
Karl Friedrich Wellinger platzte damit nicht gleich heraus. Georgia sah ihm nur an, daß etwas ihn sehr beschäftigte.
»Ich bringe dir Pierre Montand, Frieder«, sagte sie verhalten.
»Danke, daß Sie gekommen sind«, sagte Karl Friedrich und maß Pierre Montand mit einem langen Blick. »Ich habe gerade die Radionachricht bestätigt bekommen, daß Christoph bei einem Autounfall, den er selbst verursacht hat, ums Leben gekommen ist.«
Lähmendes Schweigen herrschte darauf. Georgia griff unwillkürlich nach Karl Friedrichs Hand, und er umschloß ihre mit festem Druck.
»Die Lösung unserer Probleme«, sagte er rauh. »Der Rest ist Schweigen.« Er sah Pierre jetzt an. »Oder denken Sie anders, Monsleur Montand?«
»Was soll ich sagen«, murmelte Pierre. »Mich für Vergangenes entschuldigen…«
»Bitte nicht«, fiel ihm Karl Friedrich ins Wort. »Sie tragen wohl schwerer daran als ich. Mag es auch hart klingen, es bereitet mir Genugtuung, daß ich nicht sein Vater bin. Ohne dies zu wissen, war mein Bemühen vergeblich, ihm ein Vater zu sein. Er war ganz der Sohn seiner Mutter, so ähnlich er Ihnen auch äußerlich wurde. Wirklich erstaunlich, diese Ähnlichkeit. Überzeugender kann sonst nichts sein.« Er machte eine kleine Pause, und Pierre zeigte schon, daß er gehen wollte. Doch Karl Friedrich Wellinger hielt ihn zurück.
»Immerhin haben Sie einen Anspruch auf seinen Nachlaß. Allzuviel wird vom Vermögen seiner Mutter nicht mehr übrig sein, aber ich werde dafür sorgen, daß Sie es bekommen.«
»Bitte nicht«, wehrte Pierre verlegen ab.
»Ich will es nicht haben, schon gar nicht brauchen wir es«, sagte Wellinger »sie haben Familie, wie ich hörte.«
»Ich möchte sagen, daß ich hier mit Christoph gesprochen habe, und was er sagte, hat keine gute Erinnerung in mir hinterlassen. Wir kommen zurecht, und ich möchte nichts nehmen, was ihm gehörte oder Vera. Damals, das war für mich kein Abenteuer, aber ich war auch jung und unüberlegt, und sie hat mich ausgelacht, als ich sie bat, mich zu heiraten. Das muß ich jetzt sagen. Nein, ich nehme nichts, Monsieur Wellinger. Ich bin dankbar, daß ich in Ihren Augen nicht Haß und Verachtung lese.«
»Mein Gott. Ich hätte mit Freuden die Hälfte meines Vermögens gegeben, wenn ich die Wahrheit gewußt hätte. Sie haben Kinder, Pierre.«
Überrascht blickte der andere auf, weil er mit seinem Vornamen angesprochen wurde.
»Ja, drei liebe Kinder. Und ich führe eine glückliche Ehe. Ich bin dankbar, daß unser Familienleben nicht gestört wird. Ja, dafür bin ich letztendlich dankbar, so schrecklich auch das andere ist.«
»Er war ein Mensch, dem nichts heilig war«, sagte Karl Friedrich Wellinger hart. »Er wollte zerstören, und nur ein gütiges Geschick bewahrte andere davor, nicht auch sterben zu müssen, bei dieser Todesfahrt. Mir wurde berichtet, daß er raste, als sei er von Sinnen. Vielleicht war er das auch. Ich will Ihnen wirklich nichts aufdrängen, was Sie nicht haben wollen, Pierre, aber wenn Sie doch einmal Hilfe brauchen, kommen Sie zu uns.«
»Ja, bitte, Pierre«, sagte Georgia.
»Ich danke Ihnen, Ihnen beiden«, sagte Pierre bebend. »Ich wünsche Ihnen alles Glück der Welt.« Dann küßte er Georgia die Hand und verneigte sich tief vor Karl Friedrich, der sich mit einem festen Händedruck von ihm verabschiedete.
»Armer Mann«, sagte er leise, als Pierre gegangen war, »und doch kann er von Glück sagen, daß er nicht sein Leben mit Vera und Christoph teilen mußte.«
»Vielleicht bin ich schuld, daß Christoph von Sinnen war«, sagte Georgia gedankenvoll.
»Du? Er ist an allem schuld. Er hat sich alles selbst zuzuschreiben. Dieses wilde Leben, diese Verantwortungslosigkeit. Denk jetzt lieber an lsabel. Solches kann er nun keinem unschuldigen Mädchen mehr antun, die auf seine schönen Worte hereinfielen. Möge Gott mir verzeihen, aber ich bin froh, daß diese Ängste zu Ende sind, daß wir unsere Zukunft ohne diesen Schatten sehen, nicht in ständiger Sorge, was er wieder angestellt haben könnte, was auf den Namen Wellinger zurückfällt. Jetzt denken wir an Chris.«
*
Viele sagten, daß Georgia niemals so ergreifend gesungen hätte, wie in ihrer Abschiedsvorstellung. Rom sagte sie dann ab. Es war keine Täuschung, ihre Stim-me versagte bei den Proben tatsächlich. Die seelische Belastung der letzten Monate war doch zu groß gewesen. Sie hatte durchgehalten, solange sie mußte, solange ihr die Faust im Nacken saß, und nun war sie eine schwache Frau in den Armen eines starken Mannes. Sie wollte nichts anderes mehr sein.
Auch für Martina und Jobst kam die Nachricht von Christophs Tod wie eine Erlösung. Nie mehr würde er ihre Wege kreuzen, nie mehr Kathrins junges Leben quälen. Mochte es auch manche befremden, daß es für Christoph Wellinger kein großes Begräbnis gab, die meisten sagten, daß sie es geahnt hätten, daß er einmal so sterben würde.
Und Martina war die erste, die erfuhr, daß es einen anderen Christoph Wellinger geben würde. Allerdings waren Karl Friedrich und Georgia längst entschlossen, ihn nur Chris zu nennen.
»Dann hat ja Kathrin einen Bruder«, sagte Martina nachdenklich.
»Reden wir davon lieber nicht, Martina«, sagte Georgia. »Chris wird unser Kind sein. Frieder hat recht gehabt, als er sagte, er solle die ganze Wahrheit nie erfahren. Es ist wirklich besser so. Du brauchst nicht zu fürchten, daß Kathrin zu kurz kommen wird.«
»Guter Gott, als hätte ich das jemals gefürchtet«, sagte Martina. »Wir brauchen doch nichts. Wir sind jetzt frei von der Furcht, daß er unser Glück stören könnte. Und wir werden ein Kind haben.«
»Wie schön«, sagte Georgia leise. »Wenn ich Frieder doch auch ein Kind schenken könnte, aber ich werde nie selbst eines zur Welt bringen können.«
»Du hast für Chris ganz bestimmt mehr getan als manche Mutter für ihr eigenes Kind tut«, sagte Martina voller Wärme. »Ich bin wirklich sehr froh, daß du Papa so viel Glück schenkst, Georgia. Du hast auf sehr viel verzichtet.«
»Auf nichts, was mir mehr wert gewesen wäre als dieser Mann und Chris«, sagte Georgia. »Was andere auch denken mögen, Martina, ich liebe Frieder. Ich habe nie geglaubt, daß ich einen Mann so lieben könnte.« Und nie hatte sie so schön ausgesehen wie in diesem Augenblick, als sie dies sagte. Ihre Augen leuchteten, ihr Gesicht war verklärt.
»Was sagst du dazu, Jobst?« fragte Martina später.
»Gegen wahre Liebe ist kein Kraut gewachsen«, erwiderte er. Und dann nahm er sie in die Arme. »Jetzt können wir Kathrin heimholen, mein Liebes. Jetzt brauchen wir auch um sie keine Angst zu haben.«
»Sie bleibt solange, wie Toby bleibt«, erklärte Martina. »Es tut ihr ganz gut, sich einfügen zu müssen. Sie ist ja gern dort. Und wir haben auch wenig Zeit für uns allein gehabt bisher.«
»Aber wenn sie heim will, holen wir sie«, sagte er. »Sie soll nicht denken, daß wir sie nicht vermissen.«
*
Aber Kathrin dachte so etwas nicht. Sie war ein fröhliches Kind geworden. Sie tobte mit den anderen herum. Sie kommandierte jetzt sogar manchmal Nadine, und sie ließ es sich gefallen. Sie rannte auch nicht mehr Toby nach, wenn sie ihn sah und er gerade mal wieder Annabel allein erwischte. Und die Zeit verging so schnell.
Jans Tante Maxi kam auf den Tannenhof, und nun brauchte Toby nur noch eine Woche auf seinen Papi zu warten. Das wußte er ganz genau. Und doch fühlte er sich zwischen zwei Stühlen sitzend. Heim zu Papi, weg von Annabel, das brachte ihn in einen tiefen Zwiespalt.
Was sich da in Ägypten zugetragen hatte, wußte er nicht. Einen ganz langen Brief hatte er seinem Papi geschrieben gehabt und ihm darin mitgeteilt, daß er doch nicht wolle. daß Linda von seinen Briefen erführe. Und sie solle ihm auch nicht mehr schreiben. Er hätte sie nie leiden können und würde auch kein Geburtstagsgeschenk von ihr annehmen.
Da hatte es eine ernste Unterredung zwischen Jochen Stahl und Linda gegeben, nach der sie wußte, daß sie ihre Hoffnungen begraben konnte. Aber tief traf sie das doch nicht mehr. Sie fand ihn einfach langweilig nach diesen Wochen. Sie hatte ja auch andere Chancen und die hatte sie kräftig genutzt.
Jochen war schlapp, mürrisch und jeder Aufmunterung abgeneigt. Man konnte auch sagen, daß er sich mit aller Energie über die Zeit hinwegrettete. Als die Maschine, die das Team nach München zurückbrachte, gelandet war, kümmerte sich Linda überhaupt nicht um ihn. Ein junger Ingenieur war es, der ihn zu einem Taxi brachte, weil er von einem Schüttelfrost hin und hergeworfen wurde.
»Sie haben zuviel gearbeitet, Chef, aber der Boß wird zufrieden sein«, sagte Dieter Klossner.
»Im Augenblick interessiert mich gar nichts, außer Toby und daß ich wieder zu Hause bin«, sagte Jochen müde, als sie vor seinem Haus anlangten.
»Und Sie brauchen einen Arzt«, sagte Dieter Klossner. »Sie glühen ja.«
»Wenn es sein muß, dann nur Dr. Norden«, murmelte Jochen Stahl, und schon sank er auf sein Bett, unfähig, auch nur die Schuhe abzustreifen.
Dr. Norden war schnell zur Stelle. Den Weg kannte er ja. Oft genug war er schon in diesem Haus gewesen, doch diesmal wurde er nicht zu Toby gerufen, sondern zu seinem Vater, diesem starken Mann, den man sich krank gar nicht vorstellen konnte. Und wie krank er war, stellte Dr. Norden schnell fest.
Es war eine Virusinfektion, das schien sicher, aber um welchen Virus es sich handelte, konnte Dr. Norden natürlich nicht gleich feststellen, und Jochen Stahl war jetzt zu schwach, um Fragen zu beantworten, die schneller weiterhelfen konnten. Dieter Klossner konnte nur sagen, daß sich der Chef nie wohlgefühlt hätte in diesem Klima und wohl auch zuviel gearbeitet hätte.
Jedenfalls mußte Jochen in die Klinik gebracht werden. Er bedurfte sorgfältigster Pflege.
»Toby, wie geht es Toby?« flüsterte er, als Dr. Norden ihm das sagte.
»Gut, sehr gut sogar. Er kann ruhig noch ein paar Wochen bleiben. Machen Sie sich darum keine Gedanken.«
Aber für den Jungen war es doch ein gewaltiger Schrecken, als Annabel ihm dann ganz behutsam beibrachte, daß sein Papi krank sei und ein paar Wochen in der Klinik liegen müsse. Dr. Norden hatte mit ihr gesprochen und ihr auch gesagt, daß Dr. Stahls Zustand augenblicklich sehr ernst sei.
»Papi war doch nie krank«, flüsterte Toby mit tränenerstickter Stimme. »Immer war bloß ich krank. Dieses blöde Ägypten. Nun will ich bestimmt nicht dahin, um mir alles anzugucken, was du erzählt hast. Warst du da auch krank, Annabel?«
»Nein, aber ich war ja auch nur vierzehn Tage dort.«
»Können wir Papi besuchen?« fragte er leise.
»Nicht gleich, Toby. Dr. Norden gibt uns Bescheid.«
»Ich bin froh, daß wir ihn haben. Er macht Papi wieder gesund«, sagte der Junge hoffnungsvoll. »Und weil ich bei dir sein kann, bin ich auch nicht zu traurig. Hoffentlich ist er gesund, wenn ich zur Schule muß, Annabel. Ich gehe dann doch aufs Gymnasium, und da darf ich nichts versäumen. Da muß man sehr viel lernen.«
»Es kommt schon alles in Ordnung, Toby«, sagte Annabel tröstend. »Ich nehme dann meinen Urlaub und bleibe bei dir.« Ganz spontan hatte sie diesen Entschluß gefaßt, und er blickte sie mit großen staunenden Augen an. »Das tust du, Annabel? Oh, du bist allerliebst.« Rührend klang es, wie er das sagte. »Wie lange hast du Urlaub?«
»Vier Wochen.« Eigentlich stand ihr noch mehr zu, da sie auch im vergangenen Jahr nur ein paar Tage genommen hatte. Aber da hatte sie Mutter Hedwig nicht im Stich lassen können, da sie zu wenig Personal hatten. Da jetzt Maxi da war und sich als sehr tüchtig erwiesen hatte, konnte sie den Urlaub nehmen. Mutter Hedwig würde dafür Verständnis haben. Sie wollte gleich mit ihr darüber sprechen.
Als sie das Büro betrat, telefonierte Mutter Hedwig gerade mit Martina von Tammen. Annabel wollte sich zurückziehen, doch Hedwig winkte sie herbei.
»Dann bis morgen, Frau von Tammen«, sagte sie.
Mit einem erleichterten Seufzer legte sie den Hörer auf. »Wenigstens da kommt alles in Ordnung«, erklärte sie. »Christoph Wellinger ist tödlich verunglückt. Nun kann Herr von Tammen Kathrin adoptieren. Was haben Sie, Annabel? Fühlen Sie sich nicht wohl?«
»Es ist wegen Dr. Stahl«, erwiderte Annabel überstürzt. »Er wird einige Wochen in der Klinik bleiben müssen. Toby kommt doch aufs Gymnasium und sollte am Anfang nicht gleich den Anschluß verpassen. Ich dachte, daß ich dann meinen Urlaub nehmen könnte.«
»Ja. Frau von Tammen hat darüber auch gesprochen. Selbstverständlich steht Ihnen der Urlaub zu.« Ein verstecktes Lächeln umspielte ihre Lippen. »Sie können morgen mit ihr sprechen. Sie wollte Toby zu sich holen. Aber er will wohl lieber hier bleiben, wie es scheint. Er hängt sehr an Ihnen. Bringt das nicht für später gewisse Komplikationen mit sich?«
»Daran denke ich noch nicht. Er hängt auch sehr an seinem Vater. Wenn er zu Frau von Tammen gehen will…«
»Nun, es wird sich finden«, sagte Mutter Hedwig. »Frau von Tammen erwartet ein Baby. Das ist auch eine freudige Nachricht. Der junge Wellinger hinterläßt keine Lücke. Es ist schon seltsam, wenn niemand Trauer empfindet um einen Toten.«
Er ist tot, dachte Annabel. Er kann niemandem mehr weh tun. Es ist ganz falsch, wenn man sagt, daß die Götter den früh zu sich nehmen, den sie lieben. Ja, vielleicht mögen ihn die Götter der Unterwelt geholt haben, aber ein gerechter Gott hat sein böses Leben ausgelöscht, damit erkeinen Schaden mehr anrichten kann.
Sie sah sich an der Reception des Pariser Hotels sitzen. Sie verdiente sich dort ihr Studium. Sie sah ihn vor sich stehen mit seinem charmanten Lächeln.
»Wann haben Sie Dienstschluß, Bella?« fragte er. Sie hatte ihm wirklich keine Antwort gegeben. Auf sie hatte sein Charme keine Wirkung gehabt.
»Ich werde es schon herausbringen«, hatte er gesagt. »Ich warte auf Sie. Wenn ich etwas haben will, bekomme ich es auch.« Ja, so war er gewesen, und wenn er etwas nicht freiwillig bekam, nahm er es sich mit Gewalt.
Wozu jetzt wieder daran denken. Es ist vorbei, dachte Annabel. Es ist endgültig vorbei.
Sie ging zu den Kindern zurück, die jetzt von Maxi beaufsichtigt wurden. Toby kam ihr sofort entgegengelaufen.
»Tante Martina holt Kathrin morgen ab«, sagte er atemlos. »Aber ich bleibe noch hier, gell?«
»Du kannst es selbst entscheiden, Toby.«
»Kannst du deinen Urlaub nehmen?«
»Ja, das könnte ich, aber erst müssen wir deinen Papi fragen, ob es ihm auch recht ist.«
»Das ist ihm bestimmt recht.«
Nun kam auch Kathrin, aber sie schmollte. »Wenn Toby nicht mitkommt, habe ich niemanden, mit dem ich spielen kann«, sagte sie.
Gedankenvoll betrachtete Annabel die beiden Kinder. Wie eigenartig, daß sie sich ähnlich sehen, dachte sie wieder. Das gibt es also auch, wenn Kinder ganz verschiedene Eltern haben. Oder war Tobys Mutter gar mit Martina verwandt gewesen?
»Warum bist du so still, Annabel?« fragte Toby nachdenklich. »Willst du doch lieber, daß ich zu Tante Martina gehe?«
Sie schüttelte den Kopf. Unwillkürlich stieg es ihr heiß in die Augen, als er sie so unglücklich ansah. »Ich freue mich, wenn du gern bei mir bleibst«, sagte sie leise, und da konnte er schon wieder lächeln.
*
Jochen Stahl bereitete den Ärzten große Sorgen. Von Fieber und Schüttelfrösten geschüttelt, war er kaum ansprechbar. Die medikamentöse Behandlung zeigte bisher keinen Erfolg.
»Mal wieder einer von vielen Viren, von denen wir noch nichts wissen«, stellte Dr. Behnisch deprimiert fest. »Wahrscheinlich liegt auch eine Überempfindlichkeit gegen bestimmte Kunststoffe vor.«
»Aber dort wird mit Stahl gearbeitet«, sagte Dr. Norden.
»Die Atemwege und die Nebenhöhlen sind entzündet, ebenso die Augen. Es kann ja möglich sein, daß Sand und Staub schuld sind. Malaria ist es jedenfalls nicht, aber die hätten wir wenigstens im Griff und wüßten, wo wir ansetzen können.«
Typhus und Cholera waren auszuschließen, ebenso eine Salmonellenvergiftung. Manche Anzeichen sprachen für eine Toxoplasmose, aber es blieb beim Herumrätseln.
Sie konnten auch Jobst von Tammen nichts Genaues sagen, als er sich besorgt nach dem Befinden seines Freundes erkundigte.
Aber als er Jochen besuchte, war dieser doch für Minuten wach.
»Kümmert euch um Toby«, bat er. »Mich hat es erwischt.«
»Du wirst wieder gesund, Jochen«, sagte Jobst, der zutiefst erschrocken war über diese Resignation. »Annabel kümmert sich rührend um Toby.«
»Das ist gut, ja, das ist gut«, murmelte Jochen. »Sag ihr meinen Dank.«
Dann war seine Kraft schon wieder erschöpft. Er schlief jedoch ruhiger, und Dr. Behnisch konnte dann feststellen, daß das Fieber etwas gesunken war.
Am nächsten Tag fuhren Jobst und Martina zum Tannenhof. Kathrin freute sich nun doch, aber sie beschwerte sich schon ein bißchen über Toby, der lieber auf dem Tannenhof bleiben wollte.
»Für Toby gibt’s nur Annabel, immer Annabel«, murrte sie. »Wie findet ihr denn das?«
»Nett finden wir das«, erwiderte Martina.
»Am besten wär’s, wenn Onkel Jochen sie heiraten würde«, meinte Kathrin. »Ich mag sie ja auch, und Toby hat schon lange keine Mami.«
Sie hatte sich auch ihre Gedanken gemacht, hier unter all den Kindern, denen meistens ein Elternteil fehlte. Und glücklich war sie nun doch, daß Jobst nun ganz ihr lieber Papi war. Sie stellte keine Fragen nach Christoph. Ihr genügte es, daß er richtig tot war. Als man es ihr gesagt hatte, fragte sie: »Wirklich richtig tot?«, und als es ihr bestätigt wurde, sagte sie, daß sie dann auch wieder gern nach Hause wolle.
Aber richtig böse war sie mit Toby nicht. »Wenn du dann mit Annabel kommst, könnt ihr ja bei uns bleiben«, meinte sie.
Martina sprach darüber mit Annabel, doch diese sagte, daß sie Dr. Stahls Entscheidung noch abwarten wolle.
»Er sagte gestern meinem Mann, daß wir Ihnen seinen Dank übermitteln sollen, Annabel. Augenblicklich geht es ihm noch sehr schlecht. Ihnen kann ich das ja sagen, aber Toby soll es besser nicht wissen.«
»Es besteht doch keine Lebensgefahr?« fragte Annabel erschrocken.
»Er wird bestens betreut«, sagte Martina leise.
»Ich hoffe sehr, daß er bald gesund wird, daß Toby ihn bald besuchen kann.«
»Das hoffen wir auch sehr«, sagte Martina, »und Sie sind uns herzlich willkommen, Annabel. Wir sind jetzt von großen Sorgen befreit. Sie wissen wohl schon, daß Kathrins Vater nicht mehr lebt.«
»Ja, ich habe es gehört. Es war ein Autounfall.«
»Ja, er konnte nie schnell genug fahren. Es klingt gefühllos, wenn ich sage, daß uns allen wohler ist, aber es ist so.«
»War er nicht der einzige Sohn?« fragte Annabel.
»Er hat dem Namen Wellinger keine Ehre gemacht, aber seit kurzem wissen wir, daß er einen anderen Vater hatte.« Sie wurde verlegen. »Behalten Sie es bitte für sich, aber es sollte Ihnen erklären, daß Karl Friedrich Wellinger, den ich noch gern Papa nenne, keine Trauer empfindet. Er wird übrigens in Kürze heiraten und einen unehelichen Sohn von Christoph adoptieren.«
»Er hatte einen unehelichen Sohn?« fragte Annabel geistesabwesend. »Ist das für Sie nicht bedrückend?«
»Das wäre es wohl, wenn er mir etwas bedeutet hätte, aber wer weiß, ob nicht auch noch andere Sprößlinge von ihm herumlaufen. Ich bin froh, daß Kathrin ein Mädchen ist und uns so keine Verpflichtung auferlegt wurde, ihr den Namen Wellinger zu belassen. Bei allem Respekt vor meinem Schwiegervater, mir hätte dies nicht behagt. Er wird Georgia Stafford heiraten, und sie ist die leibliche Tante des Jungen. Das Schicksal geht seltsame Wege, Annabel.«
»Ja, das kann man sagen.« Gern hätte Annabel noch mehr Fragen gestellt, aber sie hatte Angst, ein zu persönliches Interesse zu verraten, und Martina sollte auf gar keinen Fall erfahren, daß auch sie nur denkbar schlechte Erinnerungen an Christoph Wellinger hatte. Daß dies Schicksal seltsame Wege ging, bewies ihr der Umstand, daß sie Martina kennengelernt hatte.
*
Fünf Tage vergingen, bis die Ärzte aufatmen konnten. Jochen Stahl befand sich auf dem Wege der Besserung. Sehr besorgt um ihn hatte sich auch Karl Friedrich Wellinger gezeigt, der sich jeden Tag nach Jochens Befinden erkundigte.
Daß Tobias noch auf dem Tannenhof geblieben war, wußte er von Martina. »Hättet ihr ihn nicht bei euch aufnehmen können?« erkundigte er sich.
»Aber gern hätten wir das getan, aber er hat seine große Liebe zu Annabel entdeckt, der Betreuerin. Sie wird nächste Woche mit dem Jungen kommen, und wir hoffen, daß sie beide dann einige Zeit bei uns bleiben«, erklärte Martina. »Wir möchten da auch gern ein bißchen Schicksal spielen«, gab sie zu. »Annabel wäre für Jochen die geeignete Frage.«
»Da laßt mal lieber die Finger davon. Er ist sehr eigenwillig und könnte es in die falsche Kehle bekommen. Ich bin nur heilfroh, daß er mir erhalten bleibt. Ohne ihn läuft nichts so reibungslos. Ich würde ihm schon eine nette Frau wünschen. Er hätte wahrhaft auch noch ein bißchen Glück verdient. Aber über so was denke ich erst jetzt nach, Martina. Ich bin unendlich dankbar für das Glück, das ich jetzt genießen darf.«
»Und wir freuen uns mit euch«, sagte Martina herzlich.
Und hoffentlich wird Chris nicht doch seinem Vater ähnlich, dachte sie für sich, aber diese Befürchtungen schwanden, als sie den Jungen dann kennenlernte. Er hatte nicht die geringste Ähnlichkeit mit Christoph.
Kathrin fand es lustig, daß der Großpapa nun einen Sohn bekam, der nur fünf Jahre älter war als sie. Sie nahm alles recht selbstverständlich hin. Tante Georgia gefiel ihr sehr gut. Es gab da überhaupt keine Probleme. Nur daß Onkel Jochen krank war, bereitete ihr großen Kummer, und immer wieder hatte sie gefragt: »Gell, Mami, Onkel Jochen stirbt nicht.«
»Nein, Kathrin, wie kannst du nur so etwas denken!«
»Ich will es doch nicht, und außerdem braucht Toby ihn doch, weil er keine Mami hat. Ich bin froh, daß ich einen lieben Papi habe, aber meine Mami ist die allerbeste.«
Und sie freute sich auf das Geschwisterchen Ihr war es plötzlich ganz gleich, ob es ein Junge oder ein Mädchen sein würde.
Chris fand sie auch nett, aber Toby wäre ihr doch lieber, erklärte sie. Sie konnte es kaum erwarten, daß er endlich kommen würde.
*
Im Tannenhof wurden die Koffer gepackt. Toby war nun auch aufgeregt. Er hatte immer noch gefürchtet, daß etwas dazwischenkommen könnte, das verhindern würde, daß Annabel ihn begleitete.
Mutter Hedwig winkte ihnen dann, nach einem herzlichen Abschied, mit kummervollen Gedanken nach, als ahne sie schon, daß Annabel nicht mehr auf den Tannenhof zurückkehren würde, obgleich sie doch die meisten Sachen zurückgelassen hatte. Und auch in Annabel war eine Ahnung, daß sie sich für das Zusammenleben mit Toby entscheiden könnte, wenn Jochen Stahl es wollte. Sie konnte sich das Leben ohne diesen Jungen nicht mehr vorstellen. Und wie sehr hatte sie sich doch immer dagegen gesträubt, einem Kind zuviel Zuneigung zu schenken. Vielen Kindern ja, aber nicht ihr Herz an eines verlieren, so hatte sie es sich vorgenommen gehabt. Und nun war es doch geschehen.
»Besuchen wir zu allererst Papi?« fragte Toby.
»Wollen wir nicht erst zu Tante Martina fahren?« fragte sie.
»Nein, zuerst zu Papi. Bitte, Annabel. Ich habe so große Sehnsucht nach ihm.«
»Vielleicht dürfen wir noch gar nicht zu ihm«, sagte sie.
»O doch, Dr. Norden wird es schon erlauben«, versicherte Toby.
»In der Klinik hat aber Dr. Behnisch das Sagen.«
»Den kenne ich doch auch. Da hat doch Mama gelegen. Sie durfte ich auch immer besuchen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr richtig, wie sie ausgesehen hat«, fuhr er nachdenklich fort. »Sie wurde auch immer fremder.«
»Fremder?« wiederholte Annabel fragend.
»Immer dünner und stiller, das weiß ich noch. Und dann wollte sie auch gar nicht mehr, daß ich sie besuche. Es ist aber eine sehr schöne Klinik, und nicht so ein altes Krankenhaus.«
Davon konnte sich Annabel bald überzeugen. »Ich werde erst mit Dr. Behnisch sprechen, Toby«, sagte sie. »Wartest du bitte in der Halle?«
Sie wollte nicht, daß der Junge möglicherweise erschrak, wenn er seinen kranken Vater sah. Und es konnte ja auch sein, daß sie gerade einen schlechten Tag erwischt hatten.
Dr. Behnisch betrachtete sle forschend, als sie sich vorstellte. »Mein Name ist Annabel Frank. Ich betreue Tobias Stahl. Er möchte unbedingt seinen Papi besuchen.«
»Er wird schon sehnsüchtig erwartet«, erwiderte Dr. Behnisch.
»Geht es Dr. Stahl besser?« fragte Annabel stockend.
»Es wird ihm gleich noch bessergehen, wenn er sieht, daß sein Sohn wohlauf ist. Wo ist Toby?«
»In der Halle. Ich wollte erst mit Ihnen sprechen. Toby ist sehr sensibel. Er könnte sich erschrecken, wenn sein Vater elend aussieht.«
»Das tut der Liebe keinen Abbruch. Wenn Vater und Sohn sich so gut verstehen wie die beiden, schaut man nicht aufs Äußere. Es hat ihn allerdings sehr erwischt.«
»Haben Sie herausgefunden, was es war?« fragte Annabel.
»Es war eine Toxämie, wahrscheinlich hervorgerufen durch ein Nagetier. Mit hundertprozentiger Sicherheit konnten wir es nicht feststellen, da diese Erkrankung einen schleichenden Verlauf nahm und Dr. Stahl glücklicherweise eine sehr gute Konstitution hat. lch gebe gern zu, daß wir auch Glück hatten mit der medikamentösen Behandlung. Meine Frau hat einige Jahre in den Tropen gearbeitet, und wir haben dann eben experimentiert. Es war unsere Chance und die für Dr. Stahl, daß wir dann das richtige Medikament anwenden konnten. Zufrieden, Frau Frank?«
»Danke für die Auskunft. Man macht sich ja Gedanken. Als ich Dr. Stahl kennenlernte, machte er auf mich den Eindruck, als könne ihn nichts umwerfen.«
Dr. Behnisch rückte seine Brille zurecht und blinzelte ein bißchen. Wundern sollte es mich nicht, wenn er sich nicht von diesem lieblichen Wesen umwerfen läßt, dachte er für sich.
Dann aber konnte Annabel Toby holen. Sie führte ihn zu dem Krankenzimmer.
»Ich warte draußen, Toby«, sagte sie.
»Ich will aber, daß du mitkommst.«
»Dein Papi möchte dich bestimmt erst allein sehen«, erklärte sie. »Schau, wir kennen uns doch nur ganz flüchtig.«
»Er weiß, daß ich dich liebhabe«, beharrte Toby.
»Du kannst mir ja Bescheid sagen, wenn er mich sprechen will«, erklärte sie.
»Aber du mußt gleich hier warten, Annabel.«
»Ja, ich warte hier«, erwiderte sie nachsichtig.
»Hoffentlich gefallen ihm meine Bilder und das Geschnitzte«, flüsterte er.
»Aber ganz bestimmt«, sagte sie mit einem weichen Lächeln.
»Ich habe so viel von dir gelernt, das wird Papi freuen.« Dann stellte er sich auf die Zehenspitzen und drückte ihr einen Kuß auf die Wange. »Aber du brauchst nicht zu denken, daß ich dich jetzt weniger liebhabe, weil ich meinen Papi wiederhabe«, raunte er ihr ins Ohr.
Sie stand dicht bei der Tür. Sie hörte, wie Jochen Stahl freudig rief: »Toby, mein Junge, mein Kleiner«, und Toby: »Papi, Papileinchen!« Tränen stiegen ihr in die Augen.
Was für Rauhbeine waren doch zehnjährige Buben meistens schon. In den Jahren, die sie auf dem Tannenhof verbracht hatte, hatte sie so ihre Erfahrungen sammeln können. Die meisten Jungen dieses Alters hatten ihr mehr Sorgen als Freude bereitet und manchmal sogar großen Ärger. Dann war die seelische Last, die sie drückte, nicht gar so quälend gewesen.
»Gut schaust du aus, Toby«, sagte Jochen. »Und gewachsen bist du.«
»Fünf Zentimeter und zwei Kilo habe ich zugenommen«, erklärte Toby stolz. »Aber du bist so schmal und blaß«, flüsterte er dann gleich besorgt und tätschelte Jochens hager gewordene Wangen. »Aber wir päppeln dich schon auf. Annabel kann nämlich auch kochen. Wenn die Köchin ihren freien Tag hatte, hat immer sie gekocht, und wir durften ihr dann helfen. Das war toll.«
Und schon ist er wieder bei Annabel, dachte Jochen. Aber Toby streichelte seine Hände. »Ich bin ja so froh, daß ich dich nun wenigstens besuchen darf, Papi«, fuhr er fort, »aber schöner wäre es schon, wenn du bald heimkommen könntest. Findest du es nicht auch lieb, daß Annabel ihren Urlaub genommen hat, damit sie bei uns sein kann?«
»Das finde ich sogar sehr lieb«, nickte Jochen. »Wo ist sie denn?«
»Draußen vor der Tür. Sie hat gesagt, daß du mich sicher erst allein sehen willst. Soll ich sie holen?«
»Erzähl mir doch erst noch, was du alles gemacht hast«, sagte Jochen.
»Jemine, jetzt hätte ich doch fast vergessen, dir das zu geben, was ich für dich gemacht habe. Aber gelernt habe ich das alles von Annabel. Du ahnst ja nicht, was sie alles kann und alles weiß.«
Jochen konnte ein Lächeln nicht mehr unterdrücken: Aber als er die hübschen Bildchen betrachtete und die ebenso hübschen Holzfiguren, die Toby geschnitzt hatte, konnte er nur staunen.
»Gell, so was lernt man nicht in der Schule«, sagte der Junge. »Dazu nimmt sich keiner Zeit. Annabel ist ja deswegen auch lieber in ein Kinderheim gegangen, weil in der Schule so viel Vorschriften waren. Da müssen eben alle das gleiche machen, ob sie Talent haben oder nicht. Bei uns konnte jeder das machen, was er am liebsten wollte.« Er mußte erst mal Luft holen, aber schon ging es weiter. »Annabel könnte mir auch helfen, wenn ich aufs Gymnasium gehe. Sie kann Englisch, Französisch und auch Latein, stell dir das mal vor, Papi. Und rechnen kann sie auch prima und Maschine schreiben. Mir ist es nicht recht, wenn sie lange draußen warten muß, dann denkt sie vielleicht, daß du sie nicht magst.«
Jochen fuhr ihm durch das wirre Haar. »Na, dann hol sie mal schnell herein«, sagte er.
Annabel stand am Fenster, tief in Gedanken versunken, und sie hatte es nicht verhindern können, daß diese wieder in die Vergangenheit gewandert waren. Christoph Wellinger hatte sie daraus verbannen können, aber da war das andere, was sie heute als verschenktes Glück bezeichnete, jetzt, da sie Toby so liebgewonnen hatte.
»Komm jetzt, Annabel«, sagte Toby zärtlich, »ich mußte Papi nur noch erzählen, was ich alles von dir gelernt habe.«
Er nahm sie bei der Hand, und sie konnte es nicht verhindern, daß ihr Herz schmerzhaft klopfte, als sie das Krankenzimmer betraten.
Ja, es tat ihr weh, ihn so schwach, so abgemagert zu sehen. Ganz kalt war ihre Hand, die er nun ergriff. Sein Blick schien durch sie hindurch zu gehen, so zwingend ruhte er auf ihr.
»Nun kann ich Ihnen endlich persönlich danken, Annabel!« sagte er mit dunkler Stimme, »für alles, was Sie für meinen Jungen getan haben. Und ich weiß noch nicht mal Ihren Nachnamen.«
»Frank«, flüsterte sie.
»Sag doch lieber auch Annabel, Papi«, bat Toby.
»Wenn es mir gestattet wird?«
Die Angst legte sich. Wärme durchflutete Annabel. Toby schmiegte sich in ihren Arm und ein ganz eigener Ausdruck kam in Jochens Augen, als er die beiden anschaute.
»Wir sollten uns bald einmal darüber unterhalten, Annabel, ob Sie zu uns kommen würden und zu welchen Bedingungen«, sagte er.
»Was meinst du mit Bedingungen, Papi?« warf Toby ein.
»Nun, Annabel ist ihre Selbstständigkeit gewohnt. Ein Haushalt ist ein enger Lebensbereich. Du wirst vormittags in der Schule sein, und es könnte ihr schnell langweilig werden.«
»Annabel ist es nie langweilig. Sie könnte ja auch Tante Martina besuchen. Das würde sie nämlich auch freuen. Sie hat Annabel sehr gern, und nun kann der junge Wellinger nicht mehr kommen, der ist tot.«
»Was sagst du da?« fragte Jochen erregt.
»Ich dachte, du wüßtest es schon«, sagte Toby kleinlaut. »Hätte ich es nicht sagen sollen?«
»Ich bin nur überrascht, es macht mir nichts aus«, erwiderte Jochen. »Wie kam das?«
»Mit dem Auto ist er gerast«, erwiderte Toby. »In Frankreich. Kathrin ist jetzt froh, daß sie bloß noch ihren lieben Papi hat. Hat sie selbst gesagt. Weißt du auch noch nicht, daß sie ein Baby bekommen?«
»Doch, das hat mir Jobst erzählt.«
»Schlechte Nachrichten wollte man Ihnen wohl vorenthalten«, bemerkte Annabel stockend.
»Das ist keine schlechte Nachricht. Man soll Toten nichts nachreden, aber er ist kein Verlust für die Menschheit. Nun wird der Boß auch zur Ruhe kommen. Sie können von Glück sagen, daß Sie den Junior nicht kannten, Annabel. Jede Frau, die von ihm verschont blieb, kann das sagen. Ich meine, jede anständige Frau.«
»Papi hat ihn nämlich nicht leiden können, Annabel«, warf Toby ein. »Weil er auch zu mir eklig war. Jetzt kann er uns nicht mehr ärgern, Kathrin auch nicht.«
»Jobst hätte es mir ruhig sagen können«, murmelte Jochen.
»Zu Kranken spricht man nicht vom Tod«, sagte Annabel verhalten.
»Ja, so mag es sein. Man denkt dann nach, wie schnell es aus sein kann. Aber mir geht es heute ganz gut. Ich werde bald wieder auf den Beinen sein.«
»Brauchen wir nicht lange bei Tante Martina zu bleiben«, fragte Toby.
»Aber du warst doch immer gern dort«, meinte Jochen erstaunt.
»Jetzt bin ich aber lieber mit Annabel allein. Und wir wollen dich doch auch oft besuchen. Ich möchte ihr auch zeigen, wo wir wohnen. Und wenn Annabel bei uns bleibt, müssen wir ihr auch ein schönes Zimmer aussuchen, Papi.«
»Annabel hat noch nicht ja gesagt«, murmelte Jochen.
»Jetzt bleibe ich erst mal vier Wochen. Wir können dann noch miteinander reden«, sagte Annabel. »Laß es deinen Papi auch überdenken, Toby.«
»Ich brauche nichts zu überdenken«, erklärte Jochen ruhig. »Es liegt nur bei Ihnen, Annabel.«
»Bitte, bitte, Annabel«, flüsterte Toby aufgeregt.
»Gut, dann sage ich ja.« Der Junge fiel ihr um den Hals und küßte sie auf beide Wangen. Dann bekam auch Jochen seine Küsse, und strahlende Kinderaugen waren beiden der schönste Dank.
*
Mit den Worten: »Da seid ihr ja endlich«, wurden sie von Martina und Kathrin empfangen.
»Herzlich willkommen«, sagte Martina.
»Ich warte schon sehr lange«, erklärte Kathrin. »Komm, Toby, ich muß dir mein neues Zimmer zeigen.«
Er ging nur zögernd mit, aber er wollte Kathrin nicht kränken, und Martina war recht froh, allein mit Annabel sprechen zu können.
»Wir waren schon in der Klinik und haben Dr. Stahl besucht«, sagte Annabel einleitend.
»Ich habe es mir gedacht, daß Toby es nicht erwarten kann. Es geht ihm besser?«
»Er ist sehr schmal geworden.«
»Das holt er rasch auf. Das Schlimmste ist überwunden. Ich werde ihn nun wohl auch besuchen dürfen.« Martina lächelte. »Männer haben es nicht so gern, wenn man sie schwach sieht. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, daß Sie Toby Ihren Urlaub opfern.«
»Das ist kein Opfer. Ich werde auch länger bleiben.«
Martinas Augenbrauen ruckten empor und ein heller Schein flog über ihr Gesicht. »Schon entschieden?«
»Ich kann Toby nicht enttäuschen.«
»Tee oder Kaffee?« lenkte Martina ab.
»Lieber Tee«, erwiderte Annabel. Und schon stellte Martina die Frage, die ihr auf den Lippen brannte.
»Warum haben Sie nicht geheiratet, Annabel? Sie lieben Kinder. Sie sind eine attraktive Frau. Haben Sie auch eine Enttäuschung erlebt? Entschuldigen Sie, daß ich neugierig bin, aber ich habe viel über Sie nachgedacht. Sie sind doch eine Frau, die einen Mann sehr glücklich machen kann.«
»Ich mache mir keine Illusionen«, sagte Annabel.
Offen blickte Martina sie an. »Hat jemand diese zerstört?«
»So könnte man es nennen. Es war nicht Liebe. Jemand brachte es fertig, daß ich an Liebe nicht mehr glaube.«
»Das tut mir leid, Annabel.«
»Sprechen wir bitte nicht darüber«, sagte Annabel helser.
»Ich habe auch erst durch Jobst erfahren, was wahre Liebe ist. Der charmante Christoph entpuppte sich schnell als grausamer Egoist. Und dann kam die Furcht, daß mein Kind so werden könnte wie er. Ich hatte Angst, daß ich das Kind nicht würde lieben können. Jetzt ist es ganz anders. Jetzt freuen wir uns gemeinsam auf das Baby.«
»Kathrin ist ein liebes Kind«, sagte Annabel.
»Dafür bin ich dankbar. Was habe ich gebetet, und meine Gebete wurden erhört. Ich hätte nur den Mut haben müssen, mich eher von ihm zu trennen. Aber da war Papa. Ich hatte ihn gern. Für Christoph war die Ehe nur eine Fessel. Er ging seine eigenen Wege und zeigte für mich und das Kind nicht das geringste Interesse. Ich glaube heute, daß eine Frau ihn überhaupt nur solange interessierte, bis er erreicht hatte, was er wollte. – Warum erzähle ich Ihnen das eigentlich? Es ist so eigenartig, Annabel. Darüber habe ich bisher mit niemanden gesprochen, Jobst ausgenommen. Er hat mich verstanden, Papa auch, aber sonst galt ich als die ungerechte, sich nur unverstanden fühlende Frau.«
Da kam Kathrin hereingelaufen und sie zitterte vor Empörung. »Stell dir vor, Mami, Toby will keine Geschwister haben, was sagst du dazu? Und heiraten will er mich auch nicht.«
»Nun, über Heirat zu reden, ist wohl auch noch zu früh«, meinte Martina lächelnd, »und über Geschwister würde Toby wohl auch anders denken, wenn er eine Mami hätte.«
»Eben nicht. Ich habe ja gesagt, daß Onkel Jochen Tante Annabel heiraten soll, und dann können sie auch Kinder kriegen, aber er will Annabel ganz für sich allein haben. Und deshalb will er auch nicht hierbleiben, nicht einen Tag hat er gesagt.«
»Hab’ ich gesagt«, ertönte Tobys Stimme. »Kathrin soll sich nicht immer in meine Angelegenheiten mischen. Entschuldige, Tante Martina.«
»Nun vertragt euch mal wieder«, meinte Martina beschwichtigend. »Worüber ihr auch streiten müßt!«
»Ich will nicht, daß Annabel mit solchem Gerede vergrault wird«, sagte Toby ganz vernünftig. »Ich will nur, daß sie bei uns bleibt.«
»Ich habe es doch nicht so gemeint, Tante Annabel«, schluchzte Kathrin. »Ich habe doch nur wollen, daß Toby eine liebe Mami bekommt, weil ich einen lieben Papi gekriegt habe. Ich komme doch auch erst in die Schule und bin noch nicht so schlau wie er. Ich will niemand vergraulen. Bleibt doch hier.«
»Nein«, erklärte Toby kategorisch, »ich will nach Hause. Wir können euch ja mal besuchen, aber ich will in meinem Bett schlafen.«
Annabel und Martina tauschten einen langen verständnisinnigen Blick. »Das kann ich verstehen«, sagte Martina. »Und Annabel wird sich ja auch eingewöhnen müssen. Wir werden uns bestimmt oft sehen.«
»Nichts für ungut, Frau von Tammen«, sagte Annabel leise.
»Martina heiße ich. Wir verstehen uns doch, Annabel.«
Ja, sie verstanden sich, aber Kathrin schob trotzig die Unterlippe vor, und mit flammenden Augen sah sie Toby an.
»Ich mag dich überhaupt nicht mehr heiraten«, stieß sie zornig hervor.
»Da bin ich aber froh«, erklärte er.
Dann kam sie ihm aber doch nachgelaufen. »Aber mein Freund kannst du ruhig wieder werden«, japste sie.
»Wenn du kein dummes Zeug redest«, meinte er gönnerhaft.
Und zu Annabel sagte er dann: »Sie ist eben noch klein und dumm. Wenn ich jetzt aufs Gymnasium komme, lachen mich ja alle aus, wenn sie herumerzählt, daß sie mich heiraten will. Ich heirate überhaupt nicht. Wenn ich groß bin, sorge ich für dich, Annabel.«
Er war eben auch noch ein Kind mit Wunschträumen. Annabel dachte jetzt an einen Jungen, der Michael hieß. Er war sechs Jahre älter gewesen als sie und wohnte im Nachbarhaus. Und sie hatte auch davon geträumt, ihn einmal zu heiraten. Dann waren sie weggezogen, und der Traum war aus.
»Bist du jetzt böse auf mich, Annabel?« fragte Toby beklommen, weil sie schwieg.
»Nein, ich bin nicht böse. Es ist immer gut, wenn man ehrlich ist, aber du darfst schon ein bißchen nachsichtiger mit Kathrin sein. Du bist doch jetzt schon ein großer Junge.«
Er saß schweigend neben ihr, bis sie eine Straße zu weit gefahren war. »Jetzt mußt du rechts rum und dann wieder links, Annabel«, sagte er. »Dann sind wir gleich da. So großartig wie bei Tante Martina ist es bei uns nicht. Vielleicht gefällt es dir gar nicht.«
Es gefiel ihr sehr gut, hübsch sahen die versetzten Reihenhäuser aus mit ihren Holzverschalungen. Und innen waren sie viel geräumiger, als man ahnen konnte.
Die Einrichtung verriet viel Geschmack, wenn sie auch nicht so komfortabel war, wie bei den von Tammens.
»Gefällt es dir?« fragte Toby erwartungsvoll.
»Ja, sehr, aber jetzt müssen wir lüften«, erwiderte sie.
»Und dann suchst du dir das schönste Zimmer aus. Du kannst auch meins haben, das hat auch einen Balkon.«
»Welches gehörte denn den Hausdamen?« fragte sie.
»Da gehst du nicht rein. Die hatten die Mansarde, aber das waren ja auch nur Haushälterinnen, keine Damen.«
Er hatte schon seine eigenen Ansichten, dennoch fand Annabel die Mansardenwohnung sehr hübsch, die aus zwei Zimmer bestand.
»Mir gefällt das«, sagte sie.
»Du bist aber keine Haushälterin«, erkärte er trotzig. »Würdest du meinen Papi heiraten, Annabel?«
»Davon wollen wir nicht reden, Toby. Männer haben so was gar nicht gern, und ich bin ja nur deinetwegen hier.«
»Aber mein Papi ist wirklich sehr lieb. Du mußt ihn nur besser kennenlernen.«
»Besser kennenlernen werden wir uns schon. Jetzt bringen wir erst mal dein Zimmer in Ordnung und beziehen das Bett.«
»Ich habe aber Hunger.«
»Liebe Güte, wir müssen ja noch einkaufen«, rief sie aus.
»Papi hat dir aber noch kein Haushaltsgeld gegeben«, meinte er betrübt.
»Ich habe schon Geld, mein Kleiner. Du mußt mir nur zeigen, wo die Geschäfte sind und was du alles haben möchtest. Alles, was du gern magst.«
*
Zwei Wochen hatten sie Zeit, das Haus auf Hochglanz zu bringen. Einiges wurde umgestellt in der Mansardenwohnung. Ein paar hübsche alte Möbel, die auf dem Speicher verstaubten, wurden zu neuen Ehren gebracht, und dann gefiel es Toby auch viel besser. Er wollte Annabel ja nicht widersprechen und auch nichts ausreden, was sie für richtig hielt. Und sie fühlte sich wohl in der Rolle, in die sie sich von Toby hatte drängen lassen. Doch längst war sie sich bewußt, daß es ihr Herz war, das sich entschieden hatte, und mit jedem Besuch bei Jochen Stahl wurde ihr das mehr bewußt.
Er bekam sehr viel Besuch. Jobst und Martina, und auch Kathrin kamen, und Kathrin dachte nicht mehr daran, sich über Toby zu beschweren. Es hatte sich alles eingependelt. Sie war auch sehr gern mal ein paar Stunden bei Annabel und Toby, wenn Martina mit Georgia Einkäufe für Chris und das zu erwartende Baby machte.
Jochen hatte alle Einzelheiten erfahren, und Karl Friedrich Wellinger besuchte ihn jeden Tag eine Stunde, um die wichtigsten geschäftlichen Angelegenheiten mit ihm zu besprechen.
Es würde nun aber Zeit, daß er wieder die Klinik verlassen könne, meinte der Boß eines Tages.
»Nicht, daß Sie gleich wieder dem Streß ausgesetzt werden, lieber Jochen, aber als Trauzeuge möchte ich Sie schon haben. Sie und Jobst sollen mir garantieren, daß Georgia mal gute Freunde hat, wenn ich das Zeitliche segne.«
»Du lieber Himmel, davon sollten Sie nicht reden«, sagte Jochen.
»Ich will auch nicht daran denken, aber man weiß halt nie, was kommt. Und Chris braucht auch ein Vorbild. Er hatte nicht solchen Vater wie Ihr Tobias. Und ein besseres Vorbild als einen so guten Vater kann es nicht geben.«
In der Klinik lernte Karl Friedrich Wellinger auch Annabel kennen. Eigentümlich nachdenklich wurde sein Blick, als sie mit Toby kam, und zu Tobys großer Freude machte er eine tiefe Verbeugung vor ihr.
Am nächsten Tag sagte er zu Jochen: »Ist Ihnen eigentlich schon mal aufgefallen, daß diese reizende Frau Frank eine ganz erstaunliche Ähnlichkeit mit Ihrem Tobias hat?«
»Das macht wohl die Anpassung«, erwiderte Jochen schmunzelnd. »Toby ist ihretwegen ja sogar freiwillig zum Friseur gegangen, weil er auch keinen Wuschelkopf mehr haben wollte. Der wiederum war schuld, daß man ihn oft für Kathrins Bruder hielt.«
»Ja, es gibt seltsame Entwicklungsphasen«, sagte Karl Friedrich Wellinger nachdenklich. »Ich bin jedenfalls froh, daß Chris sich ganz auf Georgia hinauswächst. Ich habe allerhand durchgemacht, Jochen, das dürfen Sie mir glauben. Ich habe viel geschluckt.«
»Ich weiß es.«
»Ich habe auch nicht gedacht, daß das Glück doch noch mal zu mir komrnen würde, und deshalb möchte ich Ihnen den Rat geben, diese liebenswerte Annabel Frank festzuhalten. Ich habe jetzt so was wie den siebten Sinn bekommen für das, was einem gut tut.«
»Den habe ich auch schon bekommen«, erwiderte Jochen lächelnd. »Dankbar wäre ich Ihnen, wenn Sie Linda Krauss in eine andere Abteilung versetzen würden.«
»Ist sie immer noch hinter Ihnen her?« fragte der Boß.
»Besucht hat sie mich nicht. Für kranke Männer hat sie nichts übrig, aber ich möchte nicht, daß Annabel auf den Gedanken kommt, daß Tobys Befürchtungen eintreffen könnten. Sicher hat er mit ihr darüber gesprochen.«
»Diesbezüglich keine Sorge, sie hat gekündigt. Ihr hat es nicht gefallen, daß unser pedantischer technischer Direktor sie herumkommandiert hat. Übrigens werden Sie dessen Stellung übernehmen. Er geht in Pension. Abservieren konnte ich ihn nicht. Er hat der Firma dreißig Jahre treu gedient.«
So war Karl Friedrich Wellinger. Treue wurde von ihm honoriert.
»Ich bin mit meiner Stellung sehr zufrieden«, erklärte Jochen, »nur nach Ägypten gehe ich nicht wieder. Das muß ich zur Bedingung machen.«
»Ins Ausland schicken wir den Klossner«, sagte der Boß lächelnd, »und ich will, daß Sie mich entlasten, Jochen. Ich möchte Zeit haben für meine Frau und den Jungen. Aus ihm soll ein anständiger Mensch werden. Und von Mann zu Mann, halten Sie diese reizende Annabel fest. So eine Frau bekommt man selten.«
Martina hatte wirklich gute Vorarbeit geleistet, was Annabel betraf, doch ihres Einsatzes hatte es gar nicht bedurft. Jochen wußte schon sehr genau, was dieses Juwel wert war. Überstürzen wollte er dennoch nichts, und außerdem wollte er erst mal wieder zu Hause sein.
*
Mutter Hedwig hatte sich wohl oder übel damit abfinden müssen, daß Annabel den Tannenhof nun verließ. Nur Toby zeigte eine strahlende Miene, als sie Annabels Sachen abholten. Annabel fiel es nicht leicht, Mutter Hedwig diese Enttäuschung zu bereiten. Aber es war nur eine halbe Enttäuschung für die liebe Frau, denn sie gönnte Annabel von Herzen dieses private Glück, und sie zweifelte nicht daran, daß Annabel es bei Jochen Stahl und Toby finden wurde.
Während Toby mit Jan sprach, denn ihm hatte er viel zu erzählen, vertraute Annabel Mutter Hedwig ihr lange gehütetes Geheimnis an. Sie brauchte den Rat der mütterlichen Frau.
Ohne den Namen Wellinger zu erwähnen, berichtete sie von jener Nacht, die ihr junges Leben so grundlegend verändert hatte.
»Ich mochte diesen Mann nicht, obgleich ihm alle Frauen nachliefen, aber gerade meine Abwehr hatte ihn wohl gereizt. Er gehörte zu den Stammgästen des Hotels, und ich wollte mir diese gute Stellung nicht verscherzen. So versuchte ich, ihn zu überzeugen, daß er bei mir nichts erreichen würde. Doch damit erreichte ich nur das Gegenteil. Ich kann nicht schildern, wie schrecklich das alles war, und als ich dem Direktor am nächsten Morgen sagte, daß ich von diesem Kerl belästigt worden sei, bekam ich noch zu hören, daß ich ihn wohl herausgefordert hatte. Ich flog. Ich fand dann eine Stellung in einem Hotel im Schwarzwald. Und dann merkte ich, daß ich ein Kind bekommen würde. Ich wollte es nicht haben, ich wollte an diesen Schuft nicht erinnert werden. Ich fand keinen Arzt, der mir half, und ich hatte kein Geld, ins Ausland zu fahren. Ich ging dann zu einer Hebamme, doch sie überredete mich, das Kind zur Welt zu bringen und es dann wegzugeben. In ihrem kleinen Entbindungsheim wurde es so gehandhabt. Ich konnte auch dort bleiben. So geschah es dann auch. Ich erfuhr nicht einmal, ob es ein Junge oder ein Mädchen gewesen sei. Und als ich dann hierher kam, als die Kinder mir Liebe entgegenbrachten, wurde mir bewußt, daß ich falsch gehandelt hatte. Es wurde mir erst ganz bewußt, als Frau von Tammen Kathrin brachte, deren Vater ein charakterloser Mensch war und die doch ein liebenswertes Kind war. Und dann Toby, diese innige Zuneigung, und er ist auch am zwanzigsten September geboren.« Annabels Stimme versagte. Mutter Hedwig griff nach ihren Händen.
»Nun werden Sie entschädigt für das, was Sie durchlitten haben, Annabel«, sagte sie leise.
»Ich weiß nicht, ob ich nicht noch gestraft werde«, flüsterte Annabel. »Darf ich dann hierher zurückkehren, Mutter Hedwig?«
»Jederzeit, aber wer sollte Sie strafen?«
»Das Schicksal geht seltsame Wege«, sagte Annabel leise. »Ich habe es nun schon mehrmals erfahren. Dr. Stahl hat mich gefragt, ob ich bei Ihnen bleiben will, vielleicht wird er mich fragen, ob ich seine Frau werden will. Dann werde ich ihm die Wahrheit sagen müssen.«
»Sie müssen nicht. Ihr Gefühl muß entscheiden, ob Sie es können«, sagte Mutter Hedwig ruhig. »Ich denke, daß jeder anständige Mensch Verständnis für Ihre damalige Situation haben wird. Diese Türen hier stehen Ihnen jederzeit offen, Annabel. Es ist gut, daß Sie sich ausgesprochen haben.«
*
»Du bist traurig, Annabel«, sagte Toby betrübt.
»Ich habe Mutter Hedwig sehr lieb, Toby.«
»Ich habe dich auch sehr lieb«, sagte er. »So lieb kann dich sonst kein Kind haben. Und jetzt ist Maxi da. Die versteht es auch mit den Kindern. Darf Jan uns mal besuchen?«
»Wenn es dein Papi erlaubt.«
»Papi muß dann ja wieder arbeiten. Zuerst kann er sich aber erholen.« Er sah alles von seinem kindlichen Standpunkt, und er sah nur das Angenehme.
Dann kamen Tage, in denen auch Annabel wieder die Sorgen vergaß, die sie bedrückten. Jochen Stahl war daheim, aber mußte sich noch streng nach den ärztlichen Vorschriften richten und Annabel sorgte dafür, daß sie eingehalten wurden.
Nur kurze Ausflüge durfte er machen, und natürlich mußten Toby und Annabel ihn begleiten. Zu Hause wurde dann gespielt, Mensch ärgere dich nicht, Halma, Scrabble und Memory, und meistens war Toby der Sieger, weil Jochen und Annabel nie so ganz bei der Sache waren.
Der Haushalt lief wie am Schnürchen. Von Annabels Kochkünsten war Jochen längst überzeugt. Sie verstand es, sogar die Diätkost schmackhaft zu machen.
Als er dann zur Nachuntersuchung zu Dr. Behnisch ging, konnte der nur staunen.
»Ihnen geht es ja wieder blendend, Herr Stahl«, sagte er erfreut.
»Ja, es geschehen Wunder in mancherlei Hinsicht«, erwiderte Jochen. »Ich mußte mich ja auch ranhalten, damit der Boß endlich heiraten kann. Er will mich unbedingt als Trauzeugen haben.«
Das wird nicht das einzige sein, was ihn so froh macht, dachte Dr. Behnisch. Und damit traf er ins Schwarze.
Jochen meinte, daß es nun doch an der Zeit sei, mit Annabel ein ernstes Wörtchen zu reden. Der Tag war herangekommen, an dem Toby seinen ersten Gang zum Gymnasium antreten sollte. Und drei Tage später sollte dann sein Geburtstag gefeiert werden.
»Eigentlich ist es doof, daß die Ferien nicht noch einige Tage länger dauern«, meinte Toby. »Dann hätte Jan kommen können, aber der muß ja auch in die Schule.«
»Jan kann dann mal am Wochenende kommen, und dann feiern wir noch mal«, sagte Jochen. »Wir werden noch manchen Grund zum Feiern finden.« Und dabei sah er Annabel an.
An diesem Abend faßte er sich ein Herz, ihr die entscheidende Frage zu stellen. Als ahne es Toby, daß nun der ersehnte Zeitpunkt gekommen sei, entschloß er sich, bedeutend früher zu Bett zu gehen als sonst.
Und als Jochen eine Flasche Champagner kalt stellte, ahnte auch Annabel, daß die Stunde der Entscheidung nahte.
Jochen machte es sehr feierlich. »Heute sind Sie vier Wochen bei uns, Annabel, und ich bin sehr glücklich, daß es nicht bei diesen vier Wochen bleibt«, begann er. »Tobys Beharrlichkeit hat mir ein Glück beschert, an das ich nicht mehr glauben wollte. Aber er ist eben wirklich ein ganz besonderes Kind. Er sucht sich seine Eltern aus.«
»Wie meinen Sie das?« fragte Annabel staunend.
»Ich denke, daß alles klar sein sollte zwischen uns, bevor wir eine richtige Familie werden. So sollen Sie die einzige sein, die erfährt, daß Toby ein adoptiertes Kind ist. Ich empfinde es nicht so, denn für mich ist er mein Kind. Meine Frau konnte keine Kinder bekommen. Sie war damals schon krank, aber das wußten wir beide nicht. Wir holten Tony als Baby aus einem Heim.«
Er hatte in die flackernde Kerze geblickt, denn leicht fiel es ihm nicht, ihr dies zu erzählen, dann aber blickte er auf und sah sie an.
»Was ist Ihnen, Annabel«, fragte er heiser. »Erschreckt Sie diese Tatsache?«
»Nein«, flüsterte sie. »Ich habe nur immer vorausgesetzt, daß Toby Ihr Kind ist, geboren am zwanzigsten September vor zehn Jahren. Bitte, sprechen Sie nicht weiter. Ich muß Ihnen etwas sagen.«
Verwirrt blickte Jochen sie nun an. »Sie zittern ja, Annabel«, sagte er leise. »Ist es denn so schlimm, daß ich nicht der Vater bin?«
Sie legte die Hände vor ihr Gesicht. »Ich wünschte, Sie wären es«, schluchzte sie auf. »Jetzt bin ich nämlich davon überzeugt, daß ich Tobys Mutter bin. Das erklärt, daß ich ihn so liebe, daß ich so viel Glück verschenkte. Ich konnte doch nicht ahnen, daß er sich so entwickeln würde, daß er ein so liebenswertes Kind werden sollte.«
Jochen starrte sie an. Er meinte Karl Friedrich Wellingers Stimme zu vernehmen: Ist Ihnen schon aufgefallen, wie ähnlich der Junge dieser Annabel ist?
Annabel hatte unter seinem forschenden Blick den Kopf gesenkt. Sie ahnte nicht, wie er jetzt nach diesen Ähnlichkeiten suchte.
»Ich werde Ihnen alles erklären und dann werde ich gehen«, sagte sie leise.
»Das begreife ich nun überhaupt nicht«, stieß er heiser hervor.
»Sie wissen nicht, wer sein Vater ist«, flüsterte sie.
»Ich weiß nicht einmal, ob Sie tatsächlich seine Mutter sein konnten«, sagte er mit erzwungener Ruhe. »Wir haben den Namen der Mutter nicht erfahren. Uns wurde gesagt, daß Toby einfach zurückgelassen worden wäre in dem Entbindungsheim.« Er richtete sich auf. »Wollen Sie mir Ihre Geschichte nicht erzählen, Annabel?«
»Wollen Sie diese immer noch hören?« fragte sie bebend. »Eine Mutter, die ihr Kind einfach zurückläßt? So wurde es Ihnen doch berichtet.«
»Ganz so scheint es ja nicht gewesen zu sein. Ich möchte jetzt alles hören.«
»Es könnte so viel zerstören«, sagte sie mit erstickter Stimme.
»Was könnte es zerstören? Meine Bindung an Toby? Er ist zehn Jahre mein Kind. Und er wird immer mein Kind bleiben. Niemand kann ihn mir nehmen und niemand kann etwas zerstören. Ich will auch gar nicht wissen, wer sein richtiger Vater ist, wenn man es überhaupt so nennen kann. Und wenn Sie seine Mutter sind, bleibt doch eigentlich kein Wunsch mehr offen, Annabel. Toby liebt Sie, und ich liebe Sie auch.«
»Bitte sagen Sie das nicht, bevor Sie nicht alles wissen.«
»Ich werde es heute ganz bestimmt noch erfahren«, sagte Jochen mit einem flüchtigen Lächeln. »Aber jetzt muntern wir uns erst einmal mit einem Gläschen Champagner auf. Meine Kehle ist trocken.«
Ihre war es auch, doch nun stieg das Blut in ihre Wangen zurück.
Leise, zögernd, verhalten begann sie zu erzählen. Etwas anders, als sie es Mutter Hedwig berichtet hatte, und in ihrem Gesicht spiegelte sich die Qual der Erinnerung.
»Der Mann hieß Christoph Wellinger«, sagte sie tonlos.
Jochens Gesicht versteinerte. Seine Lippen preßten sich fest aufeinander. Er stand auf und riß die Terrassentür auf.
Annabel erhob sich langsam. Ihre Knie zitterten. »Ich habe ja gewußt, daß es ein Schock sein würde«, murmelte sie.
Jochen drehte sich um. »Nun, es erklärt zumindest die Ähnlichkeit mit Kathrin«, sagte er. Dann ging er auf Annabel zu und ergriff ihre Hände. »Du gehörst also auch zu den Opfern«, sagte er heiser. »Aber liebt Jobst seine Frau deshalb weniger? Immerhin war sie sechs Jahre mit diesem Kerl verheiratet.«
Tränen rannen über Annabels Wangen. Er tupfte sie mit seinem Taschentuch weg. »Nun zweifele ich allerdings nicht mehr, daß du Tobys Mutter bist, Annabel«, sagte er lelse, »aber nun können wir auch einen Schlußstrich unter dieses Drama ziehen. Du wirst meine Frau, Toby bekommt seine Mutter. und niemand wird etwas erfahren, was vor vielen Jahren geschah. Es weiß ja niemand, daß Toby ein adoptiertes Kind ist und er wird es niemals erfahren. Der Boß ist so glücklich an seinem jetzigen Leben, daß ihm jede weitere Erschütterung erspart bleiben sollte. Außerdem wäre es mir gar nicht recht, wenn der Name Wellinger unser Leben irgendwie beeinflussen sollte, abgesehen davon, daß Karl Friedrich mein hochgeschätzter Chef ist. Und wie ich von Jobst hörte, hatte Christoph einen anderen Vater. Er war kein Wellinger.«
»Das hat mir Martina auch gesagt«, flüsterte Annabel.
»Er hat von dem Namen profitiert und ihn mißbraucht, wie er unschuldige Mädchen mißbrauchte und Kinder in die Welt setzte, um die er sich so wenig kümmerte wie um diese Mädchen. Weißt du, was mir gefällt, Annabel?«
»Was könnte dir daran gefallen?« fragte sie bebend.
Er küßte sie auf die Stirn. »Jetzt hast du endlich auch du gesagt. Alles an dir gefällt mir. Du kanntest seinen Namen. Du hättest Kapital daraus schlagen können. Karl Friedrich Wellinger hätte das Kind niemals verleugnet, aber ich wäre ohne Toby längst nicht so glücklich, wie ich es durch ihn wurde. Und nun habe ich durch ihn dich auch noch dazu bekommen. Meinst du wirklich, ich würde dich gehen lassen, damit wir alle unglücklich werden?«
»Jetzt nicht mehr«, sagte sie leise und dann ließ sie sich von ihm küssen.
Sie hörten nicht wie die Türe leise geöffnet wurde. »Entschuldigung«, sagte Toby mit glucksendem Stimmchen, »ich wollte mir nur was zum Trinken holen. Ist alles in Ordnung, Papi?«
Beide streckten sie ihre Hände aus »Komm rein, Toby, es ist alles in bester Ordnung«, sagte Jochen. »Wir heiraten, und du hast nun deine Mami.«
»Das ist das allerschönste Geburtstagsgeschenk!« jubelte Toby.
*
An diesem Tag kam doch eine leise Wehmut in Annabel auf. Sie hatte ihn weggegeben, diesen Jungen, den sie so innig liebte. Aber als Jochen seinen Ärm um sie legte, als sie in seinen Augen so viel Zärtlichkeit sah, dachte sie, daß sle ja ihn nicht gefunden hätte, wenn dies damals anders gekommen wäre.
Liebevoll hatten sie ihm den Geburtstagstisch aufgebaut. Zehn Kerzen brannten auf einer verlockenden Torte, die Annabel ihrem Sohn gebacken hatte.
Aber für Toby war es das Allerschönste, als sie ihn in die Arme nahm und sagte: »Mein Sohn, ich bin so glücklich.«
»Weinen brauchst du aber nicht, Mami«, flüsterte er.
»Es sind Tränen der Freude, daß wir beisammen sind«, sagte sie innig.
Und schelmisch blickte er sie an. »Wann wirst du endlich Frau Stahl?« fragte er.
»Das Aufgebot ist schon bestellt«, lachte Jochen. »Der Boß wird staunen, daß ich schneller auf dem Standesamt bin als er.«
Ja, gestaunt wurde da schon. Um eine Woche kam Jochen ihm zuvor, aber Karl Friedrich Wellinger nahm ihm das nicht übel. Er freute sich darüber, daß bei seiner Hochzeit sein neuer Direktor mit Frau und Sohn erscheinen würde. Er hatte sich seinerseits auch als Trauzeuge angeboten.
Der zweite war Jobst, und zum Essen im engsten Kreis waren auch Dr. Norden und seine Frau Fee geladen worden.
»Da kann einem direkt mulmig werden«, meinte Fee, »kaum gedacht, schon vollbracht. Was Kinder so alles fertigbringen!«
»Mutter Hedwig wird uns ganz schön gram sein«, meinte Daniel.
Aber Mutter Hedwig bewies, daß sie nicht gram war. Sie hätte der Einladung zur Hochzeit auch gern Folge geleistet. Einen Tag mußten sie im Tannenhof halt mal ohne sie auskommen. Dieses Fest wollte sie sich nicht entgehen lassen.
Und als Annabel leise zu ihr sagte: »Ich hatte mein Kind verschenkt. Jetzt habe ich es wiederbekommen. Es gibt noch Wunder, Mutter Hedwig«, da verklärte sich ihr Gesicht.
»So viel Liebe kommt nicht von selbst«, sagte sie leise.
»Und ich habe gleich gesagt, daß dein Papi Annabel heiraten soll«, erklärte Kathrin mit tönender Stimme. »Aber wenn du jetzt immer noch kein Baby haben willst, bin ich dir wirklich sehr böse, Toby.«
»Wenn du nicht dauernd sagst, daß du mich heiraten willst, bin ich überhaupt nicht böse«, erwiderte Toby darauf.
»Erst müssen wir mal erwachsen werden«, sagte Kathrin. »Und Mami sagt, daß man sich sehr gut überlegen muß, wen man mal heiratet. Ich gehe jetzt zur Schule und bin nicht mehr dumm. Und außerdem bin ich bald eine große Schwester.«
Fee war eine stille Betrachterin an diesem Tag. Und als sie heimkamen, sagte sie zu ihrem Mann: »Man konnte tatsächlich meinen, daß Annabel Tobys Mutter ist. Sie sind sich so ähnlich.«
»Vielleicht ist sie es«, sagte Daniel. »Er ist nämlich ein adoptiertes Kind. Aber das behalte bitte schön für dich.«
Fee sah ihn fassungslos an. »Dann hätte der Zufall mal wieder Schicksal gespielt?« murmelte sie nachdenklich.
»Es ist nur eine Vermutung, Fee«, sagte er. »Aber wenn Annabel sagt, mein Sohn, liegt so viel in diesen zwei Worten. Doch wenn es so ist, weiß Jochen Stahl die Wahrheit.«
»Eine Frau wie sie gibt doch ihr Kind nicht weg«, meinte Fee gedankenvoll.
»Vor elf Jahren war sie ein junges Mädchen, wohl ein verzweifeltes junges Mädchen. Und vielleicht ist sie auch an so einen Kerl geraten, wie Christoph Wellinger einer war. Glücklicherweise ist sie daran nicht zugrunde gegangen, wie Georgias Schwester.«
»Er hat genau die gleichen Augen wie Annabel und auch das Grübchen in der Wange«, fuhr Fee sinnend fort.
»Was dir alles auffällt«, lächelte Danlel.
»Aber so krauses Haar wie Kathrin hat er nicht mehr. Weißt du noch, daß wir früher immer fanden, daß die beiden sich ähnlich sehen?«
»Sie geraten jetzt ihren Müttern nach, wie es scheint. Lieber Himmel, was wir uns so für Gedanken machen. Freuen wir uns, daß Toby sich nicht mehr mit obskuren Haushälterinnen herumärgern muß. Ich bin überzeugt, daß er jetzt nicht mehr so oft krank sein wird. Und freuen wir uns auch darüber, daß Jochen Stahl wieder ganz gesund geworden ist.«
*
Solche Gedanken wie sie machten sich die anderen Beteiligten nicht. Martina freute sich, in Annabel die Freundin gefunden zu haben, mit der sie über alles sprechen konnte, was sie bewegte. Und eine werdende Mutter machte sich manchmal auch ganz überflüssige Sorgen, wenn es ihr einen Tag mal nicht so gut ging.
Karl Friedrich Wellinger war von Herzen froh, daß Jochen wieder in die Fabrik zurückkehrte. Wenn auch an richtige Flitterwochen mit Georgia nicht gedacht wurde, denn Chris mußte ja wieder zur Schule gehen, so wollte er doch wenigstens ein paar Wochen überwiegend für die Familie da sein.
Schnell war auch diese Woche vergangen und der Tag war angebrochen, an dem Georgia nun Frau Wellinger werden sollte. Das Haus war buchstäblich auf den Kopf gestellt worden.
Alles was an Christoph erinnerte, war entfernt worden. Auch die Zimmer, die Vera früher bewohnt hatte, wurden anders eingerichtet.
Georgia hatte keine Beklemmungen. Sie wußte, daß sie die Stärkere war. Karl Friedrich hatte ihr vorgeschlagen, ein anderes Haus zu kaufen, aber sie hatte gesagt, daß man ein solches wie dieses so leicht nicht finden könne.
Sie hatte die Vergangenheit restlos bewältigt. So hart wie sie vom Leben angepackt worden war, so hart beseitigte sie auch alle Spuren, die Vera und Christoph hinterlassen hatten. Es gab für keinen mehr ein eignes Reich. Es gab keine verschlossenen Türen mehr in diesem Haus. Es war hell und freundlich geworden.
»Wenn dich etwas ärgert, Frieder, ziehst du dich nicht schmollend in dein Arbeitszimmer zurück«, hatte sie ihm erklärt. »Dann wird erst darüber geredet. Und wenn du etwas an mir oder Chris auszusetzen hast, dann sagst du es.«
»Ich habe aber nichts auszusetzen«, erklärte er mit tiefem Lachen.
»Es kann ja noch kommen. Ich will dir nur sagen, wie ich mir eine richtige Ehe vorstelle. Und das Wort Dankbarkeit will ich auch nicht mehr hören. Wenn ein Mensch Grund hat, dankbar zu sein, bin ich es.«
»Ich will das auch nicht mehr hören«, sagte er. »Schluß damit, Georgia. Von jetzt an gibst du den Ton hier an.«
»Wir«, sagte sie. »Es heißt wir, Frieder. Du, ich und Chris!«
*
Durch eine Hintertür fanden sie sich auf dem Standesamt ein, um den Neugierigen zu entgehen, die sich vor dem Hauptportal versammelt hatten und endlich sehen wollten, wen der alte Wellinger da heiraten wollte.
Bildschön sah Georgia aus in einem zartgelben Seidenkostüm, sehr flott ihr Frieder in mattem Grau, und nur Chris schien sich etwas unbehaglich zu fühlen in den langen grauen Hosen und dem dunkelblauen Blazer.
Ebenso war aber Toby gekleidet, und das beruhigte Chris etwas. Kathrin dagegen hatte das lange rüschenbesetzte Kleidchen bekommen, das sie selbst ausgesucht hatte.
Und stolz saß sie zwischen Chris und Toby, gleich hinter dem heiratswilligen Paar, eingerahmt von Martina und Annabel, deren Ehemänner auf der vorderen Bank Platz nehmen mußten. Sie waren ja Trauzeugen.
»Dreimal zwei ist sechs, dreimal drei ist neun«, posaunte Kathrin lautstark heraus, als die Zeremonie beendet war.
»Pssst«, zischte Toby, »sei nicht so vorlaut!«
»Mein Papi hat das heute morgen aber gesungen«, sagte Kathrin. »Und neun sind wir. Ich kann schon zählen, Toby.«
»Und wenn dein Bruder da ist, sind wir zehn«, sagte er.
Kathrin lachte. »Vielleicht wird es auch eine Schwester«, sagte sie. »Was wünscht du dir denn? Ihr bekommt bestimmt auch ein Baby, hat Mami gesagt.«
Toby runzelte die Stirn. »Dann wünsche ich mir eine Schwester«, sagte er gnädig gestimmt.
Da standen sie beieinander, Chris, Toby und Kathrin, drei Kinder, die den gleichen Vater hatten und drei verschiedene Mütter. Aber das wußten nur Annabel und Jochen, die die Kinder sinnend betrachteten.
»So ähnlich sind sie sich wirklich nicht, Annabel«, sagte Jochen ruhig. »Die Familie formt die Charaktere.«
»Chris und Toby verstehen sich«, sagte Georgia zu ihrem frisch angetrauten Mann. »Ich freue mich, wenn sie Freunde werden.«
»Sie haben das gleiche Naturell«, sagte er. »Sie werden es bestimmt weit bringen.«
»Die Hauptsache ist, daß sie anständige Männer werden«, sagte Georgia. »Wir werden uns mit dem einen Sohn begnügen müssen, Frieder, Martina und Annabel werden noch mehr Kinder in die Welt setzen.«
»Und wenn dir eins nicht langt, kannst du bei den andern aushelfen«? sagte er.
»Aber ich möchte dich soviel wie nur möglich für mich haben.«
Aber dann wurde gefeiert, und niemand verschwendete einen Gedanken an einen Christoph Wellinger, der in Frankreich begraben wurde.
Als Georgia vier Monate später erfuhr, daß Pierre Montand plötzlich an einem Herzinfarkt verstorben war, sorgte sie großzügig für seine Witwe und die drei Kinder.
Ihr Leben war reich an Freude. Martina schenkte einem Sohn das Leben, der auf die Namen Jobst Jochen getauft und Jojo genannt wurde, was Kathrin besonders hübsch fand, und im Sommer darauf konnte Annabel ihrem überglücklichen Mann eine süße kleine Tochter in den Arm legen.
Da war Toby eigentlich nur beleidigt, daß er sie nicht zuerst sehen durfte, aber noch viel tiefer gekränkt hätte es ihn, wenn sie nicht auch den Namen Annabel bekommen hätte. Aber er hatte ja seinen Papi ganz auf seiner Seite, als die Mami dagegen protestiert hatte.
Und inzwischen gehörten auch Daniel und Fee Norden zu den wenigen, die wußten, daß Tobys geliebte Mami auch seine richtige Mutter war. Jochen hatte es Dr. Norden anvertraut, als Annabel das Baby erwartete. Da hatte er gesagt: »Ich kann nur hoffen, daß es genauso wird wie Toby.«
Und die kleine Annabel hatte das Glück, nicht nur von ihren Eltern geliebt zu werden, sondern auch von ihrem großen Bruder.