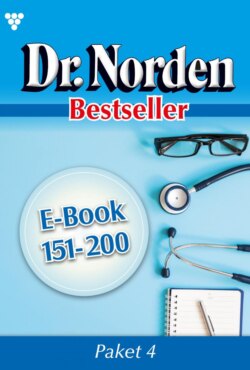Читать книгу Dr. Norden Bestseller Paket 4 – Arztroman - Patricia Vandenberg - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеParadies nannten die Gebirgler das Tal, durch das Daniel und Fee Norden wanderten, und auch sie fanden es paradiesisch schön. Es war ein herrlicher Morgen, frisch, aber sonnig, und die Luft war so würzig, daß sie immer wieder ganz tief atmeten.
Die Kinder waren auf der Insel der Hoffnung in bester Obhut, und so konnten Daniel und Fee mal einen Tag in aller Ruhe und Besinnlichkeit genießen. So dachten sie jedenfalls, als sie nun bergan stiegen, der Sonne entgegen, unter deren Strahlen die Tautropfen auf den Wiesen wie Perlen schimmerten.
»Ganz schön anstrengend«, schnaufte Fee nach einer guten halben Stunde. »Ich bin nichts mehr gewohnt.«
»Wir können ja ausruhen«, meinte Daniel. »Wir haben Zeit, und talwärts geht es dann wieder leichter.«
Er suchte nach einem trockenen Platz. Fee hob lauschend den Kopf. »Der Wasserfall muß ganz in der Nähe sein«, sagte sie. »Paß auf, daß du nicht abrutschst, Schatz. Hier ist es ganz schön glitschig, nichts zum Niedersetzen.«
Aber Daniel hörte augenblicklich gar nicht zu, denn er hatte etwas im Gras entdeckt, was ihn stutzig machte. Es war ein Damenschuh, und der sah nicht so aus, als würde er schon lange dort liegen. Und auch Fee hatte plötzlich etwas entdeckt. Ein buntes Kopftuch mit Fransen. Ein ähnliches besaß sie auch.
»Das ist merkwürdig«, sagte Daniel. »Ein teurer, fast neuer Schuh...«
»Das Kopftuch ist auch nicht billig«, sagte Fee. »So etwas wirft man nicht achtlos weg.«
»Und da sind Schleifspuren«, fuhr Daniel fort. Sein Gesicht verdüsterte sich etwas, als er vorsichtig weiterging.
»Paß auf, da ist die Schlucht«, rief Fee besorgt, aber da vernahm sie schon von ihm einen erschreckten Ausruf. »Da unten liegt jemand, ein Mädchen anscheinend!« Er drehte sich zu Fee um. Sein Gesicht war ganz blaß geworden. »Von hier aus kommen wir da nicht heran, Fee. Wir müssen Hilfe holen. Vielleicht lebt sie noch.«
»Da drunten war doch eine kleine Brücke, und da steht ein Haus«, sagte Fee tonlos. Sie starrte den weinroten Schuh an. »Nicht das richtige für einen Ausflug«, sagte sie leise. »Auf Ledersohlen rutscht man leicht aus.«
»Überlegen können wir später«, meinte Daniel. »Jetzt müssen wir aufpassen, daß wir nicht ausrutschen.«
Talwärts ging es zwar rascher als bergan, aber sie rutschten tatsächlich mehr, als sie gehen konnten, und dann waren sie an der kleinen Brücke, die über das Bächlein führte, das sein klares Wasser wohl von dem Wasserfall zugeführt bekam. Etwa zweihundert Meter weiter stand das Haus, das sie vorhin flüchtig wahrgenommen hatten. Es war ein altes Bauernhaus, und es sah nicht gerade einladend aus.
Ein kräftiger junger Bursche war damit beschäftigt, ein altes Auto zu reparieren. Er schien über die Störung gar nicht erfreut zu sein, aber als Daniel ihm jedoch klarmachte, daß jemand dringend Hilfe benötigte, wischte er sich die Hände ab und rief dann lauthals nach einem Peppi.
»Bring die Trage, am Wasserfall liegt jemand, sagt der Herr.«
»Sakradi, schon wieder«, brummte der stämmige Junge. »Die depperten Stadtleut’!«
Daniel und Fee nahmen es ihm nicht übel, denn bald lernten sie in den beiden zwei hilfsbereite junge Männer kennen, die nicht viel redeten, die Weg und Steg kannten und eilends voranschritten.
»Bleib du zurück, Fee«, sagte Daniel, als sie der Verunglückten näherkamen.
»Wird wirklich ein Wunder sein, wenn die noch lebt«, sagte der ältere der Bauernburschen, der Jakob hieß, wie die Nordens schon vernommen hatten.
»Ich bin Arzt«, sagte Daniel. Und dann war der Peppi schon bei dem Mädchen.
»A bissel atmet’s noch«, murmelte er. »Mei, die Baroneß, Jakob.«
Fragen stellte Dr. Norden jetzt nicht. Er befaßte sich mit der Verunglückten, die schwer verletzt war und deren Gesicht schlimme Kratz- und Schürfwunden aufwies.
»Die Nicola von Stiebenau«, brummte der Jakob, »das geht mir nicht in den Schädel.«
»Ist ein Krankenhaus in der Nähe?« fragte Daniel.
»A gute Stund’ entfernt«, erwiderte der Peppi.
»Ich habe meinen Arztkoffer im Auto«, meinte Daniel.
»Im Haus haben wir a Apotheken«, brummte Peppi.
Vorsichtig wurde die Bewußtlose auf die Trage gebettet, und Daniel konnte feststellen, daß die beiden Burschen Übung im Transport von Verletzten hatten. Jakob erklärte dann auch, daß sie beim Bergrettungsdienst wären.
So ungastlich das Haus von außen wirkte, so wohnlich war es innen. Aber dafür hatten Daniel und Fee Norden jetzt keine Augen. Beide befaßten sich mit der Schwerverletzten, als Peppi die bestens ausgestattete Hausapotheke gebracht hatte.
»Sie werden’s net glauben, was hier alles passiert«, sagte er brummig, »und nur, weil die Städter das Gelände unterschätzen.«
»Aber die Baroneß kennt es«, sagte Jakob. »Hast jetzt den Rettungsdienst erreicht, Peppi?«
»Sind schon auf dem Weg«, erwiderte der Jüngere. »Wenn sie vorher stirbt, das wär mir arg. Dann wird’s am End wieder dem Markus in die Schuhe geschoben.«
Daniel Norden horchte auf. »Wen meinen Sie?« fragte er.
»Ach, so eine alte Geschicht’, Familienfehde«, erwiderte Peppi.
»Halt deinen Mund«, fauchte ihn Jakob an.
»Wir haben doch damit nichts zu tun, Jakob.«
»Markus war schon lang’ nimmer hier«, knurrte Jakob.
Daniel und Fee tauschten einen langen Blick. Daniel fühlte den Puls des Mädchens, das er notdürftig hatte versorgen können, aber er wußte, daß ihr Leben an einem hauchdünnen Faden hing.
Der Rettungswagen kam. Er war bestens ausgestattet, und der Notarzt zeigte sich erfreut, daß ein Kollege ihm bei der Versorgung des Mädchens helfen wollte.
»Kann meine Frau hierbleiben?« fragte Daniel. »Ich hole sie dann ab.«
Peppi und Jakob Brandner nickten zustimmend, und sie fragten Fee dann auch höflich, ob sie ihr etwas bringen könnten.
»Sie leben allein hier?« fragte Fee freundlich.
»Die Großmutter ist im Altersheim«, erklärte Peppi.
»Die Eltern leben nimmer«, fügte Jakob rauh hinzu. »Ein Steinschlag war schuld. Woher sind Sie, Frau Doktor?«
»Aus München.«
Jakob musterte sie. »Gut ausgerüstet sind Sie schon«, stellte er fest. »Sie ahnen ja nicht, wie hier die Stadtleut’ manchmal herumsteigen. Narrisch könnt’ man werden.«
»Aber Sie sagten, daß die Baroneß das Gelände kennt«, tastete sich Fee vor.
»Ja, freilich, sie haben da droben ja die Berghütten, aber früher ist sie immer recht zünftig dahergekommen.«
»Immer allein?« fragte Fee.
»Nein, nur manchmal.«
»Jetzt soll sie ja verlobt sein«, warf der Peppi ein.
»Genaues weiß man nicht«, sagte Jakob verweisend. »Geredet wird es halt.«
»Sie sprachen auch von einem Markus«, sagte Fee vorsichtig.
»Der ist nicht hier«, erwiderte Jakob unwillig.
»Es handelt sich doch augenscheinlich um einen Unfall«, sagte Fee. »Man wird die Angehörigen benachrichtigen müssen. Und Sie scheinen die Familie gut zu kennen.«
»Es ist niemand mehr da als die Baroneß«, erwiderte Jakob etwas wortkarg.
»Und bei ihrem Vater war es auch ein Unfall, aber den wollte man dem Markus anhängen«, erklärte Peppi empört. »Die Frau Doktor kann es doch ruhig wissen, Jakob. Ich möchte auch gern wissen, warum die Baroneß nicht bei uns hereingeschaut hat, wenn sie schon auf dem Weg zur Hütten war.«
Jakob starrte nachdenklich zum Fenster hinaus. »Ja, das ist merkwürdig«, sagte er rauh. »Grüß Gott hat sie allweil gesagt.«
Fee betrachtete die beiden jungen Männer nachdenklich. So richtige Naturburschen waren sie und anscheinend auch recht ordentlich und tüchtig, wie das saubere Haus verriet, in dem es überhaupt keine Frau zu geben schien.
Doch dann erschien plötzlich eine, ein blondes, kräftiges junges Mädchen. Auf einem Fahrrad war sie gekommen und brachte einen Korb.
»Grüß euch«, sagte sie munter, dann starrte sie Fee an. »Ihr habt Besuch?« fragte sie staunend.
»Das ist eine Frau Doktor aus München. Es hat hier einen Unfall gegeben, Tresi«, erwiderte Jakob. »Die Baroneß…«
»Die Nicola?« schrie Tresi auf. »Nein, wo ist sie?«
»Ins Krankenhaus haben sie sie gebracht«, sagte Peppi, während Jakob dem Mädchen beruhigend den Rücken tätschelte.
»Mein Name ist Norden«, sagte Fee. »Mein Mann begleitet die Verunglückte. Wir sind Ärzte und wollten eine Wanderung machen. Da haben wir sie gefunden.«
»Wo?« fragte Tresi.
»Am Wasserfall. Sie muß ausgeglitten sein«, erwiderte Fee.
»Die Nicola? Nie und nimmer, die kennt doch den Hang«, stammelte Tresi. »Sie weiß, daß da die Schlucht ist.«
»Sie hatte Schuhe mit Ledersohlen an«, sagte Jakob heiser.
Tresis klare Augen verdunkelten sich. »Da stimmt etwas nicht«, sagte sie tonlos.
»Sie kennen die Baroneß gut?« fragte Fee.
»Mein Vater war Verwalter auf Gut Stiebenau. Das ist dann verkauft worden, nachdem der Baron auf der Jagd verunglückt ist. Und nun die Nicola? Ich verstehe das nicht.« Sie war sichtlich erschüttert, und in ihren klaren Augen war ein ziemlich ängstlicher Ausdruck.
»Sie wird doch am Leben bleiben?« fragte sie nach einem tiefen Atemzug.
»Das kann ich von hier aus und jetzt noch nicht sagen«, erwiderte Fee, »aber es sieht sehr bös aus.«
»Und man hat sie ins Kreiskrankenhaus gebracht? Aber da ist doch der Ronneberg Arzt«, flüsterte Tresi.
»Und was bedeutet das?« fragte Fee.
»Ach, nichts, die Tresi gibt auch zuviel auf Gerede«, warf Jakob unwillig ein.
Fee blickte nachdenklich aus dem Fenster hinaus. Es schien einige Rätsel um diese Nicola von Stiebenau zu geben. Doch Tresi sagte jetzt eigensinnig: »Gerede hin, Gerede her. Nicola tät einen Schock bekommen, wenn der Ronneberg plötzlich an ihrem Bett steht, das weiß ich, und wenn das eine Frau Doktor ist, werde ich ihr auch sagen warum, damit sie dafür sorgt, daß Nicola in eine andere Klinik kommt.«
»Ich wäre dankbar für jede Auskunft, denn es werden ganz sicher im Zusammenhang mit dieser jungen Dame noch manche Fragen gestellt werden, wohl auch an Sie, wie an alle, die Nicola von Stiebenau kennen«, sagte sie ruhig.
Tresi legte den Kopf zurück. Ihre Blicke wanderten zwischen den beiden jungen Männern hin und her. »Ihr habt doch nichts zu verbergen. Seid doch nicht gar so stur.«
»Mit dem alten Ronneberg mag ich mich nicht anlegen«, sagte Jakob trotzig, »und mit dem jungen mag ich nichts zu schaffen haben.« Und dann trat für lange Zeit Schweigen ein, bis Tresi zu Fee sagte: »Gehen wir ein Stück? Zeigen Sie mir, wo Nicola gefunden wurde? Die Burschen tun es ja doch nicht. Aber vielleicht sind sie nur grantig, weil sie noch kein richtiges Frühstück hatten. Es ist alles im Korb.«
Daß Tresi ein intelligentes Mädchen war, konnte Fee sehr schnell herausfinden. Mit vollem Namen hieß sie Teresa Portner.
»Wenn die beiden stur sind, dürfen Sie es nicht übelnehmen, Frau Doktor«, sagte sie entschuldigend. »Das war für sie bestimmt auch ein Schock. Ihr Vater war der Revierförster beim Baron Stiebenau. Sie sind keine Dummen. Der Jakob wird Lehrer und hat jetzt nur Ferien, und der Peppi macht eine Kunstschreinerlehre. Sie sind jetzt nur in den Ferien hier, sonst wohnen sie in der Kreisstadt. Wir kennen uns von Kindheit an.«
»Und die Nicola kennen Sie auch von Kindheit an«, sagte Fee forschend.
»Ja, gewiß, wir sind sogar zusammen zur Schule gegangen, bis Nicola ins Internat gekommen ist. Mit dem Gut ging es da schon bergab, weil der Baron gar so viele Hypotheken aufnehmen mußte. Seine kranke Frau hat halt viel Geld gekostet, und dann hat er auch noch Verwandte versorgen müssen. So genau weiß ich das nicht, aber mein Vater sagte, daß es zuviel war, was auf ihm lastete, und der Gesündeste war er auch nicht mehr.« Sie versank in nachdenkliches Schweigen.
»Sie sagten, daß er bei einem Jagdunfall starb, oder die Brandner Brüder sagten es. Ich bin jetzt schon ein bißchen verwirrt.«
»Es war ein mysteriöser Unfall, das sagte wenigstens mein Vater. Er soll in sein eigenes Gewehr gefallen sein.«
*
Indessen bemühten sich die Ärzte im Kreiskrankenhaus von Stiebenau. Dr. Nordens Mithilfe wurde gern akzeptiert.
Es wurde festgestellt, daß Nicola eine schwere Gehirnerschütterung und innere Verletzungen davongetragen hatte, die noch nicht genau festgestellt werden konnten. Dazu eine Unterschenkelfraktur und ein Schlüsselbeinbruch. Erstaunlicherweise hatte sie sonst keine Brüche aufzuweisen.
»Sie muß sich wohl instinktiv heruntergerollt haben«, stellte der Chefarzt fest, ein grauhaariger untersetzter Mann mit Namen Großkopf.
Dann wurde Daniel ans Telefon gerufen, und er wußte, daß es nur Fee sein konnte. Was sie ihm sagte, versetzte ihn in Bestürzung.
»Ich werde es versuchen«, erklärte er, da eine junge Schwester in unmittelbarer Nähe stand und lauschte. Ja, es war Daniel nicht entgangen, daß sie sehr intensiv lauschte. Sie war schlank und hübsch, und Daniel fing einen lauernden Blick von ihr auf, der ihm zu denken gab.
»Wo stecken Sie denn, Schwester Tina?« rief eine unwillige Frauenstimme, und da verschwand sie.
Dafür lernte Dr. Norden dann die Oberschwester Mathilde kennen, die ihn sehr kritisch musterte.
»Sie sind Dr. Norden, der Schwiegersohn von Dr. Cornelius?« fragte sie dann aber so freundlich, daß er fast erleichtert war, denn sie machte einen sehr strengen Eindruck.
»Der bin ich. Sie kennen meinen Schwiegervater?«
»Und die Insel der Hoffnung«, erwiderte sie. »Ich war selbst schon dort.«
Irgendwie hatte er das Gefühl, sich ihre Sympathie sichern zu müssen. »Vielleicht treffen wir uns dann dort einmal«, sagte er.
»Kann schon sein. Ich hätte nichts dagegen.«
»Würden Sie mir bitte sagen, welcher von den Ärzten Dr. Ronneberg ist?« fragte Daniel leise.
Sofort verschloß sich ihr Gesicht wieder. »Der hat Urlaub, und das wird gut sein, da die kleine Stiebenau hier ist«, brummte sie. »Scheint doch so zu sein, als läge ein Fluch auf der Familie.«
»Auf den Stiebenaus?« fragte er leise.
»Ich mag hier nichts sagen«, murmelte sie. »Mein Dienst ist um fünf Uhr zu Ende. Wenn Sie bleiben, können wir uns treffen. Ich wohne am Wiesenhang zehn.«
»Dann bleibe ich«, erwiderte er rasch.
Er ging in den kleinen OP zurück, in den man Nicola gebracht hatte. Dr. Großkopf sah ihn an. »Sieht nicht gut aus. Ich wäre dafür, sie in eine Spezialklinik zu bringen.«
»Meinen Sie, daß sie transportfähig ist?« fragte Daniel.
»Bis morgen muß man wohl warten. Wenn das Herz durchhält, bin ich bereit, die Verantwortung für den Transport zu übernehmen.«
»Dann werde ich dafür sorgen, daß sie bestens versorgt wird«, erklärte Daniel, denn nach dem, was Fee ihm gesagt hatte, ahnte er, daß man sie aus ganz bestimmten Gründen nicht in diesem Krankenhaus behalten wollte. Aber vielleicht konnte er über diese Gründe mehr von Schwester Mathilde erfahren.
»Das ist sehr freundlich, Herr Kollege«, sagte Dr. Großkopf mit einem ganz seltsamen Ausdruck. »Wir haben zuwenig Personal, um einen Patienten rund um die Uhr zu beobachten, und die Intensivstation ist voll belegt. Ich werde mein Bestes tun, damit das Herz der Patientin gestärkt wird. Glücklicherweise handelt es sich ja um eine sehr sportliche junge Dame, die schon mehrere Stürze vom Pferd überstanden hat und außerdem eine ausgezeichnete Schwimmerin und Skifahrerin ist. Kein Treibhausgewächs, wie so manche Töchter aus vornehmen Familien.«
»Sie kennen Fräulein von Stiebenau?«
»Ihre Mutter ist in diesem Krankenhaus gestorben«, erwiderte Dr. Großkopf. »Für ihren Vater mußte ich den Totenschein ausstellen. Ich wäre außerordentlich dankbar, wenn mir ein anderer Arzt in diesem Fall die Verantwortung abnehmen würde«, fügte er müde hinzu.
Dr. Norden blickte in das schmale zerschundene Gesicht des jungen Mädchens, das unter normalen Bedingungen bildschön sein mußte. Und auch er hatte das Gefühl, daß dieser Ausflug, auf den sie sich so sehr gefreut hatten, dramatische Folgen nach sich ziehen würde.
Er holte dann seinen Wagen vom Parkplatz vor dem Dorfkrug und fuhr zu dem Haus der Brüder Brandner zurück. Dort saß Fee jetzt mit den beiden Burschen und Tresi am Tisch und trank Kaffee.
»Wenn sie morgen noch lebt, werden wir sie nach München bringen lassen«, sagte Daniel, bevor Fee noch etwas gesagt hatte.
»Wenn Ronneberg es nicht verhindert«, stieß Tresi hervor.
»Er hat Urlaub. Ich habe mich erkundigt«, erwiderte Daniel ruhig und blickte das Mädchen dann nachdenklich an. »Sie können mir einiges über Nicola von Stiebenau erzählen?«
»Ich habe Ihrer Frau schon viel erzählt«, sagte Tresi.
»Aber ich darf Ihnen noch ein paar Fragen stellen?«
Tresi sah Jakob an. »Ist schon gut, Tresi«, sagte er heiser, »den Doktors können wir trauen.«
»Dann fragen Sie«, sagte Tresi vorsichtig.
»Wann und woran ist Frau von Stiebenau gestorben? Wissen Sie das?«
»Gestorben ist sie vor fünf Jahren. Sie war querschnittgelähmt nach einem Sturz vom Pferd. Sie war eine bekannte Turnierreiterin.«
»Dr. Großkopf sagte mir, daß auch Fräulein von Stiebenau einige schwere Stürze vom Pferd gut überstanden hat.«
»So arg war das bei Nicola nie. Der Satan hat sie ein paarmal abgeworfen.«
»Satan?«
»Ein schwarzer Hengst. Markus hatte ihn ihr geschenkt.«
Wieder war der Name Markus gefallen, und die Nordens spitzten beide die Ohren, als Daniel jetzt fragte, wer denn dieser Markus sei.
»Markus Wangen, der Industrielle. Er hatte ein paar Hypotheken auf Gut Stiebenau, aber verkauft hat der Baron dann doch an den alten Ronneberg.«
»Er hat nicht verkauft«, fiel ihr Jakob ins Wort. »Die Nicola hat dann an Ronneberg verkauft. Und das hat Markus verbittert. So war es und nicht anders.«
»Brauchst dich doch nicht gleich aufzuregen, Jakob«, lenkte Tresi ein. »Nicola hat Ronneburg doch vorgezogen, weil ihr Vater es wollte.«
»Ich glaube gar nichts mehr«, sagte Jakob. »Da ist allerhand faul, das weißt du so gut wie wir und wie dein Vater, Tresi.«
»Lassen wir das mal«, sagte Daniel. »Es geht jetzt darum, warum sich Nicola von Stiebenau hier aufgehalten hat und wen sie möglicherweise treffen wollte.«
»Doch höchstens den Tönnies auf der Alm«, mischte sich der Peppi ein. »Er hat heute Geburtstag.«
»Und wir wollten hinaufgehen zu ihm«, murmelte Tresi. »Alles ist durcheinandergeraten.«
»Ist das weit?« fragte Daniel.
»Nein, eine knappe Stunde«, erwiderte Jakob.
»Dann gehen wir doch zu ihm, wenn es gestattet ist, daß wir mitkommen«, sagte Daniel. »Ich möchte gern wissen, ob er mit dem Besuch von Fräulein von Stiebenau gerechnet hat. In welchem Verhältnis steht sie zu ihm?«
»Verhältnis?« fragte Peppi staunend. »Er war Pferdeknecht auf dem Gut und ist jetzt auf der Alm. Ich frag mich aber immer wieder, warum Nicola nicht bei uns hereingeschaut hat. Sie weiß doch, daß wir Ferien haben und dann immer hier sind.«
»Ich werde dafür sorgen, daß Fräulein von Stiebenau in eine bestens eingerichtete Klinik verlegt wird«, sagte Daniel, »und ich hoffe sehr auf Ihre Mithilfe, falls bei diesem Unfall einige Unklarheiten bestehen.«
Tresi erhob sich. »Auf mich können Sie zählen, Herr Doktor.«
»Auf uns auch«, sagte Jakob mit schwerer Stimme. »Also gehen wir zu Tönnies.«
Fee und Daniel blieben absichtlich etwas zurück. »Ist etwas faul, Daniel?« fragte Fee.
»Ich tappe im dunkeln, aber einige Leute verhalten sich doch sehr seltsam. Später reden wir darüber, Fee.« Dann rief er den drei jungen Leuten ein Halt zu, und die blieben auch sofort stehen.
»Hier haben wir den Schuh und das Kopftuch gefunden«, sagte er.
»So dicht an der Schlucht?« fragte Tresi. »Nicola wußte doch, wie glitschig es hier ist.«
Peppi ging schon mit gesenktem Kopf weiter, und dann bückte er sich plötzlich. Zwischen spitzen Fingern hielt er ein Papiertaschentuch. »Da ist Blut dran«, sagte er.
»Das kann jemand verloren haben«, sagte Daniel, »aber wir werden es mitnehmen.«
Die Sonne brannte herab, obgleich die Mittagszeit längst überschritten war.
»Heißt nicht umsonst die Sonnenalm«, sagte Tresi und fuhr sich mit dem Handrücken über die Stirn.
»Ist es noch weit?« fragte Fee, die ihre Füße schon sehr spürte.
»Nicht mehr, und jetzt geht es nicht mehr so steil bergan«, erwiderte Jakob. »Da drüben steht die Hütte.«
Das Dach konnte man schon sehen, und nun hörten sie auch das Muhen der Kühe.
»Sie tun nur so, als hätten sie Durst«, sagte Tresi nachdenklich. »Aber Tönnies hat den Trog doch bestimmt gefüllt. Und wie der Wastl heult, Jakob.«
Jetzt vernahmen auch Fee und Daniel das jammervolle Heulen eines Hundes. Peppi stieg hurtig voran, und auch Jakobs Schritte wurden schneller. Flink wie eine Gemse stieg Tresi ihnen nach.
Und dann kam das zweite Entsetzen. Peppi stand da mit schreckverzerrtem Gesicht: »Der Tönnies, der Tönnies ist tot!« schrie er gellend und voller Furcht.
Der alte Mann lag in einer Blutlache vor der Hütte. Kein Atemzug war zu vernehmen. Sanft drehte ihn Daniel um. »Er wurde erschossen«, sagte er dumpf.
»O Gott, allmächtiger Gott«, schluchzte Tresi auf und sank neben ihm in die Knie. Und dann griff sie nach seiner Hand, die zur Faust geschlossen war.
Die tote Hand hielt etwas umschlossen. Daniel stellte es fest und löste behutsam einen Knopf aus den starren Fingern. Mitsamt einem Stückchen Leder mußte er gewaltsam aus einer Jacke oder einem Mantel gerissen worden sein, und das ließ darauf schließen, daß Tönnies versucht hatte, sich seines Angreifers zu erwehren. Aber er war tot, und er konnte nicht mehr reden, und nun saß der blonde Labrador mit gesträubtem Fell in einiger Entfernung und stieß leise Klagelaute aus.
»Ein schöner Hund«, sagte Fee leise.
»Tönnies hat den Wastl aufgezogen«, murmelte Tresi. »Der Baron hatte eine Zucht, einen von den letzten hat er Tönnies geschenkt, und einen hat Nicola behalten.« Sie blickte auf. »Sie hatte den Hund nicht dabei«, fuhr sie dann nachdenklich fort. »Was soll das alles nur bedeuten? Es ist so schrecklich. Habt ihr denn gar nichts bemerkt, Jakob?«
»Nein, ich war mit dem Auto beschäftigt, und Peppi war im Haus. Aber ich meine, daß wir jetzt die Polizei holen müssen.«
»Sie haben recht«, sagte Daniel. »Ich habe nachher auch noch eine Verabredung.«
»Eine Verabredung, mit wem?« fragte Fee bestürzt.
»Mit Oberschwester Mathilde. Du kannst mitkommen, Fee. Sie kennt Paps und die Insel, und wir müssen dort auch noch anrufen, daß wir über Nacht hierbleiben.«
»Darauf sind wir aber gar nicht vorbereitet«, murmelte Fee.
»Ich denke, es muß sein«, sagte Daniel.
Wenn wir schon mal einen Ausflug machen, dachte Fee betrübt, aber das dramatische Geschehen beschäftigte sie doch mehr.
*
Die Dorfpolizei fühlte sich diesem Geschehen nicht gewachsen, da mußten die Kriminalisten aus der Stadt geholt werden. Daß der gewaltsame Tod von Tönnies in Zusammenhang mit Nicolas mysteriösem Unfall stand, vermuteten Daniel und Fee sofort, und auch, daß dies noch weite Kreise ziehen würde.
Fee hatte ein langes Telefongespräch mit Anne Cornelius geführt und dann auch mit ihrem Vater, und die beiden machten sich dann wieder mal Gedanken, ob es denn nicht möglich sein konnte, daß Fee und Daniel tatsächlich mal einen Tag ohne jede Aufregung verleben dürften.
Nun mußten sie aber die drei Kleinen trösten, Danny, Felix und Anneka, die nicht begreifen wollten, warum ihre Eltern nicht am Abend zurückkamen.
Daniel und Fee hatten sich auf den Weg zu Oberschwester Mathilde gemacht, und zum Abendessen hatten sie sich mit Tresi und den Brandnerbrüdern verabredet. Zuerst hatten sie den Vorschlag gemacht, sich im Dorfkrug zu treffen, aber Tresi hatte widersprochen. Da hätten die Wände Ohren, hatte sie gemeint, und man solle sich doch besser bei ihnen daheim treffen, denn ihr Vater hätte wohl auch noch manches aus der Vergangenheit zu sagen, was die Fehde zwischen den Stiebenaus, Ronnebergs und Wangens beträfe.
»Das ist nun die Idylle«, sagte Fee gedankenvoll, als sie dem Wiesenhang zuschritten, wo Mathilde wohnte. »Alles sieht so friedlich aus, und da spielt sich dann Gott weiß was ab.«
»Überall, wo Menschen leben, gibt es Gegensätze, Fee«, sagte er sinnend. Dann blieb er stehen und blickte zu dem weinumrankten Haus. »Wir sind am Ziel.«
Schwester Mathilde kam ihnen schon entgegengeeilt. »Wie schön, daß Sie Ihre Frau mitbringen«, sagte sie, und jetzt wirkte sie lange nicht so streng wie im Krankenhaus.
Daniel stellte gleich die Frage, die ihm am meisten am Herzen lag, die Frage nach Nicolas Befinden.
»Das EKG und das EEG sind recht zufriedenstellend«, erwiderte sie, »aber sie ist noch ohne Bewußtsein. Eine Hirnblutung liegt glücklicherweise nicht vor. Sie dürfen versichert sein, daß Dr. Großkopf äußerst gewissenhaft vorgeht, um sich in diesem Fall nicht das geringste nachsagen zu lassen.«
Dr. Norden blickte Mathilde forschend an. »Mußte er sich schon mal nachsagen lassen, daß er etwas versäumt hätte?«
»Nicht so direkt, aber es blieb immer ungeklärt, wie Frau von Stiebenau an die Tabletten kommen konnte, die dann ihren raschen Tod herbeiführten.«
»Sie hat also Selbstmord begangen«, sagte Fee.
»Sie war des langen Leidens müde. Für eine so vitale Frau, wie sie früher gewesen war, muß das ja auch schrecklich gewesen sein, querschnittgelähmt und so hilflos. Ich würde in solcher Situation auch Schluß machen.«
»Und jemand hat ihr zu den Tabletten verholfen«, sagte Daniel nachdenklich.
»Es war niemandem nachzuweisen. Aber dieser Fall ist längst vergessen.«
Als Daniel dann aber von Tönnies schrecklichem Tod sprach, wurde sie schreckensbleich. Sprachlos verharrte sie ein paar Minuten, aber man sah, daß sie krampfhaft überlegte.
»Dann wird wohl doch noch mal alles aufgerührt werden«, sagte sie heiser. »Es wird gut sein, wenn Nicola schnell von hier weggebracht wird. Sie werden dafür sorgen, Herr Doktor?«
»Ich habe es versprochen. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir etwas über die Stiebenaus und Ronnebergs erzählen würden.«
»Wenn der Ronneberg Chefarzt wird, ist meine Zeit vorbei«, sagte sie hart. »Nächsten Monat werde ich sowieso sechzig. Man kann ihm ja nicht nachsagen, daß er ein schlechter Arzt wäre, aber ein Arzt muß auch ein Mensch sein, doch er hat überhaupt kein Gefühl. Man hat ja mal davon geredet, daß er Nicola heiraten würde, aber das habe ich immer für ein Gerücht gehalten. Nicht nur deshalb, weil er fünfzehn Jahre älter ist.«
»Sind die Ronnebergs auch eine alteingesessene Familie?« fragte Fee.
»Nach dem Krieg sind sie gekommen. Pächter ist er vom Baron geworden. Mit einer Cousine von Frau von Stiebenau war er verheiratet, deshalb hat er sich wohl Rechte angemaßt, die ihm nicht zustanden. Das ist meine Meinung. Der Baron hatte keinen Sohn. Sie verstehen?«
Daniel und Fee verstanden, aber Mathilde sagte rasch: »Ich will nichts gesagt haben, aber so manches wird nun doch wieder aufgerührt. Wie der alte Ronneberg den ganzen Besitz an sich gebracht hat, weiß ich nicht, aber mit rechten Dingen ist es bestimmt nicht zugegangen.«
»Und welche Rolle spielt dieser Markus Wangen?«
Mathilde starrte ihn bestürzt an. »Wer will ihn denn hineinzerren?« fragte sie rauh.
»Das weiß ich nicht. So recht will sich niemand über ihn äußern.«
»Er ist über jede Kritik erhaben. Ein ganz feiner Mensch ist er, aber der Ronneberg hat ja auch noch eine Tochter, und die hätte er gar zu gern mit dem reichen Markus verkuppelt.«
Die Glieder einer Kette reihten sich aneinander, aber es fehlten wohl noch eine ganze Anzahl, um sie schließen zu können, und was Mathilde sonst noch sagte, entsprang wohl der Abneigung, die sie gegen die Ronnebergs hegte.
Der Baron sei ein feiner, stiller Mann gewesen, und das Regiment im Haus hätte wohl die schöne Baronin geführt, meinte sie, bis zu dem Tage, als man sie gelähmt ins Krankenhaus gebracht hatte. Leicht hätte man es zwar anfangs nicht mit ihr gehabt, aber mehr und mehr sei sie dann doch immer stiller geworden und ganz ihrer Religion hingegeben. »So, als wolle sie für etwas Buße tun«, sagte Mathilde leise. »Getratscht worden ist hier viel, aber hinter die ganze Wahrheit ist wohl keiner gekommen, und wenn sie jetzt doch noch aufkommen sollte, ist es wohl gut, daß der Baron nicht mehr lebt.«
»Und Nicola?« fragte Fee.
Mathilde zuckte die Schultern. »Sie hatte immer einen starken Willen, und wenn sie am Leben bleibt, wird sie sich durchbeißen.«
»Wissen Sie, wo sie zuletzt lebte?« fragte Fee intuitiv.
»Nein.«
*
»Wir werden schon noch mehr erfahren, Daniel«, meinte Fee, als sie auf dem Wege zu den Portners waren. Diesmal fuhren sie mit dem Wagen, denn der Betrieb und das Wohnhaus lagen ziemlich weit außerhalb, doch dem Haus der Brandners näher als dem Dorf.
Es war ein schmuckes Haus, das schon rein äußerlich einen gesunden Wohlstand ausdrückte. Tresi hatte schon draußen voller Ungeduld auf sie gewartet.
»Jakob und Peppi haben sie mit zur Polizei genommen«, sagte sie aufgeregt.
»Als ob sie, ausgerechnet sie, dem Tönnis und Nicola was antun würden.«
»Sie dürfen nicht gleich so schwarz sehen, Tresi«, sagte Daniel. »Sie wohnen der Unglücksstelle am nächsten, und man wird wohl nach Zeugen Ausschau halten.«
Franz und Hedwig Portner, Tresis Eltern, regten sich nicht auf, aber sie machten einen niedergeschlagenen Eindruck.
Daß Hedwig eine vorzügliche Köchin sein mußte, verrieten schon die Düfte, die durch das Haus zogen, aber niemand von ihnen hatte den rechten Appetit. Dann aber kamen Jakob und Peppi, und sie zeigten sich jetzt redseliger als am Vormittag.
»Es hat sich herausgestellt, daß Tönnies erst eine gute Stunde tot gewesen ist, als wir ihn fanden«, erklärte Jakob, »erst lange nach dem Unfall von der Baroneß ist das passiert, und für die Zeit haben wir ja Zeugen.«
»Wer könnte euch schon anhängen, den alten Tönnies umgebracht zu haben«, sagte Tresi zornig. »Wir hatten ihn gern.«
»Das wissen doch die Beamten nicht«, meinte Jakob begütigend. »Man kann ihnen keinen Vorwurf machen. Sie tappen doch völlig im dunkeln.«
»Die werden sich eh hart tun«, meinte Peppi. »Ich habe jetzt Hunger.«
Nun griffen sie doch alle zu, und es dauerte geraume Zeit, bis wieder ein Gespräch in Gang kam. Daniel ergriff das Wort.
»Sie waren doch ziemlich lange für den Baron tätig, Herr Portner. Würden Sie uns etwas über die Beziehungen zu den Ronnebergs erzählen?«
»Ungern«, erwiderte Franz Portner wortkarg.
»Dr. Norden kannst du doch aber dein Vertrauen schenken, Vater«, sagte Tresi bittend. »Sie wollen Nicola helfen.«
»Dem Dirndl kann doch nicht mehr geholfen werden. Ihr haben sie doch alles genommen«, sagte der Mann grimmig.
»Jeder hat geschwiegen, und was hat es schon genützt«, warf Hedwig Portner ein. »Wir hätten uns auch gesundgestoßen, ist uns nachgesagt worden.«
»Es weiß doch wirklich jeder, daß ich den Betrieb mit deinem Erbe aufgebaut habe, Hetti«, sagte Frank Portner. »Uns kann keiner was nachsagen.«
»Aber Ronneberg scheint einen Anspruch auf das Gut geltendgemacht zu haben, da er mit einer Cousine der Baronin verheiratet war«, warf Fee jetzt ein.
»Das wissen Sie?« staunte Portner.
»Es wurde uns erzählt. Und wir haben auch erfahren, daß Ronneberg seine Tochter mit Markus Wangen verheiraten wollte.«
Jakobs Augen weiteten sich. »Sie sind kaum hier und wissen schon mehr als mancher andere«, murmelte er.
»Und wir könnten Nicola besser helfen, wenn wir noch mehr erfahren würden. Wer weiß, wie lange es dauern wird, bis sie etwas über den Hergang ihres Unfalls erzählen kann. Vielleicht ist sie dem Menschen begegnet, der dann an dem alten Tönnies zum Mörder wurde.«
»Und sie könnte ihn erkannt haben und wollte sich verstecken. Und dabei ist sie dann abgerutscht«, äußerte Tresi ihre Vermutung.
Fee kamen andere Gedanken, doch die äußerte sie nicht. Und dann sagte Jakob: »Ich habe mir alles durch den Kopf gehen lassen. Vor allem, wie ist Nicola hierhergekommen? Eine Bahnverbindung gibt es nicht, der Bus fährt sonntags erst später, also müßte sie mit dem Wagen gekommen sein, oder jemand hat sie mitgenommen.«
»Sie fährt doch nicht Anhalter«, warf Tresi ein, »nein, niemals. Aber ihre Kleidung läßt tatsächlich darauf schließen, daß sie mit dem Wagen gefahren ist. Und vielleicht hatte sie feste Schuhe einfach vergessen.«
»Wissen Sie, wo Nicola wohnt?« stellte Daniel nun auch hier diese Frage, die Mathilde nicht beantwortet hatte oder tatsächlich nicht beantworten konnte.
»Zuletzt war sie in der Schweiz«, sagte Tresi, »wenigstens hatte sie mir vor acht Wochen mal von dort geschrieben.« Sie sprang auf. »Ja, da hat sie doch geschrieben, daß sie zum
fünfundsiebzigsten Geburtstag von Tönnies kommen würde«, rief sie aus.
»Und sie wäre nicht ohne Geschenk zu ihm gegangen«, warf Hedwig Portner ein.
Peppi hob den Kopf. »Nach ihrer Tasche haben die Kriminaler auch gefragt, grad’ so, als ob wir die gestohlen hätten«, stieß er unwillig hervor.
Viele Rätsel würde es wohl zu lösen geben, aber Daniel gab dann Franz Portner einen Wink, und die beiden Männer verließen den Raum. Die anderen blickten ihnen nach, sagten aber nichts.
»Sie haben mich ein paarmal so eigenartig angeschaut, Herr Portner«, sagte Daniel draußen leise. »Möchten Sie mir etwas sagen?«
»Sie sind bestimmt ein guter Arzt. Sie können sogar Gedanken lesen. Ich möchte das nicht in großer Runde erörtern. Meine Frau braucht nicht alles zu wissen, und die Brandner-Buben kochen leicht über, wenn nur der Name Ronneberg fällt. Wenn Sie der Nicola helfen wollen, Herr Doktor, dann erzähle ich Ihnen mehr.«
»Ich will ihr sehr gern helfen und hoffe nur, daß sie schon morgen transportfähig sein wird«, sagte Daniel. »Es hängt viel von dieser Nacht ab.«
»Wenn das Dirndl auch noch sterben würde, dann hätte der alte Ronneberg tatsächlich alles erreicht. Dann würde er auch noch die Eingabe machen, daß sein Sohn sich Ronneberg von Stiebenau nennen dürfte. Das hat er ja schon immer gewollt, so oder so.«
»Erzählen Sie mir davon«, bat Daniel.
»Ja, es ist eine lange Geschicht’. Damals, als die Ronnebergs kamen, war der Friedhelm zwei Jahre. Gleich nach dem Krieg war es, aber ich war damals noch ein Bub. Ich bin erst zehn Jahre später als Verwalter zum Baron gekommen, als der Ronneberg das Gut Friedenau übernommen hat. Stiebenau und Friedenau gehörten ja eigentlich zusammen, aber der Bruder vom Baron ist im Krieg gefallen, das war der erste harte Schlag, der ihn getroffen hat. Sie hatten sich so gut verstanden. Ich kann ja nur sagen, was ich so nebenbei erfahren hab’ und was mir der Baron selbst erzählt hat, wenn er deprimiert war. Na ja, und so manches ist mir halt nicht entgangen. Auf den Kopf gefallen bin ich ja nicht.«
Das war er gewiß nicht. Er war ein tüchtiger, sympathischer Mann mit hellwachen Augen. Jetzt legte sich seine Stirn in tiefe Falten. »Ja, es war so«, begann er wieder mit einem tiefen Seufzer, »der Baron war nicht verheiratet, als die Ronnebergs kamen. Er hat sich da viel mit dem Friedhelm befaßt.«
»Sie meinen den, der jetzt Arzt ist?« fragte Daniel.
»Ja, den mein ich. Der Name paßt gewiß nicht zu ihm, denn friedlich war der nie. Er war vierzehn, als die Cousine von Frau Ronneberg zu Besuch kam. Die war vierundzwanzig und sehr fesch, und der Baron hat sich in sie verliebt. Er hatte schon die Vierzig hinter sich, aber er war ja eine gute Partie. Es wurde auch bald geheiratet. Da schienen sich alle recht einig zu sein. Und ein Jahr drauf wurde Nicola geboren. Es mag schon sein, daß der Baron enttäuscht war, daß es ein Mädchen war. Er hat mich dann auch arg beneidet, daß wir zu unserer Tresi noch einen Sohn bekommen haben. Ein prächtiger Bub. Er studiert in München. Ingenieur will er werden. Die Baronin konnte wohl keine Kinder mehr bekommen. Vielleicht hätte sie auch das Reiten lassen sollen, aber mir steht es nicht zu, Kritik zu üben. Aber sie hat sich dann auch mehr um den Friedhelm gekümmert als um Nicola. Und als dann der Wangen die Jagd gepachtet hat, hat sie sich auch um ihn ein bißchen zu oft gekümmert. Das hat dem Baron nicht gepaßt, möchte ich mit Verlaub sagen.«
»Sie sprechen von Markus Wangen?« fragte Daniel.
Augenblicklich war Franz Portner ein bißchen aus dem Konzept gebracht. »Nicht doch, von seinem Vater red’ i«, sagte er rasch, »der Markus ist ja jetzt noch keine dreißig. Der ist überhaupt erst hierhergekommen, als er schon erwachsen war. Ist in England erzogen worden, so ganz vornehm, und ich muß sagen, daß er das auch ist. Ein Gentleman, wie man so sagt. Ist ja alles ein bißchen verwirrend, Herr Doktor, wenn man es nicht miterlebt hat. Aber man macht sich halt Gedanken, wenn ein Mann, der mit Leib und Seel’ Landwirt war, wie der Baron, plötzlich so nachläßt. Es hätte nicht abwärts gehen müssen. »Ich habe mir die erdenkliche Mühe gegeben, aber wenn ich mal ein ernstes Wort mit ihm gesprochen hab’, dann hat er nur den Kopf geschüttelt und gesagt, daß eh’ alles sinnlos sei, und er hätte ja keinen Sohn.«
Und sie redeten noch lange. Es war sehr spät, als Daniel und Fee aufbrachen, um im Dorfkrug, wo sie ein Zimmer genommen hatten, die Nacht zu verbringen. Aber Schlaf fanden sie ebensowenig wie die, die im Hause der Portners zurückblieben. Jakob und Peppi sollten dort schlafen, so hatte es Hedwig vorgeschlagen, und sie nahmen es gern an.
*
»Du hast zwei Stunden mit dem Portner gesprochen, weißt du das, Daniel?« fragte Fee, als sie sich müde ausgestreckt hatte.
»Es war sehr interessant«, erwiderte Daniel. »Und du bist wieder mal neugierig.«
»Allerdings«, gab sie offen zu. »Du hast ihm hoffentlich nicht ein heiliges Ehrenwort gegeben.«
»Er vertraut mir auch so, Feelein. Der Mann denkt gescheit, aber er blickt auch nicht durch, und ich wage zu bezweifeln, daß wir die ganze Geschichte überhaupt einmal erfahren. Jedenfalls sind die Stiebenaus und die Ronnebergs tatsächlich verwandt. Und es scheint auch so, daß der Friedhelm Ronneberg hinter der Baronin her war und nicht hinter Nicola. Er ist zwar zehn Jahre jünger, aber sie muß ein Vollblutweib gewesen sein. Mit dem Vater von Markus Wangen soll sie auch was gehabt haben. Portner hat sich sehr diskret ausgedrückt, nur ein paar Andeutungen gemacht, aber ich kann ganz gut kombinieren. Den alten Wangen hat der Herzschlag getroffen, als die Baronin mal allein bei ihm in dem Jagdhaus gewesen war. Ganz zufällig, hat sie damals gesagt. Sie sei vorbeigeritten, und da hätte Wangen halb ohnmächtig vor dem Haus gesessen. Sie hätte ihm hineingeholfen und wäre dann heimgeritten, um den Arzt zu rufen. Das hat Portner mitgekriegt, weil er grad mit dem Baron eine Besprechung hatte. Nun, als der Arzt kam, war Wangen tot, und der junge Ronneberg war bei ihm, auch rein zufällig. Er hatte gerade seinen Doktor gemacht. Markus Wangen war da gerade zwanzig und Nicola war fünfzehn.«
»Wie alt ist sie eigentlich jetzt?« fragte Fee geistesabwesend.
»Dreiundzwanzig.«
»Dann ist Markus Wangen achtundzwanzig und schon Industrieller.«
»Er mußte früh ran nach dem Tode des Vaters. Jedenfalls scheint er sich mit Nicola angefreundet zu haben. Zwischen ihrer Mutter und ihr muß es zu einem Streit gekommen sein, aber sie war sowieso nur in den Ferien zu Hause und sonst in einem Internat in der Schweiz. Kurz bevor sie von dort zurückkam, hatte ihre Mutter den schweren Reitunfall, der die Querschnittlähmung zur Folge hatte. Sie hatte den Satan geritten, den Nicola von Markus Wangen zum achtzehnten Geburtstag geschenkt bekommen hatte. Nein, da bringe ich jetzt etwas durcheinander. Nicola hatte Satan zuerst zum fünfzehnten Geburtstag von ihrem Vater bekommen.«
»Aber Tresi hat auch gesagt, daß Nicola ihn von Wangen bekommen hat.«
»Der Baron hat ihn nach dem Unfall seiner Frau an Markus verkauft, aber der schenkte ihn Nicola, weil sie so an dem Pferd hing. Und das war, als sie achtzehn war und die Baronin das Zeitliche gesegnet hatte.«
»Merkwürdig, daß Nicola das Geschenk annahm, da das Pferd ja Unglück über ihre Mutter gebracht hatte.«
»Sie hat ihre Mutter nicht gemocht, Fee. Ja, Portner sagte, daß es fast Haß war, aber Nicola hätte über ihre Mutter wohl mehr gewußt als jeder andere. Die Baronin hätte den Ronnebergs nur in die Tasche gewirtschaftet und den Baron wohl nur aus kalter Berechnung geheiratet.«
Ein langes Schweigen herrschte zwischen ihnen, dann sagte Fee: »Jetzt sieht doch alles ganz anders aus. Ich frage mich, warum der Baron die Ronnebergs überhaupt aufgenommen hat, wenn er damals noch gar keine verwandschaftlichen Beziehungen zu ihnen hatte?«
»Aus Sentimentalität möchte ich sagen, nach dem, was ich gehört habe. Ronneberg gab damals an, mit Arved von Stiebenau befreundet gewesen zu sein. Das war der Bruder von Dietrich von Stiebenau. Die Ronnebergs hatten angeblich ein Gut in Pommern, und dort war Arved einquartiert. Sie brachten auch einige Sachen aus Arveds persönlichem Besitz mit.«
»Und dann haben sie sich hier eingenistet und schließlich auch noch die schöne junge Cousine herbeizitiert, um sich alles unter den Nagel zu reißen. Eine feine Sippschaft«, sagte Fee empört.
»Vielleicht sieht es Portner auch einseitig, Liebes. Er war dem Baron treu ergeben. Jetzt schlafen wir erst mal. Morgen sehen wir weiter.«
»Morgen schauen wir uns das Gut an und das Jagdhaus von Wangen«, murmelte sie schläfrig. »Jetzt will ich es genau wissen.«
»Ich fürchte, es wird noch lange dauern, bis wir alles erfahren, wenn es überhaupt möglich ist«, sagte Daniel. Dann versank er für lange Zeit noch in Gedanken, während Fee schon eingeschlafen war.
*
Auch Jakob und Tresi hatten noch sehr lange zusammengesessen, während ihre Eltern und Peppi zu Bett gegangen waren. Die Eltern hatten nichts dagegen, denn Tresi und Jakob waren einander versprochen. Das galt hier noch, obwohl sie beide moderne junge Menschen mit eigenen Vorstellungen waren.
»Es wird herauskommen, warum du Streit mit Ronneberg hattest«, sagte Tresi mit schwerer Stimme.
»Soll es doch. Vielleicht kriegen sie ihn jetzt auch mal am Kanthaken«, sagte er heiser. »Über vieles habe ich mir auch schon meine Gedanken gemacht, Tresi, und ich glaube, der Dr. Norden ist ein ganz gescheiter Mann, der da nicht locker läßt.«
»Er ist Arzt«, sagte Tresi leise.
»Aber einer, der tiefer blickt, der nach Ursachen forscht. Der sich nicht mit den augenblicklichen Tatsachen zufriedengibt.«
»Vater hat lange mit ihm geredet, das ist sonst nicht seine Art.«
»Es ist gut, wenn man mit einem klugen Mann reden kann, bevor man von der Polizei ausgequetscht wird. Vater wird auch nicht verschont bleiben.«
»Komisch, daß Ronneberg jetzt gerade Urlaub hat«, sagte Tresi tiefsinnig.
»Es wird schon seine Gründe haben, und wenn Nicola ihren Wagen irgendwo abgestellt hat, wo er noch nicht entdeckt wurde, könnte das auch bestimmte Gründe haben.«
»Bastian hat sie immer mitgebracht, wenn sie Tönnies besuchte«, sagte Tresi. »Wer hat eigentlich Wastl?« fragte sie dann überstürzt. »Guter Gott, an ihn habe ich gar nicht mehr gedacht.«
»Die Beamten haben ihn mitgenommen. Sie meinen wohl, daß er sie auf eine Spur bringen könnte.«
»Ja, das könnte er wohl«, sagte Tresi, »wenn überhaupt einer, dann er. Und Bastian hätte jeden zerfetzt, der Nicola angreifen wollte. Er war immer aggressiver als Wastl.« Sie wischte schnell ein paar Tränen von den Wangen, die jetzt aus ihren müden Augen rollten. »Wenn ich doch mit Nicola sprechen könnte, Jakob. Hätte sie mir doch nur gesagt, was gewesen ist, als sie wegging. Aber so verschlossen war sie nie. Ich meine, sie hat überhaupt niemandem mehr getraut, auch uns nicht.«
»Ich rufe morgen Markus an«, sagte Jakob. »Ich tue es. Und jetzt müssen wir schlafen, Tresi, es wird bestimmt wieder ein anstrengender Tag.«
*
So spät sie auch zum Schlafen gekommen waren, so früh waren sie auch schon wieder auf den Beinen, und Tresi war in geradezu fieberhafter Spannung.
»Ich weiß, wo Nicola ihren Wagen abgestellt haben könnte«, stieß sie erregt hervor. »Grad beim Erwachen ist es mir eingefallen.«
»Wo meinst du?«
»Am Stellplatz zum Jagdhaus.«
Jakobs Augenbrauen schoben sich zusammen. »Ich rufe Markus an«, sagte er.
»Es ist noch nicht mal sieben Uhr«, sagte Tresi.
»Er wird es nicht übelnehmen, nach allem, was passiert ist.«
»Aber Nicola hat mit ihm Schluß gemacht«, wandte Tresi ein.
»Er aber nicht mit ihr, Tresi. Ich weiß, wie nahe ihm alles gegangen ist. Ich habe ihm viel zu verdanken, und er ist mein Freund. Er macht keine Klassenunterschiede wie Ronneberg.«
Ein bißchen skeptisch war Tresi schon, aber sie sagte nichts dazu. Und als Jakob die Telefonnummer wählte, hielt sie den Atem an.
»Tut mir leid, daß ich dich so früh störe, Markus, aber hier ist allerhand passiert«, sagte Jakob. Dann sprach er erst von Nicola, aber mehr konnte er gar nicht sagen. Plötzlich hielt er das Telefon in der Hand und starrte es an.
»Was ist denn?« fragte Tresi.
»Er ist schon unterwegs, hat er gesagt, und dann hat er aufgelegt.«
»Wo hast du ihn erreicht?« fragte Tresi.
»In München. Er könnte schon in zwei Stunden hier sein, wenn er gleich losfährt.«
»Dann schauen wir jetzt mal, ob wir Nicolas Wagen finden«, sagte Tresi.
»Wie du willst, aber bis zum Stellplatz ist ein weiter Weg.«
»Wir nehmen Vaters Wagen. Er wird nichts dagegen haben.«
»Nein, ich habe nichts dagegen«, ertönte eine müde Stimme. »Ihr braucht wohl gar keinen Schlaf.«
»Du anscheinend auch nicht, Vater«, sagte Tresi.
»Mir geht vieles im Kopf herum.«
»Uns auch«, sagte Tresi.
»Ich denke jetzt an den Koffer, den ich für den Baron nach München bringen mußte zu der Bank. Niemandem sollte ich etwas davon sagen. Und jetzt ist mir der Gedanke gekommen, daß er vielleicht Nicola nichts davon gesagt haben könnte, da er doch schon zwei Tage später tot war.«
Tresi starrte ihn an. »Du hast mit Nicola nicht darüber gesprochen?« fragte sie atemlos.
»Wann denn schon? Allein habe ich sie nicht getroffen.« Er stöhnte in sich hinein. »Mit niemandem habe ich darüber gesprochen, aber jetzt ist alles wieder so frisch.«
»Bitten wir den Herrgott, daß Nicola am Leben bleibt«, flüsterte Tresi, und das tat sie dann, als sie mit Jakob ein Stück gefahren war. »Halt bei der Kapelle, Jakob«, bat sie. »Ich weiß, daß du jetzt auch mit dem Herrgott auf Kriegsfuß stehst, aber ich glaube an seine Gerechtigkeit.« Und sie betete dort für Nicolas Genesung.
An einem anderen Bett saß Schwester Mathilde und betete auch. Gegen Morgen hatte es so ausgeschaut, als wolle Nicolas Herz doch müde werden, aber nach der Infusion schlug es wieder kräftiger. Mathilde wich nicht mehr von dem Bett, erst recht nicht dann, als Schwester Tina sagte, daß sie sie ablösen könne.
Sie hatte etwas gegen Tina, ohne sagen zu können, worauf ihre Abneigung gegen dieses hübsche Mädchen beruhte, das sich eigentlich allgemeiner Beliebtheit erfreute und außerdem auch im Beruf sehr tüchtig war.
Inzwischen waren Jakob und Tresi beim Stellplatz unterhalb des Wangenschen Jagdhauses angelangt, und sie sahen dort einen mattgrünen Wagen stehen. Sie sahen noch mehr, denn Bastian, der Bruder von Tönnies’ Wastl, scharrte sich jaulend die Pfoten an dem Fenster wund, das nur einen Spalt breit geöffnet war. Als sie rasch ausstiegen und auf den Wagen zugingen, begann der Hund heiser zu bellen. Während Jakob sich mit aller Kraft mühte, das Fenster herabzudrücken, stieß Bastian klagende Laute aus.
Tresi sah auf dem Rücksitz ein großes Paket, dessen Papier zerfetzt war. Anscheinend hatte der aufgeregte Hund dies angerichtet.
So viele Fragen jetzt auch offenblieben, zuerst wollten sie den Hund befreien, und endlich konnte Jakob hineinfassen und die Scheibe herunterkurbeln. Doch da sprang Bastian schon mit einem Riesensatz heraus und raste aufheulend davon. »Basti!« rief Tresi, doch der Hund hörte nicht.
»Es scheint, als wolle er zum Gut laufen«, sagte Jakob. »Die Richtung schlägt er jedenfalls ein.«
»Dann nichts wie hin, bevor er auch abgeknallt wird«, sagte Tresi.
Jakob starrte sie entsetzt an. »Du glaubst doch nicht, daß einer von den Ronnebergs Tönnies...« Er kam nicht weiter.
»Ich denke an Markus’ Hund«, fiel sie ihm ins Wort, »der angeblich gewildert haben soll.«
Sie saßen schon wieder im Wagen, und Jakob lenkte ihn auf die Straße, die zum Gut führte. Und da sahen sie Bastian, der wie ein Pfeil über die Wiese flog. Aber auch hier sahen sie noch mehr. Zwei Männer standen da, und an ihrer Seite war ein anderer blonder Hund. Wastl! Und auf den raste Bastian zu, und sie jaulten im Duett.
*
»Was sind das nur für Hunde?« fragte Stella Ronneberg gereizt. »Meine Judy wird schon ganz nervös.«
Judy war ein silbergrauer Zwergpudel, der jetzt auf den Hinterpfoten wie aufgezogen tanzte.
Der Frühstückstisch war zwar schon gedeckt, aber noch niemand hatte sich daran niedergelassen. Friedrich Ronneberg stand mit verbissener Miene am Fenster und drehte seiner Frau den Rücken zu.
»Die Polizei wird bald hier sein«, sagte er tonlos.
»Die Polizei? Wieso?« fragte Stella konsterniert.
»Tönnies ist gestern abend erschossen worden.«
»Was haben wir damit zu tun?« fragte sie schrill. »Wird ein Wilderer gewesen sein.«
»Und Nicola haben sie am Wasserfall gefunden«, fuhr er fort.
»Gefunden?« fragte sie mit einem törichten Ausdruck, der ihr faltiges Puppengesicht noch dümmlicher erscheinen ließ.
»Bewußtlos und schwerverletzt. Sie scheint den Weg verfehlt zu haben. Ich weiß noch nichts Genaues.«
Ihre Augen verengten sich. »Ich war den ganzen Tag mit Marina in Lindau«, sagte sie, »also brauche ich mich nicht ausfragen zu lassen. War Nicola hier?« fragte sie dann lauernd.
»Nein«, erwiderte er abweisend.
»Was soll sie auch noch hier!« sagte Stella Ronneberg giftig. » Sie hat ja gerade so getan, als hätten wir sie betrogen. Dabei hat sie doch eine beträchtliche Summe bekommen. Beim Wasserfall, sagtest du?« fuhr sie dann ohne Luft zu holen fort. »Wollte sie zu Tönnies auf die Alm?«
»Ich habe keine Ahnung, Stella. Es ist höchst unangenehm. Mach mich jetzt nicht auch noch nervös. Es würde mir nicht gefallen, wenn alte Geschichten ausgegraben würden.«
»Was könnte man uns vorwerfen? Du hast eben fleißig gearbeitet, Diet-rich hat sich um nichts gekümmert.«
»Manch einer könnte jetzt etwas anderes sagen«, murmelte er.
»Was denn schon«, sagte sie schrill. »Daß es Miriam mit der Treue nicht genaugenommen hat, ist doch nicht unsere Schuld.«
»Ich habe ein ungutes Gefühl«, sagte er heiser. »Wohin ist Friedhelm gefahren?«
»Er wird sich ein paar Tage in München amüsieren, nehme ich an«, erwiderte sie. »Zu verdenken ist es ihm ja nicht, hier langweilt man sich doch zu Tode. Für Marina müssen wir jetzt mal eine Heiratsanzeige aufgeben, sonst bekommt sie nie einen Mann.«
»Ich habe wahrhaft andere Sorgen«, brummte er, und dann kam das Hundebellen näher, und er zuckte zusammen, als er zum Fenster hinausblickte.
»Zwei Labradore«, sagte er tonlos.
Da zuckte auch seine Frau zusammen und sie lief rasch in ihr Zimmer zurück.
*
»Beide Hunde zog es hierher«, sagte der Inspektor Heckel zu seinem Kollegen und auch zu Tresi und Jakob.
»Sie sind hier geboren und aufgewachsen«, sagte Jakob nachdenklich. »Sie sind aus einem Wurf und fünf Jahre.«
Wo sie Bastian gefunden hatten, hatte er schon erklärt, und als sie daraufhin mißtrauisch gemustert worden waren, hatte Tresi erklärt, wie sie auf den Gedanken gekommen war, nach Nicolas Wagen zu suchen.
Darüber müsse man sich noch unterhalten, wurde ihr erwidert, aber dann wurden sie weggeschickt. Nun aber schien Bastian sich entschlossen zu haben, lieber mit ihnen zu gehen. Dagegen hatten die Beamten auch nichts einzuwenden, denn Bastian bellte sie grimmig an und hätte sich nicht an die Leine legen lassen.
Jetzt trabte er aber neben Tresi und Jakob her und sprang auch nach einer kurzen Aufforderung in den Wagen.
»Wir müssen zu unserem Haus fahren«, sagte Jakob. »Markus wird bestimmt dorthin kommen. Er hat ja überhaupt nicht gefragt, von wo aus ich anrufe.«
»Wir müssen den Eltern Bescheid sagen und Dr. Norden auch«, sagte Tresi.
»Beim Dorfkrug fahren wir vorbei, und die Eltern rufen wir an«, erklärte Jakob.
Daniel und Fee hatten schon gefrühstückt. Sie waren zu neuen Taten bereit. Daniel wollte zum Krankenhaus fahren, und Fee entschloß sich, mit Tresi und Jakob zu fahren. Sie war jetzt sehr gespannt, Markus Wangen kennenzulernen.
Von Bastian wurde sie beschnuppert und akzeptiert. »Dich würde ich sofort behalten«, sagte sie. »Und unsere Kinder würden sich freuen.«
»Er gehört Nicola, sie hängt sehr an ihm«, sagte Tresi. »Wieviel Kinder haben Sie, Frau Doktor?«
»Drei.«
Nun waren sie für’s erste doch etwas abgelenkt. Sie sprachen über die Kinder und die Insel der Hoffnung, während sie auf Markus Wangen warteten.
Daniel sprach mittlerweise mit Dr. Großkopf, dem tausend Sorgen auf dem Gesicht geschrieben waren.
Er hatte Daniel gesagt, daß Nicola eine seltsame Wunde an der Hüfte hätte, die kaum vom Sturz herrühren konnte, sondern möglicherweise von einem Streifschuß.
»Und dadurch könnte sie gestürzt sein«, sagte Daniel. »Aber dann hätte man auch Blutspuren im Gras gefunden.«
»Darüber habe ich noch nicht nachgedacht«, sagte Dr. Großkopf. »Sie hätten einen guten Kriminalisten abgegeben.«
»Das wurde mir schon mehrmals gesagt!« Daniel lächelte.
»Ich hatte noch nie mit so etwas zu tun«, sagte Dr. Großkopf fast entschuldigend.
»In der Großstadt passiert mehr«, erwiderte Daniel. »War eigentlich Dr. Ronneberg schon hier beschäftigt, als Frau von Stiebenau starb?«
Großkopf wurde fahl. »Ja, im ersten Jahr«, erwiderte er tonlos. »Er hat sie sehr zuverlässig betreut.«
»Sie sind gut mit ihm ausgekommen?«
Dr. Großkopf wandte sich ab. »Wie man eben mit einem sehr ehrgeizigen jungen Kollegen auskommt. Ich werde abtreten, und er wird Chefarzt werden. Aber das ist der Lauf der Zeit. Ich hege keine Vorurteile. Jeder Arzt hat wirklich seine eigene Methode.«
Man konnte das auslegen wie man wollte. Große Sympathie schien Dr. Großkopf für Ronneberg nicht zu empfinden.
»Sind Sie einverstanden, daß wir Fräulein von Stiebenau heute nachmittag nach München bringen lassen?« fragte er.
»Wenn sie auf der Fahrt bestens betreut wird, ja.«
»Ich werde mitfahren«, sagte Daniel ruhig.
Dr. Großkopf rang nach Worten. »Sie werden sich wundern, warum ich so interessiert bin, die Patientin so schnell von hier wegzubringen«, sagte er mit großer Überwindung, »aber mir ist zufällig bekannt, daß Dr. Ronneberg die junge Dame heiraten wollte und eine beträchtliche Abfuhr erlitt. Es ist zwar einige Jahr her, aber ich glaube nicht, daß Fräulein von Stiebenau ihre Meinung geändert hat. Sie ist ein sehr charaktervolles und energisches Mädchen.«
»Es besteht da wohl auch ein beträchtlicher Altersunterschied«, sagte Daniel vorsichtig.
»Ja, gewiß, Ronneberg ist sieben-unddreißig und eigentlich der Typ des ewigen Junggesellen. Über Erfolg bei Frauen kann er sich allerdings nicht beklagen.«
Daniel besuchte dann noch Nicola, aber sie lag noch in tiefster Bewußtlosigkeit und immer noch betreut und bewacht von Schwester Mathilde, mit der Dr. Norden nur einen verständnis-innigen Blick tauschte.
Dann verabredete er mit Dr. Großkopf, den Ambulanzwagen für drei Uhr nachmittags bereitzuhalten.
*
Als Markus Wangen vor dem Brandner-Haus aus dem Wagen stieg, war Fee Norden überrascht. Markus Wangen sah eher aus wie ein sensibler Philosoph, sie hatte sich eher so einen Managertyp vorgestellt.
Aber bei der Begrüßung konnte sie feststellen, daß sein schmales Gesicht auch Energie verriet. Er war groß und schlank, hatte dunkles Haar und dunkle Augen und trug eine dunkelumränderte Brille. Aber es war auch gleich zu merken, daß er äußerst erregt war, wenngleich er eine beherrschte Miene zeigte.
»Ich will alles genau wissen, Jakob«, sagte er.
»Ich möchte dich erst mit Frau Dr. Norden bekannt machen«, erklärte Jakob höflich. »Sie und ihr Mann haben Nicola gefunden.«
»Es war reiner Zufall«, sagte Fee leicht irritiert, als die dunklen Augen sie durchdringend musterten.
»Dann müssen wir wohl diesem Zufall dankbar sein«, sagte Markus Wangen mit erstickter Stimme. »Wo ist Nicola?«
»Im Krankenhaus«, sagte Tresi.
»Hier, wo Ronneberg ist?« Markus schrie es fast.
»Ronneberg hat Urlaub«, sagte Jakob rasch. »Und Nicola soll möglichst heute noch nach München gebracht werden.«
»Wohin?« fragte Markus erregt.
»In die Behnisch-Klinik. Wir sind mit Dr. Behnisch befreundet. Dort kann sie bestens versorgt werden.«
Bastian, der Markus aufheulend begrüßt hatte, lag jetzt zu dessen Füßen, fast bewegungslos.
»Ich will sie sehen, sofort«, sagte Markus.
»Mein Mann ist jetzt im Krankenhaus«, erklärte Fee. »Sie können nicht viel ausrichten, Herr Wangen. Fräulein von Stiebenau ist noch nicht bei Bewußtsein.« Sie schöpfte Atem. »Waren Sie hier mit ihr verabredet?« fragte sie überstürzt.
»Ich? Nein. Wie kommen Sie darauf?«
»Weil dein Wagen auf den Abstellplatz von uns gefunden wurde, Markus«, erwiderte Jakob. »Es war nur eine Vermutung von uns, daß ihr euch hier treffen wolltet. Wir überlegten alles mögliche mit Frau Dr. Norden.«
»Ihr wißt, daß ich das Jagdhaus nicht mehr benutze«, sagte Markus, aber man sah, wie seine Gedanken arbeiteten. »Ich habe Nicola schon lange nicht mehr gesehen, leider, muß ich sagen, aber ich wußte auch gar nicht, wo sie sich aufgehalten hat. Ich bitte um Entschuldigung«, wandte er sich an Fee, »aber ich kann augenblicklich keinen klaren Gedanken fassen.« Dann beugte er sich zu dem Hund herab, streichelte ihn. »Und du, Basti, kannst mir wohl nicht sagen, was dein Frauchen hier wollte.«
»Anscheinend wollte sie Tönnies zum Geburtstag gratulieren, Markus«, sagte Jakob, »zu seinem fünfundsiebzigsten. Aber er wurde an diesem Tag erschossen.«
Markus nahm seine Brille ab. »Das ist Wahnsinn, das ist doch blanker Wahnsinn, dieser gute alte Mann«, flüsterte er erschüttert. »Ist dieses Stück Erde denn verflucht?«
Und dann herrschte ein langes, er-drückendes Schweigen, bis Daniel Norden kam.
Auch Daniel war sichtlich überrascht, als ihm Markus vorgestellt wurde. Dieser überschüttete ihn mit einer Flut von Fragen, die aber nur Nicola betrafen.
Daniel sagte ihm, daß Nicola gegen drei Uhr nach München gebracht würde. Markus blickte auf seine Armbanduhr. »Ich werde zur Stelle sein, aber bis dahin kann ich noch einiges erledigen«, sagte er rasch.
»Wohin willst du, Markus?« fragte Jakob.
»Zum Jagdhaus«, erwiderte Markus.
»Dann werde ich dich begleiten.«
Daniel und Fee gewannen den Eindruck, daß diese beiden ungleichen Männer tatsächlich Freunde waren.
»Ich finde es auch besser, wenn du nicht allein gehst«, warf Tresi ein.
»Wir wollten uns das Jagdhaus und das Gut auch mal anschauen«, ließ sich Fee vernehmen.
»Gut, dann gehen wir doch alle. Wir können ja mit dem Wagen bis dicht heran fahren. Dann ist es nicht mehr weit«, erklärte Markus. »Ich hatte Tönnies einen Schlüssel dagelassen, damit er ab und zu mal nach dem Rechten schaut...« Abrupt versank er dann in Schweigen, als hätte er eine Ahnung, eine böse Ahnung, und diese sollte sich dann bestätigen, als sie das Jagdhaus erreicht hatten. Es war ein ziemlich großer Bau, aus früheren Zeiten stammend, Markus bemerkte auch beiläufig, daß es früher einem Fürsten gehört hätte.
Die Tür war nicht verschlossen, aber der Schlüssel steckte nicht. In den Räumen herrschte ein wildes Durcheinander, als hätte jemand eilends etwas gesucht.
Betroffen starrte Markus dieses Chaos an. Immer wieder schüttelte er den Kopf.
»Was meinen Sie wohl, was man hier gesucht haben könnte?« fragte Daniel.
»Ich habe wirklich keine Ahnung«, erwiderte Markus. »Wertvolle Dinge gibt es hier nicht. Und was da herumsteht, hätte man auch nehmen können, ohne ein solches Chaos zu verursachen. Mir liegt an dem Haus nichts, aber den Ronnebergs wollte ich es nicht überlassen, und Jakob will es nicht haben.«
»Es hat alles seine Gründe«, sagte Jakob rauh. »Dr. Norden weiß schon eine ganze Menge, Markus.«
Dessen Miene war jetzt ganz finster. »Sollte der gute Tönnies getötet worden sein, um an den Schlüssel zu kommen? Um einen einfachen Einbruch handelt es sich doch auch nicht. Man hätte auch ein Fenster einschlagen können. Wer hörte hier schon etwas! Aber Nicola ist wichtiger. Ich muß herausfinden, was da passiert ist.«
»Das werden wir wohl erst erfahren, wenn Fräulein von Stiebenau bei Bewußtsein ist«, sagte Daniel.
Jakob stand in Gedanken versunken. Wie logisch er zu denken vermochte, verriet er jetzt.
»Nehmen wir einmal an, Nicola war aus irgendwelchen Gründen hierher gegangen und dann von hier aus zur Alm, das würde erklären, daß sie nicht bei uns vorbeigekommen ist. Nur, warum hat sie Bastian nicht mitgenommen?«
»Und warum hat sie das Geschenk für Tönnies im Wagen gelassen«, sagte Tresi.
Fee war durch die Räume gegangen, und dann kam sie plötzlich mit einer hellbraunen Lederjacke zurück.
»Gehört die Ihnen, Herr Wangen?« fragte sie.
»Ja«, erwiderte er achtlos. »Einige Sachen von mir sind noch hier.«
»Dann werden Sie für den gestrigen Tag wohl ein hieb- und stichfestes Alibi brauchen«, sagte Fee leise. Alle starrten sie betroffen an. »Da fehlt nämlich ein Knopf«, fuhr sie stockend fort, »und einen solchen Knopf hat man in der Hand des toten Tönnies gefunden mit einem Stückchen Leder daran, das hier fehlt.«
Ganz beklemmendes Schweigen herrschte. Markus blickte unentwegt auf die Jacke. »Da hat man hier nichts gesucht, sondern etwas hergebracht«, sagte er heiser, »und die Unordnung nur zur Irreführung gemacht. Nun, ich habe ein Alibi, das durch nichts zu erschüttern ist. Ich war den ganzen Tag mit schwedischen Geschäftsfreunden beisammen.« Er fuhr sich mit der Hand durch das dichte Haar. »Zum Teufel, was wird hier gespielt!«
»Wenn wir das nur wüßten«, sagte Tresi leise. »Es sieht doch jetzt fast so aus, als wäre es bei Nicola auch kein Unfall gewesen.«
»Ja, es sieht so aus«, sagte Daniel. »Es ist möglich, daß auch auf sie geschossen wurde. Die Wunde wird noch genauer untersucht werden müssen. Sie haben hier noch Waffen, Herr Wangen?«
»Sicher sind noch welche da. Ich habe sie nie benutzt. Ich bin kein Jäger und verstehe nicht mit Waffen umzugehen. Hier bleibt alles so, wie es ist, das soll die Polizei untersuchen. Ich fahre jetzt zum Krankenhaus und werde nicht von Nicolas Seite weichen, bis sie in Sicherheit ist.«
»Und du fährst zur Insel und holst die Kinder ab, Fee«, sagte Daniel zu seiner Frau. »Wir sehen uns heute abend zu Hause. Es ist mir doch ein bißchen zu riskant, wenn hier so ein schießwütiger Irrer herumläuft.«
»Sie meinen, daß es sich um einen Irren handelt?« fragte Jakob hastig.
»Das habe ich eigentlich nur so hingesagt, aber gibt es hier jemanden, der nicht zurechnungsfähig ist?«
»So hart kann man das nicht sagen, aber der Martl ist nicht ganz richtig im Kopf«, sagte Jakob.
»Wer ist das?« fragte Daniel.
»Er ist Knecht auf dem Gut, macht alle Drecksarbeiten. Ist froh, wenn er zu essen bekommt und ein Dach über dem Kopf hat.«
»Er hat meinen Hund erschossen«, sagte Markus bitter. »Angeblich hat Alf gewildert, aber es wird wohl eher so sein, daß der Martl gewildert hat.«
»Sei nicht ungerecht, Markus«, rief Tresi aus, »dazu fehlt ihm der Verstand.«
»Aber jähzornig ist er, wenn ihn einer angreift oder dumm anredet«, warf Jakob ein. »Das begreift er schon.«
*
»Und das nennt man Dorfidylle«, raunte Fee Daniel zu. »Warum sollen hier die Menschen anders sein als anderswo?« gab er zurück. »Ein Sonntagsspaziergang in München ist sicher weit weniger gefährlich, mein Schatz.«
»Ich werde es mir merken«, sagte sie. »Aber trotz allem haben wir auch einige sehr nette Menschen kennengelernt. Einen Besuch auf Gut Stiebenau werden wir uns verkneifen.«
Es blieb dabei, daß sie zur Insel fuhr, um die Kinder zu holen. Tresi fragte noch, ob sie einmal einen Besuch machen dürfe, wenn sie in München sei. Denn Nicola würde sie ja auf jeden Fall besuchen.
»Ich würde mich sehr freuen, Tresi«, erwiderte Fee.
Daniel begleitete Markus zur Polizei, und sie machten dort ihre Angaben, wie sie das Jagdhaus vorgefunden hatten. Das Mißtrauen, das Markus entgegengebracht wurde, konnten sie zerstreuen, aber die Kriminalbeamten waren nun vollends überzeugt, daß sie es mit einem recht schwierigen Fall zu tun hatten.
Als sie dann zum Krankenhaus kamen, lernte Daniel auch Dr. Friedhelm Ronneberg kennen, ohne Zweifel eine recht interessante Erscheinung. Mit Markus gleichgroß stand er diesem gegenüber, und Daniel spürte ein Kribbeln über seinen Rücken rinnen, so feindselig kreuzten sich die Blicke beider Männer.
Daniel gegenüber benahm sich Dr. Ronneberg kollegial. »Ich wurde durch einen Anruf bei meinen Eltern unterrichtet, was hier geschehen ist«, sagte er, »und selbstverständlich bin ich sofort gekommen. Ich halte es für unsinnig, Nicola in diesem Zustand neuen Belastungen auszusetzen. Sie wird hier bestens versorgt werden. Außerdem sind wir ihre nächsten Verwandten.«
»Ich habe auch ein Wort mitzureden«, fiel ihm Markus ins Wort. »Nicola ist meine zukünftige Frau.«
»Das mag Ihr Wunsch sein, Wangen«, sagte Dr. Ronneberg aggressiv, »aber dazu wird es nicht kommen.«
»Wollte man sie deshalb aus dem Weg räumen?« fragte Markus eisig. Aber dann mischte sich Dr. Großkopf ein. »Als Chefarzt habe ich auch mitzureden«, sagte er mit erzwungener Ruhe, »und ich habe entschieden, daß Fräulein von Stiebenau in eine Spezialklinik verlegt wird. Wir haben hier nicht die ausreichenden Möglichkeiten für eine Spezialbehandlung, und ich möchte ihr das Schicksal ihrer Mutter ersparen, gelähmt zu bleiben.«
»Sie wird die beste Behandlung bekommen, die möglich ist«, sagte Markus. »Dr. Norden wird dafür sorgen. Er hat mein Vertrauen.«
Der so gelobte war heilfroh, daß es drei Uhr war und der Krankenwagen bereitstand. Er fing noch einen haßerfüllten Blick auf, den Ronneberg Markus zuwarf, aber zu ihm sagte dieser im liebenswürdigsten Ton, daß er sich bald nach Nicolas Befinden erkundigen würde.
Bastian lag bei Markus bereits auf dem Rücksitz. Er winselte jammervoll, als dieser sich ans Steuer setzte, dann aber sprang er auf und kläffte wütend das Krankenhaus an. Er sah nicht, wie Nicola zum Sanitätswagen getragen wurde.
Als Markus diesem dann folgte, bellte der Hund immer noch aufgeregt.
»Dein Frauchen ist da vorn drin, Basti«, sagte Markus beruhigend. »Du wirst es hoffentlich bald wiedersehen. Reg dich jetzt nicht so auf.«
*
Wastl war bei Jakob und Tresi geblieben, und die waren zu Tresis Eltern zurückgekehrt. Sie wußten allerdings, daß Nicolas Wagen jetzt gründlichst untersucht wurde.
Peppi war nicht anwesend. »Er hat sich einfach aus dem Staube gemacht«, sagte Franz Portner. »Hoffentlich macht er keinen Blödsinn und legt sich mit den Ronnebergs an. Vorhin habe ich den Wagen von Friedhelm gesehen.«
»Dann ist er im Lande«, sagte Jakob bissig. »Peppi hat ihn auch gesehen«, vermutete er.
»Deshalb bin ich ja besorgt«, meinte Franz Portner. »Ihm fehlt noch die Vernunft.«
»Er ist nicht unvorsichtig«, sagte Jakob.
Wastl hatte indessen schon den Weg in die Küche gefunden und wurde gut gefüttert.
»Der Hund ist doch wachsam«, meinte Hedwig Portner. »Er müßte doch denjenigen finden, der den Tönnies niedergeschossen hat.«
»Hunde haben ihren Instinkt. Vielleicht ist auch auf ihn geschossen worden und er hat sich aus dem Staub gemacht«, meinte Jakob. »Das ist keine Feigheit. Wastl ist nicht auf Menschen abgerichtet. In der Nähe des Gutes hat er sich schrecklich aufgeregt gebärdet. Ich meine, wir müssen erst alles überdenken, und dann werde ich mit dem Hund den Spuren nachgehen.«
»Du begibst dich nicht in Gefahr«, protestierte Tresi. »Das tät’ mir grad noch passen, wenn wir dich auch irgendwo verletzt oder gar tot finden würden. Das ist jetzt Sache der Polizei, diesen Fall aufzuklären.«
*
Bei der Untersuchung von Nicolas Wagen hatten sie allerdings schon manches herausgefunden. Im Kofferraum lagen Bergschuhe und ein Lodencape und versteckt unter einer Gummimatte auch ihre Brieftasche. Und in der befand sich ein Brief von einer Münchner Bank, in dem Nicola gebeten wurde, zu einer persönlichen Rücksprache betreffs des deponierten Koffers zu kommen. Unter welcher Adresse dieser Brief Nicola erreicht hatte, war allerdings nicht zu ersehen, da der Umschlag nicht vorhanden war. Nach wie vor tappte man im dunkeln, wo sie sich zuletzt aufgehalten hatte. Das Paket für Tönnies, dessen Papier Basti zerfetzt hatte, enthielt eine Strickjacke, zwei Hemden und eine gerahmte Fotografie von Nicola mit der Widmung: Meinem guten Tönnies zur Erinnerung an Nicola.
Es wurde festgestellt, daß diese Fotografie in Basel gemacht worden war, und sogleich wurden die Ermittlungen aufgenommen, wie lange und wo Nicola in Basel gewohnt hatte.
Als die Kriminalbeamten wieder auf Gut Stiebenau erschienen, war dort auch Dr. Friedhelm Ronneberg anwesend.
»Ich bin sofort zurückgekommen, als meine Eltern mir sagten, was hier passiert ist«, erklärte er völlig gelassen.
»Und wo haben Sie sich aufgehalten?« wurde er gefragt.
»In München, bei meiner zukünftigen Frau.« Ein spöttisches Lächeln begleitete die Antwort.
Er wurde nach dem Namen und der Adresse gefragt.
»Cordula Lennert«, erwiderte Friedhelm Ronneberg, ohne zu zögern. Kommissar Harbig, der jetzt die Untersuchung leitete, sah, daß Frau Ronneberg zusammenzuckte.
»Sie ist meine Freundin«, warf Marina Ronneberg mit schriller Stimme ein. »Es ist purer Klatsch, wenn man davon redet, daß mein Bruder Nicola heiraten wollte.«
»Das gehört doch gar nicht hierher, Marina«, sagte Friedhelm verweisend.
»Ich weiß doch, wie hier getratscht wird«, ereiferte sie sich. »Wieso werden wir überhaupt belästigt? Wir haben mit diesen Dingen doch gar nichts zu tun. Ich war mit Mama in Lindau, und du warst doch in München.«
»Vielleicht hat der Gutsherr einige Beobachtungen gemacht«, sagte der Kommissar gelassen, aber er faßte Friedrich Ronneberg scharf ins Auge. »Vielleicht haben Sie einen Schuß gehört, Herr Ronneberg?«
»Ich habe nichts gehört«, erwiderte Friedrich Ronneberg.
Es wurden noch viele Fragen gestellt, aber an einem anderen Ort stellte Peppi Fragen, die weitaus direkter waren, und sein Gesprächspartner war der Martl, der von vielen als Dorfdepp bezeichnet wurde. Doch Peppi verstand mit ihm umzugehen.
»Hast gehört, was passiert ist, Martl?« fragte er.
Martl sah ihn aus starren Augen an und schüttelte den Kopf. »Der Tönnies ist erschossen worden, und die Baroneß haben wir am Wasserfall gefunden.«
»Bumbumbum?« machte Martl aufgeregt.
»Tönnies ist mausetot, die Baroneß liegt im Krankenhaus«, sagte Peppi. »Du schießt doch nicht?«
Martl schüttelte den Kopf und hob abwehrend die Hände. »Du hast auch den Alf nicht erschossen, gell?«
Martl schüttelte wieder den Kopf, dann irrten seine Augen ängstlich umher.
»Ich will dir nichts Böses, Martl, aber es wäre gut, wenn du mir was sagen könntest, sonst kommen die Polizisten und nehmen dich mit«, sagte Peppi.
»Nein, nein, Martl hat nichts tan«, sagte der mit gutturaler Stimme. »Nicht bumbum.«
»Wenn du ein Gewehr hast, gib es lieber mir«, sagte Peppi. »Ich hebe es auf, damit du keinen Ärger bekommst. Verstehst mich, Martl?«
Martl verstand. Seltsamerweise verstand er viel, wenngleich er auch nicht gut reden konnte. Und er trabte zu der kleinen Hütte und holte tatsächlich ein Gewehr. »Weg, weg«, drängte er.
»Ist gut, Martl, ich bringe es weg«, sagte Peppi. »Du hast Tönnies gestern nicht gesehen?«
Martl schüttelte wieder den Kopf. Mit ausgestrecktem Arm deutete er auf den Pferdestall. Dann packte er Peppis Arm und zog ihn dorthin. Eine unheimliche Kraft hatte er schon, und Peppi wurde es bang. Aber dann sah er ein Fohlen und dazu die Mutterstute, und er wußte, was Martl ihm zu verstehen geben wollte. Er war im Stall gewesen und hatte der Stute beim Fohlen geholfen.
»Der Herr auch?« fragte Peppi.
Martl nickte. »Keiner sonst da«, sagte er mühsam. »Keiner. Keiner bumbum.«
Mit dem Gewehr unter der Jacke machte sich Peppi auf den Heimweg. Schnurstracks lief er zu den Portners. Dort legte er das Gewehr auf den Tisch.
»Mein Gott, woher hast du es?« fragte Jakob entsetzt.
»Vom Martl. Er hat es mir freiwillig gegeben, aber ich glaube, daß daraus schon lange nicht mehr geschossen worden ist. Ich mag nicht, daß dem Martl etwas angehängt wird. Er ist doch so hilflos.«
»Vielleicht weiß er manchmal nicht, was er tut«, sagte Franz Portner.
»Er weiß es schon«, sagte Peppi trotzig. »Und er hat den Alf auch nicht erschossen. Es ist so leicht, einem etwas in die Schuhe zu schieben, der sich so schlecht wehren kann, und wenn er sich verteidigen will, sagt man gleich, daß er jähzornig ist.«
»Du warst doch gar nicht dabei, als wir über Martl geredet haben«, sagte Jakob.
»Aber gedacht hab’ ich mir, daß es auf ihn geht, wenn man keinen anderen findet. Ich meine, daß es einer von den Ronnebergs gewesen sein könnte.«
»Das sagst du besser nicht so laut«, sagte Jakob unwillig. »Wir haben schon genug Scherereien mit denen.«
*
Von diesen Scherereien erfuhr Daniel Norden dann von Markus Wangen, nachdem Nicola in der Beh-nisch-Klinik in einem hübschen, hellen Zimmer untergebracht worden war.
»Ich glaube, Sie könnten mir noch einiges erzählen, was ich bisher nicht weiß, Herr Wangen«, hatte Daniel gesagt.
»Jetzt brauchen Sie nicht mehr zu fürchten, daß Nicola in Gefahr ist, also können wir offen reden.«
»Ich habe keinerlei Beweise für meine Vermutungen, leider«, sagte Markus deprimiert. »Wird Nicola gesund werden?«
»Die Fahrt hat sie gut überstanden«, erwiderte Dr. Norden. »Es besteht im Augenblick kein Grund zu der Befürchtung, daß sich ihr Zustand verschlechtern könnte. Dr. Behnisch ist äußerst gewissenhaft. Sie können ihm vertrauen.«
»Hätte Nicola nur mir ganz vertraut«, sagte Markus leise. »Sie hat mich vorgestern angerufen und mir gesagt, daß jetzt alles ganz anders aussehen würde.«
»Was?« fragte Daniel aufhorchend.
»Sie hat mir nichts Genaues gesagt, nur, daß jetzt doch Aufzeichnungen ihres Vaters aufgetaucht wären. Sie würde mir bald alles erklären. Mehr hat sie nicht gesagt.«
»Von wo aus hat sie angerufen?« fragte Daniel.
»Aus Basel. Dort lebt sie seit dem Tode ihres Vaters bei einer Freundin.«
»Und Sie wußten das.«
»Ja, natürlich wußte ich das.«
»Aber Sie sagten, daß Sie Nicola schon lange nicht mehr gesehen haben.«
»Das ist die Wahrheit. Ich muß weiter zurückgreifen, damit Sie alles verstehen. Ich kenne Nicola bereits acht Jahre.«
Dr. Norden sagte nicht, daß er dies bereits wußte. Er wollte gern von Markus hören, wie er die Geschehnisse sah.
»Vielleicht beginnen Sie da«, sagte er freundlich.
»Kann man hier etwas zu trinken bekommen? Meine Kehle ist trocken, und ich habe heute überhaupt noch nichts gegessen.«
»Dann wird es aber Zeit«, sagte Daniel. »Gehen wir rüber ins Restaurant.«
»Und wenn Nicola zu sich kommt?«
»Man kann uns schnell benachrichtigen«, sagte Daniel. »Ich sage Jenny Behnisch Bescheid.«
Sie brauchten nur über die Straße zu gehen. Und in einer stillen Ecke, bei gutem Essen und einem kühlen Bier, nach dem beiden zumute war, begann Markus zu erzählen.
»Ich muß vorausschicken, daß einige unschöne Begebenheiten erörtert werden müssen, die Sie vielleicht schockieren, Dr. Norden«, meinte er zurückhaltend.
»Mich kann so schnell nichts schockieren«, erwiderte Daniel. »Was meinen Sie, womit ich in meiner Praxis tagtäglich konfrontiert werde.«
»Also dann«, begann Markus mit einem tiefen Seufzer. »Mein Vater hatte das Jagdhaus gekauft und die Jagd von Baron Stiebenau gepachtet. Ich war zwanzig, als ich das erstemal dorthin kam. Ich bin in England erzogen worden und wollte in München studieren. Nicola war fünfzehn. Es waren gerade Ferien, und sie war zu Hause. Ich hatte schnell heraus, daß mein Vater sich heimlich mit Nicolas Mutter traf, und ich wollte nicht, daß Nicola davon erfuhr. Ich mochte auch den Baron sehr gern. Ich spürte, daß er große Sorgen hatte. Ich fragte meinen Vater, ob er es richtig fände, ein Verhältnis mit der Baronin anzufangen, er aber lachte nur dazu. Meine Mutter lebte damals ja schon nicht mehr«, fügte Markus leise hinzu, und dann folgte ein kurzes, aber inhaltschweres Schweigen. Daniel spürte, wie nahe Markus dies alles gegangen war.
»Mein Vater sagte, daß man bei verheirateten Frauen nicht Gefahr laufe, an die Kette gelegt zu werden, denn heiraten wolle er nicht wieder, und der Baron sei eben zu alt für eine so temperamentvolle Frau. Ich hatte mich mit Nicola angefreundet. Wir verstanden uns sehr gut, und sie schrieb mir dann auch regelmäßig, als sie wieder im Internat war. Ihretwegen fuhr ich dann in den Sommerferien wieder mit zum Jagdhaus, und in diesem Jahr kam ich zufällig dahinter, daß Miriam Stiebenau auch mit Friedhelm Ronneberg sehr intim war. Die Details ersparen Sie mir bitte. Ich sagte es meinem Vater ins Gesicht, aber auch da lachte er nur. Um so besser, meinte er, er müsse sich ohnehin schonen, da sein Herz nicht mehr so wolle. Er sprach dann auch darüber, daß der Baron ziemlich verschuldet wäre und er ihm unter die Arme greifen wolle. Er machte auch die Andeutung, daß er nichts dagegen hätte, wenn ich Nicola später mal heiraten würde. Zu dieser Zeit versuchte Miriam aber schon, mich mit Marina zu verkuppeln.« Er machte wieder eine Pause. »Ich muß gestehen, daß ich mir erst ernsthafte Gedanken darüber machte, als mein Vater so plötzlich gestorben war.«
»Da war die Baronin bei ihm, wie mir gesagt wurde.«
Markus runzelte die Stirn. »Ja, sie war bei ihm, nur so, um Grüß Gott zu sagen«, bestätigte er sarkastisch. »Aber ich wußte, daß mein Vater diese Affäre beenden wollte. Er hatte mit mir ganz offen darüber gesprochen. Er sagte mir, daß er jetzt einiges mehr wüßte und nicht dazu beitragen wolle, daß ein ehrbarer Mann vor die Hunde geht. Ich nehme an, daß es zwischen ihm und Miriam zu einem Streit kam, bei dem dann sein Herz versagte, aber Beweise hatte ich nicht dafür. Ich war nicht anwesend.«
»Mich würde die Geschichte mit dem Pferd interessieren«, warf Daniel ein, »und auch der Tod Ihres Hundes.«
»Sie haben schon eine Menge erfahren«, sagte Markus. »Aber Sie haben Nicola gerettet, und dafür schulde ich Ihnen Dank. Vieles kann ich ja nicht beweisen, aber ich kann Ihnen sagen, daß ich viele schlaflose Nächte grübelnd verbracht habe. Ja, die Geschichte mit dem Pferd. Nicola hatte es von ihrem Vater bekommen, ein wunderschöner Hengst. Er hat Miriam nicht gemocht, aber gerade das hat sie wohl gereizt, ihn zu reiten. Sie war eine unberechenbare Frau, soweit ich das in so jungen Jahren beurteilen konnte. Nach ihrem unglückseligen Sturz wollte der Baron das Pferd weggeben, aber Nicola wollte es behalten. Ich zahlte den Kaufpreis und schenkte es ihr. Da hat der Baron zum erstenmal zu mir von seinen finanziellen Nöten gesprochen. Daß die lange Krankheit seiner Frau viel Geld verschlinge und sie nicht versichert wären. Er machte einen sehr desolaten Eindruck. Ich gab ihm eine größere Summe, und er stellte mir einen Schuldschein aus. Ich sagte ihm, daß ich Nicola gern heiraten würde. Er reagierte sehr merkwürdig. Dann müsse ich weit weg mit ihr gehen, um glücklich werden zu können, hat er gesagt. Sie sehen, daß meine Liebe zu Nicola unter keinem glücklichen Stern steht, aber ich habe es nie aufgegeben, um sie zu kämpfen, auch dann nicht, als sie selbst mir sagte, daß sie niemals meine Frau werden könne.«
»Wann war das?« fragte Daniel.
»Nach dem Tode ihres Vaters.«
»Kommen wir nochmals auf das Pferd zurück, damit ich den Faden nicht verliere«, sagte Daniel. »Mir wurde gesagt, es hätte auch Nicola ein paarmal abgeworfen.«
»Ja, zweimal. Es scheute, wenn geschossen wurde. Auch die Baronin sagte, daß Schüsse fielen, bevor Satan sie abwarf. Sie fiel sehr unglücklich auf einen Baumstumpf. Nicola hat keinen Schaden davongetragen, glücklicherweise nicht, aber ein Abwurf war an jenem Tag, als mein Hund Alf erschossen wurde. Er war ein treuer, wachsamer Hund. An Wildern war bei ihm gar nicht zu denken. Das Gerücht wurde von den Ronnebergs in die Welt gesetzt, wie manches andere auch.«
»Was ist mit Satan geschehen, als Nicola das Gut verließ?« fragte Daniel.
»Ich habe ihn auf einem Gestüt untergebracht. Dies wenigstens hat mir Nicola gestattet.«
»Und warum hat sie Ihnen das Gut nicht verkauft?« fragte Daniel voller Spannung. »Sie hatten doch darauf Hypotheken und zeigten auch Interesse.«
»Nicola wollte es nicht.« Er preßte die Lippen aufeinander. »Sie konnte es auch nicht, um die Wahrheit zu sagen, die sonst niemand kennt, denn der Baron hatte in seinem Testament festgelegt, daß die Ronnebergs das Gut bekommen sollten mit der Auflage, mir die Hypotheken zurückzuzahlen und Nicola monatlich zweitausend Euro zu zahlen, falls sie nicht willens sein sollte, weiterhin dort zu leben. Sie war nicht willens«, sagte Markus heiser, »und wenn Sie meine Meinung zu alldem wissen wollen, so denke ich, daß der Baron von dieser Sippschaft erpreßt wurde.«
»Womit?«
»Das weiß ich allerdings nicht. Immerhin bekam Nicola fünfhunderttausend Euro aus der Lebensversicherung. Damit hatte niemand gerechnet, denn mit Versicherungen und allem Papierkram war der Baron recht achtlos. Er hatte auch vergessen, den Brandner-Söhnen die Schenkungsurkunde für das Haus zu geben, deshalb haben sie die Scherereien. Beim Baron ging alles auf Treu und Glauben, und angeblich wurde keine diesbezügliche Urkunde in seinem Nachlaß gefunden, wie manches andere auch nicht. Ja, da gäbe es wohl viele Rätsel zu lösen, Dr. Norden. Vielleicht hat Nicola doch einiges in Erfahrung gebracht. Sie rief mich vor einigen Tagen an und sagte, daß sie nach München kommen wolle, und wir könnten uns dann aussprechen. Das kam mir sehr überraschend. Ich sagte ihr, daß ich sie liebe und immer noch heiraten wolle. Und da erwiderte sie, daß wir jetzt auch darüber sprechen könnten. Ich war so voller Hoffnung, und dann kam diese entsetzliche Nachricht. Ich bin dankbar, daß ich mit Ihnen sprechen kann. Manchmal meinte ich, verrückt zu werden mit allen diesen ungeklärten Fragen. Wenn Nicola doch nur erst sprechen könnte.«
Das konnte noch ziemlich lange dauern. Dr. Norden wußte das, und es war auch fraglich, ob sie sich genau würde erinnern können. Oft genug war es so, daß der Schock das Erinnerungsvermögen für die fragliche Zeitspanne auslöschte. Aber er wollte Markus das Herz jetzt nicht noch schwerer machen.
»Darf ich Ihnen noch eine Frage stellen, Herr Wangen?« ergriff er das Wort.
»Ja, selbstverständlich.«
»Man erzählte sich auch, daß die Ronnebergs ihre Tochter Marina mit Ihnen verheiraten wollten.«
»Ja, ich sagte doch schon, daß Miriam das forcierte, aber das kam für mich überhaupt nicht in Frage. Eine eitle, selbstgefällige, dumme Person, wie ihre Mutter auch. Sie würden das auch festgestellt haben.«
*
Und auch die Kriminalbeamten hatten sich solches Urteil gebildet, allerdings konnte Kommissar Harbig dazu noch feststellen, daß manche ihnen gestellte Fragen sie verunsicherten und sie mit lächerlichen Ausflüchten kamen. So vor allem die Frage nach ihrer Herkunft und ihrem früheren Wohnort, und wie sie dann ausgerechnet hierhergekommen wären.
»Wir hatten ein Gut in Pommern«, erklärte Friedrich Ronneberg. »Einen großen, ertragreichen Besitz. Arved von Stiebenau war mit einigen anderen Offizieren bei uns einquartiert. Es entstand eine sehr enge Freundschaft, und Arved sagte, daß wir uns hier treffen wollten, wenn der Krieg zu Ende sei. Daß er so zu Ende gehen würde, ahnten wir da noch nicht, aber wir waren dann dankbar, daß wir hier Zuflucht fanden. Arved ist ja leider gefallen.«
»Und Sie haben doch sicher für Ihren verlorenen Besitz durch den Lastenausgleich eine Entschädigung bekommen«, sagte der Kommissar.
»Ja, natürlich, selbstverständlich«, erwiderte Friedrich Ronneberg hastig. »Dadurch war es uns auch möglich, Gut Friedenau zu erwerben und Diet-rich unter die Arme zu greifen.«
»Und jetzt gehört Ihnen alles«, sagte der Kommissar.
»Dietrich wußte, daß wir sein Erbe bestens verwalten würden. Seine Tochter wäre dazu doch nicht fähig gewesen«, sagte Stella Ronneberg herablassend.
»Unsere persönlichen Angelegenheiten haben doch wohl mit diesem unbegreiflichen Geschehen nichts zu tun«, erklärte Ronneberg gereizt.
»Wir werden jetzt ermitteln«, sagte der Kommissar. Dann gingen die Beamten.
Mit verkniffener Miene blickte ihnen Stella Ronneberg nach, während Marina mit einer empörten Bemerkung verschwand. »Sie werden Nachforschungen anstellen, Friedrich«, sagte Stella bebend.
»Unsinn, fünfunddreißig Jahre sind eine lange Zeit. Aber wenn Friedhelm sich diplomatischer verhalten hätte, könnte er längst mit Nicola verheiratet sein, und dann gäbe es wieder einen Stiebenau.«
Friedhelm Ronneberg sah seinen Vater scharf an. »Erinnerst du dich nicht mehr, was er gesagt hat, dieser letzte Stiebenau? Lieber soll alles in Trümmer fallen, als daß ein Ronneberg den Namen Stiebenau erhält.«
»Tote reden nicht«, sagte der Ältere.
»Nicola lebt«, sagte Stella. »Warst du wirklich bei Cordula, Friedhelm?«
Der legte den Kopf zurück. »Jetzt fehlt wirklich nur noch, daß wir uns auch noch zerstreiten«, sagte er kalt. »Haltet ihr Weiber eure Zunge im Zaum. Vor allem Marina. Sie ist ja dümmer als die Polizei erlaubt.«
*
»Also, Sie beginnen mit den Nachforschungen nach den Ronnebergs«, sagte Kommissar Harbig zu seinem Assistenten. »Ich möchte wissen, wieviel Lastenausgleich sie bekommen haben und was über ihre Besitzungen in Pommern bekannt ist. Und fragen Sie auch mal beim Suchdienst nach, was über das Schicksal von Arved von Stiebenau bekannt ist.«
»Meine Güte, das ist doch ewig her, und was hat das mit diesem Fall zu tun?«
»Es interessiert mich, Maxi. Es ist alles so ein bißchen merkwürdig, was ich bis jetzt erfahren habe. Glauben ist gut, überzeugen ist besser. Für mich sind das einfach zu viele mysteriöse Unfälle. Also an die Arbeit! Wenn wir schon einen ganzen Sonntag abschreiben müssen, soll es auch etwas einbringen. Ich unterhalte mich jetzt noch ein bißchen mit dem netten Herrn Portner.«
»Er hat eine hübsche Tochter«, sagte Maxi.
»Die in festen Händen ist!«
»Alle netten Mädchen sind in festen Händen.«
»Man muß sich umschauen«, lachte der Kommissar.
»Wann denn?« seufzte der junge Mann.
»So viel Zeit habe ich gefunden, und du wirst sie auch finden. Bei den Ämtern kannst du heute doch nichts erreichen, also schau dich unter den Dorfschönen mal um, und mach die Ohren ganz weit auf. In jedem Klatsch liegt auch ein Körnchen Wahrheit.« Er wußte das, und er wußte vor allem, wie oft der Zufall, den man schon Kommissar Zufall nannte, weitergeholfen hatte. Er hoffte, noch manches von Franz Portner zu erfahren, nachdem er die Familie Ronneberg nun kennengelernt und sich ein Bild gemacht hatte.
*
Dr. Norden und Markus waren zur Behnisch-Klinik zurückgekehrt. Dort war Nicola nochmals gründlichst untersucht worden. Dr. Behnisch erstattete den beiden Männern Bericht.
»Innere Blutungen sind zum Glück nicht feststellbar«, begann er. »Die Blutergüsse rühren jedoch nicht ausschließlich von dem Sturz her. An beiden Armen habe ich Druckstellen gefunden, die von einer kräftigen Umklammerung herrühren. Die Vermutung, daß die Patientin von einem Streifschuß an der Hüfte verletzt wurde, kann man als erwiesen betrachten. Wir werden ein paar Knochensplitter entfernen müssen.«
»Und was bedeutet das für Nicola?« fragte Markus erregt.
»Dies ist korrigierbar, Herr Wangen. Es wirft keine Probleme auf.«
»Du meinst, sie könnte angegriffen worden sein, und es gelang ihr, sich loszureißen, und dann wurde auf sie geschossen?« fragte Daniel.
»Oder umgekehrt. Es wurde auf sie geschossen, und sie konnte noch ein paar Schritte laufen. Dann wurde sie gepackt und hinuntergestoßen. Jedenfalls hat ein Kampf stattgefunden. Unter den Fingernägeln befanden sich Hautpartikel, die mit ihrer Haut nicht identisch sind. Das ist wohl bisher nicht beachtet worden.«
»Man ging davon aus, daß es sich um einen Unfall gehandelt hat«, erklärte Daniel.
»Wir werden einen Gerichtsmediziner beschäftigen«, erklärte Dr. Dieter Behnisch.
»Auf jeden Fall ist es besser, daß Nicola hier ist«, sagte Markus leise. »Sie werden doch niemanden zu ihr lassen?«
»Sie wird die bestbewachte Patientin sein«, versprach Dr. Behnisch.
»Und Sie werden auch Dr. Ronneberg nicht zu ihr lassen?«
Auf Dieter Behnischs fragenden Blick sagte Daniel: »Ich erkläre dir alles noch genau.«
»Ronneberg«, wiederholte Dr. Behnisch. »War Professor Weiland sein Doktorvater?«
»Das weiß ich nicht«, entgegnete Markus.
»Das werde ich schon herausbringen. Er kann nicht viel jünger sein als wir, Daniel, wenn meine Gedankengänge richtig sind.«
»Er ist siebenunddreißig«, sagte Markus.
»Das kommt hin. Er war mit Sabine Weiland verlobt, vor etwa zehn Jahren.«
»Da kannte ich ihn noch nicht«, sagte Markus nachdenklich. »Sie kennen ihn?«
»Seinen Namen, aber ich möchte jetzt nichts darüber sagen. Ich werde erst mit Weiland sprechen.«
»Kann ich Nicola jetzt sehen?« fragte Markus nach einem längeren Schweigen und mit dem Gefühl, daß die beiden Ärzte unter vier Augen sprechen wollten.
»Nichts dagegen einzuwenden«, erwiderte Dr. Behnisch, »aber sie wird noch längere Zeit schlafen.«
»Ich möchte sie nur sehen«, flüsterte Markus.
Dr. Jenny Behnisch führte ihn zur Intensivstation. »Schwer mitgenommen, der junge Mann«, bemerkte Dr. Behnisch, als er mit Daniel allein war.
»Nicola von Stiebenau ist seine große Liebe«, erklärte Daniel.
»Das Mädchen hat eine ausgezeichnete Konstitution und ein sehr starkes Herz.«
»Ich habe auch gehört, daß sie einen starken Willen hat.«
Dr. Behnisch kniff leicht die Augen zusammen. »Und ich möchte einmal erleben, daß du etwas unternimmst, ohne daß etwas passiert«, versuchte er zu scherzen. »Wieviel Unglückswürmer hast du eigentlich schon aufgelesen?«
»Da müßte ich lange nachdenken. Ich würde lieber wissen, was du möglicherweise über Ronneberg weißt.«
»Ich möchte lieber erst mit Weiland sprechen, Daniel«, sagte Dr. Behnisch ruhig. »Aber vielleicht erzählst du mir, was ihr erlebt habt.«
Das tat Daniel dann auch, und sein Freund Dieter unterbrach ihn nicht ein einziges Mal.
*
Markus saß still an Nicolas Bett. Er ließ sie nicht aus den Augen. Zärtlichkeit und Angst lagen in seinem Blick. Mehrmals mußte er sich räuspern, weil ihm die Kehle trocken war. Schwester Martha brachte ihm dann unaufgefordert ein Kännchen Tee und Gebäck.
Hastig trank er dann ein paar Schlucke. »Nicola«, sagte er leise, »wenn du mich auch nicht hören kannst, aber vielleicht spürst du, daß ich da bin. Ich liebe dich, nur dich, und ich werde dich nie mehr allein lassen, und ich werde herausbringen, wer dir das angetan hat. Gnade ihm Gott!«
Jetzt erst merkte er, daß er das nicht nur dachte, sondern auch sagte, und daß ein wilder Zorn sich zur Verzweiflung gesellte, die ihn über Stunden gelähmt hatte.
Dann überlegte er, wie es geschehen sein könnte. Dann kam ihm der Gedanke, daß Nicola schon am Abstellplatz überrascht und Bastian von einem anderen im Wagen eingesperrt wurde. Wohin sie auch immer gehen wollte, Bastian hätte sie nicht freiwillig zurückgelassen.
Ein Zufallstäter? Jemand, der gerade des Weges kam und sie berauben wollte? Das konnte er sich nicht vorstellen. Der Wagen war ja auch nicht aufgebrochen worden. Wenn auch der Hund abschreckend gewesen sein mochte, am Kofferraum waren auch keine Spuren zu sehen gewesen. Dann aber konnte er klarer denken, logischer. Nicola mußte doch zumindest die Wagenschlüssel in der Hand gehabt haben. Und wieder irrten seine Gedanken ab. Warum war Tönnies umgebracht worden, dieser alte Mann, der keiner Fliege etwas zuleide tun konnte?
Tönnies hatte Geburtstag, und jemand konnte gewußt haben, daß Nicola kommen würde. Hatte sie vielleicht den Ronnebergs Nachricht gegeben? Hatte sie diese aufsuchen wollen, um etwas mit ihnen zu besprechen, etwas, das mit der Erklärung zu tun haben konnte, die sie ihm am Telefon gegeben hatte?
Er versuchte, sich an den genauen Wortlaut zu erinnern. Er war schrecklich aufgeregt gewesen, daß sie ihn anrief, und als er dann ihre leise Stimme vernahm. Was hatte er doch gesagt?
»Warum hast du mich so lange warten lassen, Nicola?«
»Ich habe gesagt, daß du mir Zeit lassen mußt.« Ja, das hatte sie erwidert. »Ich werde nach München kommen. Es wird sich manches ändern, Markus.«
»Ich liebe dich. Wirst du mich jetzt heiraten?«
»Wir werden über alles sprechen. Auch darüber.«
Sie hatte nicht ja aber auch nicht nein gesagt. Aber ihre Stimme hatte sanft und weich geklungen, ja, er hatte sich eingebildet, daß Sehnsucht in ihr schwang.
Und nun dachte er zurück an die Zeit, als er das Mädchen Nicola kennenlernte. Schmal wie ein Junge war sie gewesen, aber ihr herzförmiges Gesichtchen hatte schon ahnen lassen, daß sie einmal eine Schönheit werden würde.
Er hatte sie bewundert, und er hatte sich schon damals in sie verliebt, ohne daß es ihm so deutlich bewußt geworden wäre.
Und dann später war in ihm eine gewisse Abwehr erwacht. Nicht gegen Nicola, sondern gegen ihre Mutter und dann auch gegen ihren Vater, weil er sich so viel gefallen ließ von seiner Frau und auch von den Ronnebergs.
Ja, er hatte die Ronnebergs besser kennenlernen wollen und war deshalb öfter einer Einladung gefolgt. Aber sie hatten wohl gemeint, daß er sich für Marina interessiere und dies sehr forciert. Und sie hatten es wohl auch so Nicola zu verstehen gegeben. Da hatte sie sich hinter Abwehr und Trotz verschanzt, war ihm aus dem Wege gegangen, war immer mit Tresi und Jakob zusammen.
Aber dann kam Miriams Unfall, und der Kampf um Satan hatte sie einander wieder nähergebracht. Er hatte ihr auch gesagt, daß er nicht das geringste Interesse an Marina hege, und sie waren einander so nahe gekommen, daß er dann auch von Heirat sprach.
»Nicht, solange Papa lebt«, hatte sie gesagt. »Und überleg es dir gut, ob du die Tochter einer Frau heiraten willst, die wahllos ihre Gunst an Männer jeder Altersgruppe verschenkte. Dich hätte sie doch auch gern vernascht.«
Ja, sie hatte einen klaren Blick gehabt. Man hatte ihr nichts vormachen können, und er war auch überzeugt gewesen, daß sie die Ronnebergs durchschaute und haßte. Lauer Gefühle war Nicola nicht fähig. Entweder – oder, hieß es bei ihr. Und kurz vor dem Tod ihres Vaters hatte sie ihm dann auch bewiesen, daß sie ihn mit aller Konsequenz ihres Charakters liebte. Und dann war doch alles anders gekommen, als er es sich in jenen herrlichen wenigen Tagen, die er mit ihr verbringen konnte, erträumt hatte.
Der Tod ihres Vaters hatte sie völlig verändert. Wohl auch die Tatsache, daß er den ganzen Besitz den Ronnebergs hinterließ und sie mit Geld abspeiste.
»Es gibt kein gemeinsames Leben für uns, Markus«, hatte sie gesagt, »ich würde dir nur Unglück bringen.« Und dann war sie gegangen.
Er legte die Hände vor sein Gesicht und konnte die Tränen nicht mehr unterdrücken, die ihm in die Augen stiegen.
*
»Ja, dann werde ich dir wohl etwas sagen müssen, was dich befremden wird, Daniel«, sagte Dr. Behnisch, als Daniel ihm die genaue Schilderung der vergangenen Tage gegeben hatte. »Nicola von Stiebenau hat mindestens ein Kind geboren. Vielleicht war es eine Frühgeburt, und das Kind ist nicht am Leben, aber sie hatte einen Kaiserschnitt, das steht einwandfrei fest, und nicht wegen eines Unterleibsschadens Das könnte Wangen umwerfen.«
»Ich weiß nicht, Dieter. Ich glaube, er liebt sie so sehr, daß auch diese an seiner Zuneigung nichts ändern könnte.« Er sah den anderen offen an. »Kannst du auch sagen, wann dies ungefähr gewesen sein könnte?«
»Wenigstens vor zwei Jahren, aber genau kann man das nicht feststellen. Die Narbe ist kaum noch sichtbar, was allerdings nur dafür zeugt, daß sie gesundes Blut hat, und figürlich kann man kaum eine Veränderung feststellen. Wenn die Narbe nicht wäre, hätte ich diese Diagnose nicht einmal stellen können. Die Gebärmutter ist bestens zurückgebildet.«
»Und sie kann noch weitere Kinder haben?«
»Ein Dutzend, wenn dieser Schock überwunden ist.«
»Du meinst, daß seelische Konflikte bleiben könnten.«
»Das könnte sein. Ich hoffe nur, daß die Gehirnzellen baldigst wieder normal arbeiten, sonst könnte sie auch diesbezüglich Schaden nehmen.«
»Wirst du Markus Wangen reinen Wein einschenken bezüglich der Schwangerschaft?«
»Ich werde mich hüten!«
»Du hältst mich auf dem laufenden? Ich muß jetzt nach Hause.«
*
Fee hatte schon in der Klinik angerufen, daß sie gut mit den Kindern angekommen sei, und daß die Drei sich sorgen würden, daß dem Papi etwas passiert sein könnte, weil alles doch ganz anders gelaufen war, als sie begreifen konnten.
Es herrschte Jubel, als Daniel kam und seine drei Trabanten in die Arme nehmen konnte. Und dann mußte er sich für ein paar Stunden nur ihnen widmen. Ihm war das ganz willkommen, dann brauchte er nicht gleich die Fragen zu beantworten, die schon in Fees Augen brannten. Als dann endlich Ruhe eingekehrt war, war es draußen schon ganz dunkel geworden.
Zu dieser Stunde verabschiedete sich Kommissar Harbig von dem Ehepaar Portner, die ihm zum Abschied sagten, daß sie niemals geglaubt hätten, daß Kriminalkommissare so nett sein könnten.
Zu netten Menschen sei man eben auch nett, hatte er erwidert, und er konnte mit dem Ergebnis zufrieden sein, daß ihm diese recht gemütlichen Stunden bei Bier und deftigem Abendessen gebracht hatten.
Er hatte viel erfahren, auch von dem Koffer, den er für Baron von Stiebenau bei einer Bank deponiert hatte, und auch den Namen der Bank hatte ihm Franz Portner verraten.
Aber Maxi Strasser war auch nicht untätig gewesen, obgleich er sich anscheinend recht gut amüsiert hatte.
Auf der Heimfahrt berichtete Maxi von der hübschen Schwester Tina, mit der er ein paarmal getanzt hatte.
»Eigentlich nicht mein Typ«, meinte er, »aber ich habe aufgeschnappt, daß sie etwas mit Dr. Ronneberg gehabt hätte.«
»Potztausend, das ist ja was!« rief Kommissar Harbig aus.
»Sie hat aber nicht von ihm geredet. Sie hat nur gesagt, daß man von den Männern die Nase vollbekommen könnte. Aber dann war sie sehr anlehnungsbedürftig. Und sie war sehr enttäuscht, daß ich nicht über die Nacht geblieben bin.«
»Willst du umkehren?« fragte Kommissar Harbig verschmitzt.
»Bloß nicht. Für was Festes ist die nichts. Sie strebt auch nach Höherem. Es muß wohl mindestens ein Arzt sein oder sonst ein Akademiker.«
»Ist sie dort ansässig?«
»Und wie. Ihr Vater ist Bürgermeister. Sie hat dann einen Anruf bekommen und ist schnell verschwunden.«
»Und du bist ihr nicht nach?«
»Na klar, was meinst du! Sie ist in ein dunkles Auto gestiegen, das Kennzeichen habe ich aber gleich aufgeschrieben.«
»Gut gemacht, Maxi, du wirst es noch weit bringen«, sagte der Kommissar anerkennend. »Und wenn du dich weiterhin so geschickt anstellst, werde ich dich mit meiner Nichte Uschi bekannt machen. Das ist ein duftes Mädchen.«
»Hat sie eine nette Mutter? Meine Mama sagt immer, man soll sich zuerst die Mutter ansehen, bevor man die Tochter heiratet.«
»Ist gar nicht so übel, aber manchmal geraten Töchter auch nach dem Vater. Man darf nichts verallgemeinern. Dennoch, Uschi hat eine sehr nette Mutter. Ist ja klar, sonst wäre ich nicht mit ihrer Schwester verheiratet.«
»Aber Sie haben ja leider nur zwei Söhne«, sagte Maxi. »Sie als Schwiegervater, das wär mein Traum.«
»Kannst ruhig auch du zu mir sagen, Maxi, wenn wir nicht im Dienst sind. Tut mir ja leid, daß ich keine Tochter habe. Du wärst mir als Schwiegersohn schon willkommen, aber die Uschi ist mein Patenkind, und da hab’ ich auch bei der Taufe geschworen, auf sie aufzupassen. Und wenn wir am nächsten Sonntag nicht schon wieder in Atem gehalten werden, kannst du sie bei uns kennenlernen, als Belohnung für deinen Fleiß und deine Wachsamkeit.«
»Ich hab’s ja immer gesagt, daß der Harbig ganz einmalig ist«, sagte Maxi. Und so fanden die aufregenden Tage für sie einen recht harmonischen Abschluß.
*
Die neue Woche sollte für alle aufregend genug anfangen. Max Strasser führte aus, was sein Chef ihm aufgetragen hatte, und wenn das auch mühsam war, er gab nicht auf.
Kommissar Harbig fuhr zuerst zur Bank. Da mußte er sich erst einmal ganz genau ausweisen, und es wurde auch rückgefragt, ob man berechtigt sei, ihm Auskünfte zu geben.
Die Auskunft war dann kurz und bündig. Nicola von Stiebenau hatte besagten Koffer bereits am Freitag von der Bank abgeholt.
Welche Adresse sie als Wohnsitz angegeben hätte, wollte Harbig wissen. Und er riß staunend die Augen auf, als man ihm Markus Wangens Adresse nannte.
Damit mußte er sich aber zufriedengeben. Er machte sich auf den Weg zu Markus Wangen. Er hatte Glück und traf ihn zu Hause an. Markus war erst nach Mitternacht aus der Klinik gekommen und erst gegen Morgen eingeschlafen, und so kam es, daß er erst kurz nach zehn Uhr aufgewacht war.
Das heißt, er wurde durch einen Anruf geweckt, der von seinem Anwalt kam und ihn in tiefste Verwirrung gestürzt hatte. In diese platzte Kommissar Harbig hinein.
Da hatte sich Markus jedoch schon kalt geduscht und auch schon zwei Tassen starken Kaffee getrunken.
Der Frühstückstisch war noch gedeckt, und die Brötchen hatte Markus noch nicht angerührt.
»Möchten Sie auch Kaffee?« fragte Markus. »Ich bin immer noch nicht ganz da. Ich war lange in der Klinik.«
»Und ich war bereits auf der Bank«, erwiderte Harbig. »Fräulein von Stiebenau hat dort Ihre Adresse als augenblicklichen Wohnsitz angegeben.«
»Weshalb waren Sie auf der Bank?« fragte Markus.
»Wegen eines Koffers, der dort deponiert war und den Fräulein von Stiebenau am Freitag abholte. Sie war danach nicht bei Ihnen?«
»Nein.« Markus schrie es fast. »Ich hätte es doch gesagt. Aber vorhin rief mich mein Anwalt an und sagte mir, daß Nicola bei ihm einen Koffer deponiert hat, er mich aber erst heute benachrichtigen solle, wenn sie sich bis dahin nicht bei ihm gemeldet hätte.«
»Warum regen Sie sich so auf, Herr Wangen?« fragte Kommissar Harbig.
»Mein Gott, können Sie sich das nicht denken? Nicola muß befürchtet haben, daß ihr etwas passiert. Sie war in München, sie hat einen Koffer von der Bank geholt, aber nicht zu mir gebracht, obgleich sie meine Adresse an-gab. Ich bin doch nicht von gestern, Herr Kommissar. Ich kann schnell denken. Sie fuhr dorthin, wo sie zu Hause war. Sie hatte vielleicht eine Verabredung getroffen.«
»Sie haben viel Phantasie, Herr Wangen«, sagte Kommissar Harbig ruhig.
»Überhaupt keine«, erwiderte Markus. »Ich versuche logisch zu denken. Was ist los mit dem Koffer?«
»Das weiß ich auch nicht. Wir werden jetzt zu Ihrem Anwalt fahren, Herr Wangen. Er kann uns sicher mehr sagen.«
»Hoffentlich!« stöhnte Markus.
*
Dr. Waalborg war ein älterer vertrauenerweckender Mann. Aber auch er war sichtlich betroffen, als Markus ihm Kommissar Harbig vorstellte.
»Ich kann den Koffer ohne richterlichen Beschluß nicht herausgeben«, erklärte er.
»Aber Sie können uns sagen, was Fräulein von Stiebenau dazu sagte«, erwiderte Harbig.
»Sie sagte, daß sie nun Bescheid wisse und sie mir völlig vertraue, da ich das Testament ihres Vaters aufgesetzt hätte.«
»Sie vertraute Ihnen völlig, obgleich sie praktisch enterbt wurde?« fragte Kommissar Harbig konsterniert.
»Das stimmt nicht. In dem Testament, das ich aufsetzte, war sie als Alleinerbin aufgeführt. Es wurde später durch ein handschriftliches Testament des Barons widerrufen. Ich war dadurch völlig konsterniert, aber auch auf meinen Rat hin wollte Nicola das zweite Testament nicht anfechten. Sie sagte damals: Besser Unrecht leiden, als Unrecht tun. Ich habe es nicht vergessen. Und am Freitag sagte sie nur: Unrecht Gut gedeihet nicht. Jetzt hätte sie die Beweise.«
»Fräulein von Stiebenau hatte einen schweren Unfall und ist noch ohne Bewußtsein«, sagte Kommissar Harbig. »Der Inhalt des Koffers könnte uns weiterhelfen.«
»Ich brauche die Genehmigung der Besitzerin dazu oder einen richterlichen Beschluß. Ich möchte gern helfen, aber ich bin an meine Pflichten gebunden«, erwiderte der Anwalt.
»Nicola wollte aber, daß Sie mich benachrichtigen«, warf Markus ein.
»Ja, ich sollte Ihnen etwas übergeben«, erwiderte Dr. Waalborg. Und er reichte Markus einen Umschlag. Ein trauriger Ausdruck lag jetzt auf dem faltigen Gesicht. »Ich hoffe sehr, daß Nicola von Stiebenau am Leben bleibt«, sagte er leise.
»Das hoffen wir alle«, sagte Kommissar Harbig. »Es ist sicher eine persönliche Nachricht, aber ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mich informieren würden, Herr Wangen, falls dieser Brief etwas enthüllt, was uns weiterhelfen kann.«
»Das ist selbstverständlich«, sagte Markus geistesabwesend. »Ich habe augenblicklich kein anderes Interesse als diejenigen, die Unrecht getan haben, möglichst schnell auszuschalten und jede weitere Gefahr von Nicola abzuwenden. Ich hoffe, daß Sie mir dies glauben.«
»Ich bin überzeugt davon, Herr Wangen. Ich habe noch viel zu tun.«
Und schon wenig später befand er sich auf der Fahrt nach Basel.
Kommissar Harbig war ein Mann der Tat und der nüchternen Überlegung. Haß beschwört Rachegefühle herauf, das hatte ihn die Erfahrung gelehrt, und Markus Wangen hatte gesagt, daß Nicola die Ronnebergs gehaßt hatte. Von anderen hatte er sogar erfahren, daß sie ihre Mutter gehaßt hätte.
Mochte sie auch jetzt selbst ein Opfer eines Racheaktes geworden sein, so wollte er doch herausfinden, ob sie dies nicht selbst herausgefordert hatte.
Er rief von unterwegs an und fragte, ob Maxi da sei, aber ihm wurde erwidert, daß er sich noch nicht gemeldet hätte. Und er ahnte nicht, wie Maxi auf den Behörden schwitzte und plötzlich sehr viel Verständnis für jene aufbrachte, denen solche Behördengänge nicht erspart blieben.
Aber letztlich konnte er dann doch Erfolge verzeichnen, die ihm die Augen übergehen ließen, und es regte ihn schrecklich auf, daß sein Chef nicht erreichbar war.
*
Markus saß allein im Nebenzimmer von Dr. Waalborgs Kanzlei und las Nicolas Brief zum wiederholten Male.
Lieber Markus, so gern würde ich Dir alles persönlich sagen, aber ich habe nicht den Mut dazu, da morgen alles schon wieder anders aussehen könnte. Ich muß auch dieses letzte Stück eines langen, steinigen Weges allein gehen. Und Du sollst auch nur für Dich allein entscheiden, was geschehen soll, wenn sie auch mich vernichten wollen. Es geht ja nicht um mich, es geht um mein Kind, um Dein Kind, Markus, um unser Kind, um dessen Leben ich fürchten mußte, wenn jemand etwas von seiner Existenz erführe. Alle Erklärungen und Beweise für diese Furcht wird man in dem Dokumentenkoffer finden, den ich heute von der Bank holte und dann Dr. Waalborg anvertraute. Ich habe diesem Brief eine Vollmacht beigefügt, daß er Dir den Koffer übergeben soll, wenn ich ihn am Montag nicht selbst abholen kann.
Aber nun zu meinem Kind, Marc-Nicolas von Stiebenau. Unter diesem Namen ist er geboren und diesen Namen soll er behalten. Du kannst leugnen, sein Vater zu sein, wenn Du diese Entscheidung nicht billigst. Ich habe ihn geboren, ich habe ihn gewollt, und zwei Jahre seines jungen Lebens gehörte er nur mir. Michelle und Paul Racine geben ihn nur heraus, wenn Du diesen Brief vorweist und jenes Medaillon dazu, das ich Dir schenkte, als wir diese traumschönen Tage verlebten, die mir die Kraft gaben, alles zu überstehen, was dann auf mich zukam. Ich wollte Dich nie in eine Gefahr reißen. Du warst der einzige Mensch, den ich liebte, meinen Vater habe ich nur bedauert, bemitleidet, bis ich unseren Sohn in den Armen hielt. Ihm gehört jetzt meine ganze Liebe, und für ihn will ich den Makel von dem Namen Stiebenau nehmen, der diesem anhaftet, seit sich mein Vater das Leben nahm. Ich konnte und wollte dies nicht begreifen und Dich damit nicht belasten, bis ich erfuhr, warum er es tat, warum er keinen anderen Ausweg mehr wußte. Ich weiß, daß das, was ich vorhabe, eine Herausforderung ist, die auch mich das Leben kosten kann, aber dann wird es auch für die Ronnebergs kein Pardon mehr geben. Ich habe mich mit Friedhelm Ronneberg am Samstagmorgen um acht Uhr am Parkplatz unterhalb des Jagdhauses verabredet. Alles andere mußt Du selbst herausfinden, wenn ich Dir diesen Brief nicht selbst geben kann. In diesem Fall kann ich nur wünschen, daß unser Sohn von seinem Vater beschützt wird. In Liebe, nie vergessener Liebe, Deine Nicola.
»O Gott, oh, mein Gott«, stammelte Markus, als Dr. Waalborg leise eintrat.
»Kann ich Ihnen helfen?« fragte der Anwalt.
Markus starrte ihn an. »Sie sollen mir den Koffer geben. Hier ist die Vollmacht.«
»Es ist gut«, sagte der alte Herr. »Ich glaube, wir hätten auch dem Kommissar trauen können. Vielleicht ist es besser, wenn dieser Koffer hierbleibt, Herr Wangen.«
»Ja, vielleicht ist es besser, aber ich möchte sehen, was er enthält.«
»Selbstverständlich. Ich bringe Ihnen den Koffer und lasse Sie allein.«
»Ich möchte gern vorher noch telefonieren«, sagte Markus leise.
»Bitte, jederzeit, Herr Wangen. Ich hoffe, daß Sie mir vertrauen.«
»Nicola hat Ihnen vertraut, das zählt.«
»Sie ist eine mutige Frau«, sagte Dr. Waalborg. »Ich habe in meinem langen Leben niemals eine solche Frau kennengelernt. So schön, so klug und so voller Kraft.«
»Ich fühle mich klein und elend«, sagte Markus müde.
*
Recht müde und voller Zweifel stieg auch Kommissar Harbig vor einer ansehnlichen Villa in Basel aus seinem Wagen. Das erste, was er sah, waren zwei spielende Kinder, vielleicht vier und zwei Jahre jung. Und dann kam ihm eine bildhübsche Frau entgegen.
»Sie wünschen?« fragte sie skeptisch.
Er zeigte seinen Ausweis, und sie wurde blaß. »Nicola von Stiebenau hat hier gewohnt?« fragte er zurückhaltend.
»Was ist mit ihr?« fragte Michelle Racine erregt. »Es ist ihr doch nichts passiert?«
»Bitte erschrecken Sie nicht. Sie befindet sich zur Zeit in einer Klinik. Sie hatte einen Unfall.«
»Ich glaube nicht an einen Unfall«, sagte Michelle bebend. »Bitte, kommen Sie herein.«
Sie rief dann nach einer Mimi, und eine behäbige ältere Frau kam herbeigeeilt. »Kümmern Sie sich um die Kinder, Mimi, ich habe Besuch bekommen«, sagte Michelle.
»Reizende Kinder«, sagte Kommissar Harbig.
»Wir wollen über Nicola sprechen«, lenkte sie sofort ab.
»Darf ich Ihnen Fragen stellen?«
»Bitte.«
»Wie lange wohnte Nicola von Stiebenau hier?«
»Zwei Jahre.«
»Wie lange kennen Sie sie.«
»Zehn Jahre. Wir sind beide im Internat aufgewachsen.«
»Sind Sie verheiratet?«
»Seit fünf Jahren.«
»Und haben zwei Kinder.«
»Ja, ich habe zwei Kinder.«
»Bekam Nicola von Stiebenau Besuch?«
»Nie.«
»War sie öfter verreist?«
»Nein.«
»Wann fuhr sie vorige Woche weg?«
»Am Freitagmorgen, sehr früh.«
»Sie hatte einen Brief bekommen von einer Bank?«
»Ja, so war es wohl. Genaues weiß ich nicht.«
»Sagen wir besser, Sie wollen darüber keine Auskunft geben, aber ich verstehe es. Hat jemand nach ihr gefragt?«
»Manchmal kam ein Anruf, aber Nicola war nie anwesend. Sagen Sie mir, was mit ihr ist?«
»Sie hatte in der Nähe ihrer früheren Heimat einen Unfall, und der alte Tönnies, der Pferdeknecht auf dem Gut war, wurde erschossen.«
»Tönnies? Nicola wollte ihm zum Geburtstag ein Geschenk bringen«, flüsterte Michelle.
»Und an seinem fünfundsiebzigsten Geburtstag, bevor Nicola ihm das Geschenk bringen konnte, wurde er erschossen.«
»Das ist schrecklich, das wird Nicola sehr erschüttern.«
»Sie weiß es noch nicht. Sie ist noch immer bewußtlos. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, Madame Racine, wenn Sie mir etwas mehr Vertrauen schenken würden. Ich bin hier, um Fräulein von Stiebenau zu helfen.«
»Nur sie selbst kann das«, sagte Michelle, »sonst niemand. Sie wird niemanden hineinziehen, den sie gern hat.«
Da kam, mit tränennassem Gesicht, der Kleinere der Buben hereingestürzt. »Mami, wo ist Mami, ich will zu Mami!« schrie er.
Michelle nahm ihn in die Arme. »Sie kommt wieder, Nico, sie kommt bestimmt wieder«, flüsterte sie, und auch ihr rannen die Tränen über die Wangen, als sie den Kommissar hilflos anblickte.
Der Kleine beruhigte sich. Er ließ sich von Mimi hinausführen. »So ist das also«, sagte Kommissar Harbig. »Ich habe nichts gehört und nichts gesehen.«
»Und Sie werden es niemandem sagen?« fragte Michelle flehend.
»Niemandem. Ich gebe Ihnen Nachricht, wenn sich Nicolas Zustand gebessert hat.«
Er neigte sich tief über ihre Hand. »Es wäre aber gut, wenn der Junge vor etwaigen anderen Besuchern nicht nach seiner Mami rufen würde. Das nur als Warnung, Madame Racine.«
»Ich werde mich danach richten«, erwiderte sie. »Morgen kommt mein Mann von seiner Geschäftsreise zurück. Ich werde mich mit ihm beraten. In welcher Klinik kann ich Nicola finden?«
Er sagte es ihr. Aus noch immer feuchten Augen blickte sie ihn an. »Aber Dr. Ronneberg werde ich dort nicht begegnen?« fragte sie.
»Er wird ganz bestimmt von Nicola ferngehalten, das kann ich Ihnen versprechen.«
Und in diesem Augenblick läutete das Telefon. Michelle griff nach dem Hörer und meldete sich. Ihr Gesicht erstarrte. »Nein, Sie irren sich, Nicola war schon lange nicht mehr hier«, erwiderte sie. Dann sah sie Kommissar Harbig an.
»Es war Dr. Ronneberg. Er fragte, ob er Nicola sprechen könne.«
»Das ist aber merkwürdig«, brummte Harbig. »Er weiß doch, was passiert ist.«
»Aber er weiß nicht, daß ich es bereits weiß«, sagte Michelle. »Denken Sie darüber nach, Herr Kommissar.«
»Ich denke über diesen Mann schon unentwegt nach«, gab Harbig zur Antwort. »Sie kennen Herrn Wangen?«
»Nur dem Namen nach«, erwiderte Michelle.
»Sie sind Nicola von Stiebenau eine gute Freundin«, stellte er nachdenklich fest.
»Man findet selten eine Freundin wie sie. Wir, mein Mann und ich, haben ihr unendlich viel zu verdanken.«
»Jedenfalls hat sie sich die richtigen Freunde ausgesucht. Es ist mir eine Beruhigung.«
Und auch von Michelle bekam er zu hören, daß er sehr nett sei, und daß sie sich Kriminalbeamte ganz anders vorgestellt hätte.
»Wir hatten nämlich glücklicherweise noch nie mit solchen zu tun«, sagte sie mit einem Lächeln, das ihren ganzen Charme ahnen ließ.
Auf der Rückfahrt konnte er wieder über vieles nachdenken. Nicola hatte ein Kind, einen Sohn, aber sie hatte es vorgezogen, bei ihrer Freundin zu leben. Nach dem Vater hatte er gar nicht fragen wollen, da er gefühlt hatte, daß Michelle ihm darauf keine Antwort gegeben hätte, wenn sie es überhaupt wußte.
Kommissar Harbig liebte Kinder, und dieses kleine Kerlchen war ein entzückendes Kind. Es hing an seiner Mami. Wie der Kleine geweint hatte, durch und durch war es ihm gegangen. Er konnte seine Kinder auch nicht weinen hören.
Und er sehnte sich nach seiner Familie. Aber als er dann endlich wieder daheim war, war es schon tiefste Nacht. Seine Frau hatte gewartet, die Kinder schliefen schon.
»Maxi hat angerufen. Er muß dir ganz wichtige Dinge sagen«, berichtete seine Frau.
»Heute nicht mehr, wirklich nicht«, murmelte er müde. Er fiel ins Bett und schlief sofort ein.
*
Dr. Behnisch hatte an diesem Tag schon eine spürbare Besserung in Nicolas Befinden verzeichnen können. Und er war froh, dies auch Markus sagen zu können, der ihm völlig verzweifelt erschien.
»Anscheinend will sie uns ihren Namen nennen«, sagte Dr. Behnisch arglos. »Sie hat ein paarmal ›Nico‹ geflüstert. Wenn es auch nicht viel ist, für uns ist es wichtig, daß die Gehirnzellen überhaupt arbeiten.«
Markus hätte ihm Aufklärung geben können, was sie mit »Nico« wohl meinte, aber er tat es nicht. Was er in Nicolas Brief gelesen hatte, beschäftigte ihn unentwegt und verursachte eine so tiefe Qual in seinem Herzen, daß er mit niemandem darüber sprechen konnte.
Aber er war auch nicht fähig, etwas zu unternehmen, bevor er nicht mit ihr sprechen konnte, mit dieser Frau, die er über alles liebte, die ihm alles bedeutete.
Selbst das, was er in dem Koffer an Dokumenten gefunden hatte, war ihm nicht so wichtig, so vielsagend es auch sein mochte.
Nur Nicolas Leben war für ihn wichtig. Er konnte nicht wegfahren, bevor er nicht wußte, daß sie außer Lebensgefahr war, bevor sie ihn nicht angesehen und wenigstens ein paar Worte gesagt hätte, daß sie ihn erkannte, daß sie es immer noch wollte, daß er bei ihr blieb.
Und in ihm war auch Angst, daß doch jemand an sie herankommen könnte, der ihr nach dem Leben trachten könne.
Er saß bei ihr, hielt ihre Hände, streichelte diese mit seinen Lippen und wagte es auch, ihre Wangen zu küssen.
Und endlich, schon wieder sank die Nacht herab, vernahm er einen Laut, und diesmal sagte sie seinen Namen. »Markus«, als spüre sie nun doch seine Nähe.
»Ich bin bei dir, Geliebtes«, sagte er bebend. »Wir werden uns nie mehr trennen.«
»Nie mehr«, flüsterte sie. »Nico, er...«, aber zu mehr reichte ihre Kraft nicht.
»Ich habe deinen Brief gelesen. Ich weiß alles, Liebstes«, sagte Markus. »Es wird alles gut werden, alles!«
Diese Worte schienen ihr nochmals Kraft einzuflößen. »Sie wollen alles, Markus. Sie werden alles töten, was ihnen im Wege steht«, murmelte sie.
»Nichts werden sie noch können«, sagte er. »Gar nichts. Sei ganz ruhig, Nicola.«
Sie sank zurück in die traumlose Tiefe der Bewußtlosigkeit, aber als Dr. Behnisch kam und hörte, daß Markus mit ihr sprechen konnte, atmete er erleichtert auf.
»Das ist gut. Nun wird es aufwärts gehen. Sie brauchen kein so sorgenvolles Gesicht zu machen.«
»Ich habe auch noch andere Sorgen«, sagte Markus. »Ich weiß nicht, was ich am besten tun soll, Dr. Behnisch. Wir haben ein Kind«, fuhr er stockend fort, »und dieses Kind könnte auch in Gefahr sein.«
Dr. Behnisch war sehr erleichtert, daß es für seine Diagnose eine so einfache Erklärung gab, daß Markus der Vater dieses Kindes war, das Nicola geboren hatte, und andere Befürchtungen auszuschließen waren.
»Sprechen Sie mit Kommissar Harbig darüber. Er ist ein sehr vernünftiger Mann.«
»Ich kann mich darauf verlassen, daß Nicola abgeschirmt bleibt?« fragte Markus.
»Das habe ich Ihnen versprochen.«
»Ich muß viel erledigen«, erklärte Markus. »Ich werde Kommissar Harbig gleich anrufen.«
Und der zeigte sich über diesen Anruf hoch erfreut, denn er hatte Markus schon zu erreichen versucht.
»Ich möchte Sie bitten, mit mir nach Gut Stiebenau zu fahren«, erklärte der Kommissar. »Wir haben einiges in Erfahrung gebracht, was von größter Wichtigkeit ist.«
»Ich auch«, sagte Markus. »Ich bin jetzt in der Behnisch-Klinik.«
»Dann hole ich Sie dort ab.«
*
Dr. Großkopf geriet an diesem Morgen in Bedrängnis, denn Dr. Ronneberg war nicht im Krankenhaus erschienen. Eine dringende Blinddarm-operation mußte ausgeführt werden.
»Rufen Sie doch mal an, Mathilde«, sagte er gereizt. »Vielleicht hat er wieder mal die Zeit verschlafen.«
Doch Mathilde kam mit dem Bescheid zurück, daß er pünktlich das Haus verlassen hätte.
Doch Dr. Ronneberg kam nicht, und Dr. Großkopf mußte die Operation selber ausführen. Da er bereits unter schweren Gelenkentzündungen litt, fiel ihm das nicht mehr leicht, aber an diesem Morgen weckte er Erinnerungen an seine besten Zeiten. Schwester Mathilde war sehr zufrieden mit dem Chef.
Auf Gut Stiebenau herrschte dagegen eine sehr gereizte Stimmung.
»Friedhelm wird doch jetzt nicht den Fehler machen, einfach zu verschwinden«, sagte Friedrich Ronneberg zornig.
»Dafür gibt es doch keinen Grund«, sagte seine Frau vorwurfsvoll.
»Da bin ich allerdings nicht so sicher.«
Furcht glomm in ihren Augen auf. »Du wirst unseren Sohn doch nicht verdächtigen wollen, etwas mit dieser Geschichte zu tun zu haben«, sagte sie mit zitternder Stimme.
»Nicola hat mit ihm am Freitag telefoniert, und daraufhin ist er weggefahren. Er hat mir gesagt, daß er Nicola in München treffen wird.«
»Warum hast du mir das nicht gesagt?« fragte sie.
»Ihr wart doch nicht da.«
»Und Friedhelm war bei Cordula.«
Mit finsterer Miene wandte sich der alte Ronneberg ab. »Er hat mir gesagt, daß er Nicola nur kurz gesprochen hätte und mit ihr die Verabredung getroffen hatte, daß sie am Sonntag zu uns kommen solle. Mehr kann ich nicht sagen. Und aus begreiflichen Gründen habe ich das bisher für mich behalten. Schau mich nicht so an. Ich habe mit ihrem Unfall nichts zu schaffen und erst recht nichts mit dem Tod von Tönnies.«
»Und Friedhelm war ein Baby, als wir hierherkamen«, murmelte sie. »Er hat doch keine Erinnerungen. Er weiß nichts.«
»Er weiß mehr, als du denkst. Dafür hat Miriam gesorgt, meine Liebe. Hätten wir sie nur niemals hierher geholt. Dann wäre Dietrich Junggeselle geblieben, und es gäbe auch keine Nicola.«
»Nach all den Jahren wirst du jetzt doch nicht durchdrehen«, sagte sie schrill.
»Ich habe ein ungutes Gefühl, Stella. Dieser Kommissar hat zu sehr auf der Vergangenheit herumgehackt.«
Und damit hatte Kommissar Harbig wohl die beste Eingebung gehabt, wie Markus auf der Fahrt hören sollte.
Aber auch Dr. Behnisch war nicht untätig gewesen. Er hatte indessen ein langes Telefongespräch mit Professor Weiland geführt, der schon seit einigen Jahren ein ruhiges Pensionistendasein führte. Seine Tochter Sabine war längst verheiratet und Mutter von zwei Kindern. Aber Dr. Behnisch erfuhr, warum die Verlobung damals in die Brüche gegangen war. Doch lange konnte er darüber nicht nachdenken, denn seine Frau Jenny kam und sagte ihm, daß Dr. Ronneberg ihn zu sprechen wünsche.
»Der kommt mir gerade recht«, sagte Dieter Behnisch grimmig. »Schwester Martha soll nicht aus dem Krankenzimmer weichen, und die Tür zur Intensivstation wird verschlossen.«
»Drakonische Maßnahmen«, sagte Jenny Behnisch.
»Die notwendig sind. Aber wir müssen ihn hinhalten, bis Harbig zurück ist, Jenny.«
»Dann sei ausnahmsweise mal schön diplomatisch«, meinte sie neckend.
Das war nun nicht gerade Dr. Behnischs Stärke, aber Friedhelm Ronneberg gewann bei der Begrüßung doch den Eindruck, daß man ihn ohne Vorurteile hier empfing, und das hob seine Stimmung.
»Ich möchte mich nach Fräulein von Stiebenaus Befinden erkundigen, Herr Kollege«, sagte Dr. Ronneberg. »Es wird Ihnen bekannt sein, daß sie meine Cousine ist.«
»Tatsächlich? Soweit bin ich nicht informiert«, erwiderte Dr. Behnisch ruhig. »Fräulein von Stiebenau liegt auf der Intensivstation. Ihr Befinden ist unverändert ernst.«
»Sie ist noch nicht zum Bewußtsein gekommen?« fragte Ronneberg.
»Nein.«
»Wurde sie besucht?«
»Nein. Ich kann zur Zeit noch keine Besuche gestatten. Herr Wangen muß sich auch gedulden.«
»Er darf keinesfalls zu ihr«, sagte Ronneberg hastig. »Ich möchte Ihnen reinen Wein einschenken, Herr Kollege. Herr Wangen ist bestimmt nicht interessiert, daß Nicola am Leben bleibt. Er ist an Nicolas schwerem Unfall, wenn man diesen überhaupt als Unfall bezeichnen möchte, nicht schuldlos. Sie war auf der Flucht vor seinen Belästigungen.«
Donner und Doria, dachte Dr. Behnisch, wenn ich nicht bereits so gut Bescheid wüßte, würde ich es ihm sogar abnehmen.
»Das ist allerdings ein schwerwiegender Verdacht, Herr Kollege«, sagte er mit äußerster Beherrschung. »Sie haben der Polizei davon Mitteilung gemacht?«
»Ja, natürlich nehmen die das sehr genau und suchen nach Zeugen. Aber es gibt wohl keine, oder Herr Wangen hat sie gekauft.«
Ein raffinierter Bursche, dachte Dr. Behnisch, und es war ihm schon fast Gewißheit, daß Ronneberg zu solchen Mitteln griff, um seine eigene Haut zu retten. Ein Frösteln kroch über seinen Rücken bei dem Gedanken, einem Mörder gegenüberzusitzen, der noch dazu Arzt war. Das war das Schlimmste. Aber er wußte ja inzwischen von Weiland, daß Ronneberg keine Skrupel kannte, wenn er etwas erreichen wollte.
»Sie scheinen mehr zu wissen als die Ermittlungsbeamten«, sagte er mit erzwungener Ruhe.
»Ich habe selbst ermittelt. Es geht schließlich um Nicola. Herr Wangen hat bereits in der Vergangenheit alles getan, um unser gutes Verhältnis zu zerstören, aber letztendlich bräuchten wir wohl Nicolas Aussage, um ihn überführen zu können.«
»Damit ist noch lange nicht zu rechnen«, sagte Dr. Behnisch. »Es steht zu fürchten, daß die Kopfverletzungen so schwerwiegend sind, daß eine Amnesie die Folge sein wird, wenn nicht Schlimmeres.« Gott verzeih mir, dachte er dabei, aber es war die einzige Möglichkeit, Ronneberg in Sicherheit zu wiegen.
»Das wäre wirklich ganz tragisch, außerordentlich tragisch«, sagte der. »Aber vielleicht gestatten Sie mir, mich mit Nicola zu befassen. Mich kennt sie ja, und als Arzt weiß ich genau, wie man mit solchen Patienten umgeht.«
»Nein, das kann ich nicht gestatten, Herr Kollege. Hier trage ich die Verantwortung, auch für meine Patienten. Sollte Fräulein von Stiebenau zum Bewußtsein kommen und den Wunsch äußern, Sie zu sehen, wäre es etwas anderes.«
»Sie wollte vor dem Unfall mit mir sprechen. Sie hatte mir etwas Wichtiges mitzuteilen, sagte sie, aber Herr Wangen hat dieses Treffen wohl zu verhindern gewußt.«
»Dann kann ich Ihnen nur raten, Kommissar Harbig dies alles genauso zu schildern. Er ist ein gewissenhafter Mann und wird Herrn Wangen gewiß nicht wegen seiner gesellschaftlichen Stellung schonen.«
»Dürfte ich Nicola wenigstens sehen?« fragte Ronneberg.
»Das bringt gar nichts, Herr Kollege. Ich sagte schon, daß sie auf der Intensivstation liegt.«
Ronnebergs Mienenspiel wechselte. »Sie verübeln mir die Bemerkung hoffentlich nicht, daß ich eine so verhältnismäßig kleine Klinik nicht als den geeigneten Aufenthalt für einen so schweren Fall betrachte.«
»Vermutungen stehen Ihnen frei«, sagte Dr. Behnisch kühl. »Sie bekommen Bescheid, falls Fräulein von Stiebenau in der Lage ist, Sie zu empfangen und Ihren Besuch auch wünscht. Mehr habe ich nicht zu sagen.«
»Ich wollte Sie keinesfalls kränken«, lenkte Ronneberg schnell ein. »Ich wollte damit nur sagen, daß die Bedingungen an unserem Krankenhaus die gleichen wären.«
»Das kann ich nicht beurteilen, aber wahrscheinlich wäre die Sicherheit von der Patientin nicht gewährleistet gewesen.« Nun war ihm doch der Gaul durchgegangen. Aber wenn es um seine Klinik und seine Ehre ging, kannte Dr. Behnisch keine Hemmungen.
Für ein paar Sekunden rang Ronneberg allerdings auch nach Worten.
»Wie darf ich das verstehen?« fragte er dann heftig.
»Wie es gemeint war. Ich habe gehört, daß am gleichen Tag ein alter Mann getötet wurde, den Fräulein von Stiebenau besuchen wollte. Aber die Aufklärung überlassen wir besser der Polizei, die ja auch befürwortet hat, daß die Patientin hierher verlegt wurde.« Dr. Behnisch erhob sich. »Sie verstehen, daß ich mich jetzt um meine Patienten kümmern muß.«
»Damit wir uns recht verstehen, Herr Kollege, ich wollte Sie keineswegs kränken«, mit diesen Worten verabschiedete sich Ronneberg zögernd.
Dr. Behnisch schickte ihm einen verächtlichen Fluch nach. Er bedauerte es, im Interesse seiner Patientin nicht andere Dinge sagen zu können. Aber er mußte vorsichtig sein. Dieser Ronneberg war ein schlauer Bursche. Er war sogar so schlau gewesen, seine Doktorarbeit von einem anderen schreiben zu lassen, ohne daß es sofort bemerkt wurde. Und als Weiland dahinterkam, war er durchaus nicht auf geneigte Ohren gestoßen, wie Dr. Behnisch heute von dem Professor erfahren hatte. Zum Glück hatte er wenigstens seine Tochter vor einer Heirat bewahren können, doch das hatte auch noch andere Gründe gehabt, denn Sabine war dahintergekommen, daß Friedhelm Ronneberg ein intimes Verhältnis mit seiner lebenslustigen Tante hatte. So manches konnte Dieter Behnisch also auch dazu beitragen, um das Bild abzurunden, das sich schon manch einer über Dr. Ronneberg machte.
Aber was war das schon im Verhältnis dazu, was Kommissar Harbig jetzt wußte, und was auch Markus Wangen inzwischen erfahren hatte.
Als sie auf dem Gut eintrafen, wollte sich Stella Ronneberg zurückziehen, doch der Kommissar forderte sie recht energisch auf, der Unterredung beizuwohnen und auch die Tochter Marina herbeizuholen.
»Marina ist nicht anwesend«, sagte Friedrich Ronneberg.
»Und der Herr Doktor auch nicht?« fragte der Kommissar. »Er ist nicht im Krankenhaus erschienen.«
»Das ist uns unerklärlich«, sagte Friedrich Ronneberg. »Man bekommt es mit der Angst, daß hier ein Verrückter sein Unwesen treibt.«
»Martl ist auch seit gestern verschwunden«, warf Stella ein.
»Er befindet sich in polizeilichem Gewahrsam«, erklärte Kommissar Harbig.
»Hat er Tönnies getötet?« fragte Friedrich Ronneberg hastig, und es klang fast erleichtert.
»Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen«, erwiderte der Kommissar. »Es gilt jetzt noch einiges zu klären, was Ihre Vergangenheit betrifft, Herr Ronneberg. Wir haben da einiges erfahren, was Ihren Darstellungen widerspricht.«
Ronnebergs sonst noch recht frisches Gesicht nahm eine grünliche Färbung an, und Stella zitterte wie Espenlaub.
»Es handelt sich um amtliche Ermittlungen. Es dürfte Ihnen schwerfallen, diese zu widerlegen«, sagte Kommissar Harbig ruhig.
»Worum geht es?« fragte Ronneberg mühsam.
»Ich werde vorlesen«, sagte Harbig. »Sie gaben an, große Güter in Pommern besessen zu haben. Aus den amtlichen Unterlagen geht hervor, daß Sie Gutsverwalter bei dem Grafen Bornstein waren, der wiederum mit Arved von Stiebenau befreundet war. Dieser wiederum wurde vor seinem Front-einsatz mit der Schwester des Grafen Bornstein kriegsgetraut. Dorothee von Stiebenau, geborene Gräfin Bornstein, brachte in den Tagen, als der große Treck begann, einen Sohn zur Welt. Es war eine schwere Geburt. Niemand glaubte an ihr Überleben. Graf Bornstein geriet in Kriegsgefangenschaft. Arved von Stiebenau fiel an der Ostfront. Sie machten sich mit Ihrer Familie auf den Weg nach Westen und nisteten sich hier ein. Sie erzählten dem Baron von Stiebenau schöne Märchen von einer engen Freundschaft, von ihren verlorenen Besitzungen, und dieser leidgeprüfte Mann half Ihnen.«
»Woher wollen Sie das wissen?« fragte Ronneberg mühsam.
Harbig faßte ihn scharf ins Auge. »Gottes Mühlen mahlen langsam, manchmal Jahrzehnte«, sagte er kühl. »Der Graf Bornstein hatte einen treuen Burschen, der in russische Kriegsgefangenschalt geriet, aber überlebte. Und getreu seines Schwures, dem er den Grafen gegeben hatte, suchte er nach dessen Schwester. Er fand sie unter armseligen Verhältnissen und schwerkrank mit ihrem achtjährigen Sohn in der alten Heimat. Er hatte den Mut gehabt, sich dorthin durchzuschlagen. Bis dahin waren Dorothee von Stiebenaus Versuche fehlgeschlagen, etwas über das Schicksal ihres Mannes und ihres Bruders zu erfahren, vergeblich gewesen. Sie lebte unter dem Namen Steben mit ihrem Sohn Arved-Dietrich und hatte sich als Köchin auf dem ehemals elterlichen Gut verdingt. Die, die geblieben waren, hielten zu ihr. Sie kannten den Burschen des Grafen Bornstein, Herr Ronneberg.«
»Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden, wer diese Geschichte erfunden hat«, stieß er mühsam hervor.
»Der Bursche hieß Karsten Badenski und war der Bruder von Stella und Miriam Badenski. Das heißt, Miriam hieß damals ja noch Marianne.«
»Sie wissen alles«, schrie Stella auf, »sie wissen es, Karsten lebt.«
»Ja, er lebt, Frau Ronneberg. Er kam als Rentner vor einigen Monaten nach Westdeutschland und begann Nachforschungen nach dem Verbleib seiner Angehörigen anzustellen, und dieser Umstand half uns so rasch, den Tatsachen auf den Grund zu kommen. Karsten Badenski adoptierte den Sohn von Dorothee und Arved von Stiebenau, um ihm eine Ausbildung zu ermöglichen. Er fand eine Stellung im anderen Teil Deutschlands, heiratete eine tüchtige Frau und war Arved ein ebenso guter Vater wie seinen zwei weiteren Kindern, aus der so spät geschlossenen Ehe. Ein ehrbarer Mann, der Ihnen ein Beispiel sein sollte. Sie können jetzt alles abstreiten, aber es wird zu einer Gegenüberstellung kommen. Arved von Stiebenau, der noch keine Ahnung von seiner Herkunft hat, lebt unter dem Namen Badenski schon einige Jahre in Österreich. Leider hat Baron Dietrich von Stiebenau versäumt, Ihre Angaben zu überprüfen und hat sich damit zufriedengegeben, daß sein Bruder den Heldentod gestorben ist, wie man es nannte. Und die Nachricht über Arveds Eheschließung hat ihn nie erreicht.«
»Es waren doch so schreckliche Zeiten«, weinte Stella auf. »Wir hatten ein kleines Kind. Und hier war nichts zerstört. Er saß allein auf dem großen Gut, und wir haben doch für ihn gearbeitet.«
»Halt den Mund, Stella!« schrie Friedrich Ronneberg seine Frau mit sich überschlagender Stimme an, und dann warf der plötzlich die Arme empor und sackte zusammen.
»Und jetzt haben Sie ihn auch noch umgebracht«, stieß Stella hervor.
Markus Wangen hatte bisher kein Wort gesagt. Jetzt war er schneller als Harbig. »Er lebt«, sagte er. »Schnell ins Krankenhaus.«
Und so geschah es, daß Friedrich Ronneberg in das Krankenhaus kam, in dem sein Sohn Chefarzt werden wollte. Und alles, was noch zu sagen gewesen wäre, blieb vorerst ungesagt.
*
»Auch das noch«, war Dr. Großkopfs Kommentar, als Friedrich Ronneberg eingeliefert wurde. Er schien nochmals um Jahre gealtert.
»Hat sich der Sohn noch nicht gemeldet?« fragte Harbig heiser.
»Nein, aber die Assistenzärzte tun ihre Arbeit sehr gut«, kam die bissige Antwort.
Und dann war zumindest Friedrich Ronneberg vorerst aller Sorgen ledig.
Markus Wangen und Kommissar Harbig gingen in den Dorfkrug.
»Eine abscheuliche Geschichte«, sagte Markus tonlos.
»Ich möchte nicht so lange mit einem schlechten Gewissen leben«, sagte der Kommissar. »Aber zumindest scheint seiner Frau das Gewissen erst jetzt zu schlagen. Und dreißig Jahre mußten vergehen, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Woran krankt unsere Gesellschaft eigentlich, Herr Wangen? Wissen Sie darauf eine Antwort?«
»Ich bin erst lange nach dem Krieg geboren, und wie auch immer die Einstellung meines Vaters zum Leben gewesen sein mag, er sagte immer, daß ich hoffentlich solches nie erleben möge. Ich habe öfter gelesen, unter welchen dramatischen Umständen manche, die sich lange vergeblich gesucht hatten, dann zusammengeführt wurden. Männer hatten inzwischen andere Frauen, Frauen andere Männer, und sie wurden plötzlich hart mit der Vergangenheit konfrontiert und mußten dann Entscheidungen treffen, die schmerzhaft waren. Daß Nicola jetzt auch davon betroffen ist, erschüttert mich schwer. Es gibt also wieder einen Arved von Stiebenau.«
»Aber es ist noch lange nicht gesagt, daß er versessen auf sein Erbe ist«, sagte Kommissar Harbig. »Mir tut dieser brave Karsten Badenski leid, für den die ganze Wahrheit schrecklich sein muß. Ich werde mich selbst um den Mann kümmern.«
»Sie können das mir überlassen, Herr Harbig. Mich hat mein ererbtes Geld bisher nicht glücklich gemacht, aber es kann so manche Wunde schließen. Ich meine, daß dieser Mann zumindest dafür reich entschädigt werden muß, was er für Dietrich von Stiebenaus Neffen getan hat.«
»Und Friedrich Ronneberg hat der Gedanke, wieder vor dem Nichts zu stehen, umgeworfen.«
»Kann man dafür einen Mord begehen?« fragte Markus.
Kommissar Harbig starrte in sein Bierglas. »Was könnte Tönnies gewußt haben?« fragte er.
Markus sah ihn mit weiten Augen an. »Vielleicht erkannte er nur die Lederjacke, die mir gehörte, und die ein anderer trug. Und damit hatte dieser andere nicht gerechnet.«
»Ja, so könnte es gewesen sein. Und wir beide denken, daß dieser andere Friedhelm Ronneberg war.«
»Es müßte zu beweisen sein«, sagte Markus. »Nicola hat in ihrem Brief geschrieben, daß sie sich mit ihm treffen wolle, um acht Uhr am Samstagmorgen beim Stellplatz unterhalb des Jagdhauses. Warum sie diesen Platz gewählt hat, weiß ich nicht, noch nicht. Vielleicht hat er ihn vorgeschlagen, und er hatte sich meine Jacke schon geholt, bevor er Nicola traf, und sie kannte diese Jacke auch.«
»Sie können gut kombinieren, Herr Wangen.«
»Ich habe sehr viel nachgedacht. Ich weiß nur noch nicht, warum Nicola ausgerechnet mit Friedhelm ein Gespräch suchte.«
»Sie hat gelesen, was ihr verzweifelter Vater hinterlassen hat. Er war damit erpreßt worden, daß Friedhelm angeblich der uneheliche Sohn seines Bruders sein sollte, den die Ronnebergs dann als ihren Sohn ausgaben, der bei der Geburt gestorben sein sollte.«
»Das stimmt doch alles nicht«, sagte Markus. »Sie haben alles erlogen, um sich Vorteile zu verschaffen.«
»Vielleicht hegte Nicola doch Zweifel, Herr Wangen. Die junge Generation hat nicht mehr die Komplexe wie die Vorkriegsgeneration. Es könnte doch sein, daß Nicola Friedhelm eine Chance geben wollte. Ich bin sogar zu der Überzeugung gelangt, daß sie die Ronnebergs nicht vernichten wollte. Sie wollte sich mit ihnen auseinandersetzen, die ganze Wahrheit auf den Tisch bringen. Sie dachte nicht daran, daß man aus dem Hinterhalt auf sie lauern könnte. Und sie wußte nichts von dem, was wir inzwischen herausgefunden haben. Nichts von Karsten Badenski, nichts davon, daß Arved verheiratet war und einen Sohn hatte, von dessen Geburt er selbst nichts mehr erfuhr. Sie wußte nur aus den Aufzeichnungen ihres Vaters, daß er seinem angeblichen Neffen doch noch zu seinem Recht verhelfen wollte, ohne das Ansehen seines Bruders und seines eigenen Namens beschmutzt zu sehen. Diese Generation, zu der ich mich auch schon nicht mehr zugehörig fühle, hatte andere Ehrbegriffe als wir. Die Stiebenaus sind alter Adel.«
»Der Baron ist doch auf den Gedanken gekommen, daß er hintergangen worden sei. Warum hatte er nicht den Mut, solche Nachforschungen anzustellen wie Sie.«
»Er war alt und krank und zermürbt. Er wollte Nicola noch so gut wie nur möglich absichern, obgleich ihm möglicherweise Zweifel kamen, ob sie überhaupt seine Tochter sei.«
Markus starrte ihn an. »Dann kann ich ja nur von Glück sagen, daß sie meinen Vater erst so spät kennenlernte, daß mir keine Zweifel mehr kommen können, daß er Nicolas Vater sein kann«, sagte er tonlos. »Das wäre wohl das Allerschlimmste, was uns passieren könnte.«
»Ich glaube nicht, daß ein Zweifel daran besteht, daß Nicola die Tochter des Barons ist«, sagte Harbig. »Mag diese Miriam ein Teufelsweib gewesen sein, aber ihre Sicherheit hat sie sich mit dem Kind erkauft. Erst später hat sie dann dieses lockere Leben geführt. Man muß es den Ronnebergs lassen, daß sie alles durchdacht hatten. Sie haben sich erst ganz das Vertrauen des Barons errungen und wahrscheinlich recht fleißig gearbeitet, um auch Friedenau hochzubringen. ›Falls Arved wiederkäme, wollten sie ihm ihre Freundschaft bewiesen haben‹, so haben sie es doch gesagt, und so hat es der Baron niedergeschrieben. Und er hat ja auch gehofft, daß sein Bruder doch heimkehren würde, nachdem viele zurückkamen, die man schon tot wähnte. Ja, ein wahres Wort hat Frau Ronneberg gesagt. Es waren schreckliche Zeiten. Ich kann mich daran auch nicht mehr erinnern. Ich war ein Junge. Für mich war die Kindheit nur ein einziges Abenteuer. Und wir sollten auch bedenken, daß Miriam den fast doppelt so alten Mann in ihren Bann zwang, daß er lange Zeit von dieser jungen Frau fasziniert war und ihr jeden Wunsch erfüllte, ohne nachzudenken, daß auch dies schon auf Erpressung hinausging, oder um es noch deutlicher zu sagen, daß man ihn ausbeutete, bis er vor dem Nichts stand. Da erst begann er wohl nachzudenken, als die Ronnebergs bereits viel mehr besaßen als er selbst. Er war kein Kaufmann, und schon manch großer Mann ist wegen einer Frau vor die Hunde gegangen. Ich sehe das alles sehr realistisch. Aber was die Ronnebergs diesem feinen Menschen angetan haben, finde ich unverzeihlich.«
»Schlimmer könnte sein, was sie nach seinem Tode noch getan haben«, sagte Markus.
»Aber die größte Strafe könnte es sein, daß nun Karsten Badenski seiner noch überlebenden Schwester gegenüberstehen wird.«
»Ob es für ihn nicht viel schlimmer wäre?« überlegte Markus. »Was hat dieser Mann alles durchgemacht, und er hat dennoch nicht gezögert, sein Versprechen einzulösen. Man sollte ihn nicht mit so harten Tatsachen konfrontieren, Herr Harbig.«
»Daß Sie so denken würden, habe ich nicht einkalkuliert«, sagte Harbig. »Wenn der Fall geklärt ist, können Sie ja selbst entscheiden. Der Lösung sind wir schon um vieles nähergekommen. Für mich kommen nur zwei Täter in Frage. Entweder war es der Arzt oder es war sein Vater, der bis zuletzt mit allen Mitteln das festhalten wollte, was er ergaunert hatte.«
»Oder es waren beide, sich völlig einig«, sagte Markus heiser, »bereit, das Letzte zu wagen, auch einen Mord.«
Er sprang auf. »Ich rufe Dr. Behnisch an.«
*
Dr. Norden war bei Dr. Behnisch, als der Anruf durchgestellt wurde.
»Warte noch«, sagte Dr. Behnisch leise, als er Markus’ Stimme vernahm.
»Ja, Ronneberg war hier, aber ich habe ihn abgewimmelt«, sagte er dann. »Sie brauchen keine Sorgen zu haben, Herr Wangen. – Na, hoffentlich kann er noch etwas sagen.«
»Wer soll was sagen?« fragte Daniel, als Dieter Behnisch den Hörer aufgelegt hatte.
»Ronneberg hatte einen Schlaganfall, der alte Ronneberg. Die Angelegenheit spitzt sich zu. Aber es kann leicht sein, daß unser unguter Kollege das Weite gesucht hat.«
»Doch nur dann, wenn er Dreck am Stecken hat«, sagte Daniel.
»Sauber ist der Stecken bestimmt nicht. Ich glaube, wir werden noch sehr viel erfahren.«
»Möglichst bald. Ich mag es gar nicht, wenn ich durch böse Dinge abgelenkt werde.«
*
Stella Ronneberg fiel die Aufgabe zu, ihre Tochter Marina mit den nackten, bösen Tatsachen vertraut zu machen. Freilich stellte sie es im für sie günstigsten Licht dar und Marina war auch gar zu gern bereit, über die Schuld, die ihre Eltern auf sich geladen hatten, hinwegzusehen, aber es jagte ihr Furcht ein, was nun aus ihnen werden sollte. Stella lud alle Schuld auf Miriam ab.
»Sie hat es zu weit getrieben, Marina. Wir wollten das doch gar nicht, aber sie hat immer gedacht, daß Dietrich bald und vor ihr sterben würde. Er hatte doch dieses Nierenleiden und zudem ein schwaches Herz.«
»Friedhelm hätte sich geschickter verhalten sollen. Er ist doch ein gutaussehender Mann, und er hätte Nicola heiraten sollen, oder ihr wenigstens ein Kind anhängen können, dann hätte sich alles von selbst geregelt«, sagte Marina. »Aber er mit seinen Weibergeschichten und ausgerechnet Miriam mußte es auch noch sein, als ob er sonst nicht genug gehabt hätte.«
»Sie war hinter ihm her. Ja, es hätte nicht so zu kommen brauchen. Ich setze jetzt meine Hoffnung auf Karsten. Er war immer ein gutmütiger Bursche. Er wird daran denken, daß wir auch Kinder haben, und wir werden ihn teilhaben lassen an allem. Man wird ihm zugute halten, daß die lange Kriegsgefangenschaft sein Erinnerungsvermögen getrübt hat.« Sie machte eine kleine Pause. »Und wenn Friedrich stirbt – ja, es wäre das beste, wenn er sterben würde, wenn er vorher noch alle Schuld auf sich nehmen würde. Sippenhaftung gibt es jetzt doch nicht mehr.«
»Ich sehe auch nicht ein, warum wir büßen sollen, Friedhelm und ich. Man kann uns doch nicht die ganze Zukunft zerstören. Nicola kann nicht einfach wegwischen, daß ihre Mutter deine Schwester war, daß wir verwandt sind. Und schließlich hat Onkel Dietrich doch sein Testament freiwillig gemacht.«
Ja, dieses Glaubens war sie, und ihr konnte man wohl kaum diesbezüglich ein Mitverschulden zuschieben, denn ihr war die Wahrheit verschwiegen worden, und sie war immer noch zu naiv, um sich ihr eigenes Urteil zu bilden.
Marina, die das gleiche leere Puppengesicht hatte wie ihre Mutter, war jetzt schon bereit, ihre Haut zu retten, ganz gleich, was ihren Eltern angekreidet würde. Aber sie war doch schlau genug, sich nicht mit ihrer Mutter anzulegen.
»Ihr habt doch immer einen Haufen Bargeld im Hause gehabt, Mama«, sagte sie vorsichtig. »Meinst du nicht, daß es besser wäre, es wegzuschaffen? Für alle Fälle, meine ich.«
»Vielleicht wäre es gut«, sagte Stella, »aber wer sollte es tun?«
»Ich.«
»Du kannst doch jetzt nicht weg.«
»Wieso nicht? Was liegt gegen mich vor?«
»Ich möchte lieber noch warten, was Friedhelm entscheidet«, sagte Stella.
»Gegen ihn hegen sie doch einen Verdacht«, sagte Marina, und ihre Augen wurden ganz eng. »Pack das Geld ein. Ich fahre dich zur Klinik. Man wird es sowieso erwarten, daß du dich um deinen sterbenskranken Mann kümmerst, und ich fahre weiter. Ich weiß schon, wohin ich das Geld bringen kann.«
»Wohin?«
»Nach Lindau. Von dort aus sind wir gleich in der Schweiz. Ich werde die hübsche Ferienwohnung mieten, die wir uns angeschaut haben, Mama, und ich kann sagen, daß ich das Geld im Casino gewonnen habe, wenn jemand mich fragen sollte, woher ich es habe.«
Wenn es um Geld ging, hatte Marina schon Ideen, so denkfaul sie sonst auch war. Stella empfand für ihre Tochter augenblicklich sogar Bewunderung. Und dann schien es auch so, als würde Marinas Plan erfolgversprechend sein.
Überall konnte Kommissar Harbig nicht sein. Friedrich Ronneberg war nicht ansprechbar, und nun hatte er erfahren, daß sein Sohn die Unverfrorenheit aufgebracht hatte, in der Behnisch-Klinik vorzusprechen.
Zurückgekehrt war er nicht. Wichtig war es, jetzt ihn aufzuspüren. Und sehr wichtig war es auch, Karsten Badenski nach München zu holen und ihn dann seiner Schwester gegenüberzustellen.
Mit Martl, der sich unter dem Polizeischutz recht wohl zu fühlen schien, hatte er auch gesprochen, aber der bedauernswerte, geistig schwerbehinderte Mann konnte sich nicht klar ausdrücken. Alles was man aus ihm herausbrachte, war, daß er manchmal auf Hasen geschossen hätte, aber nie auf einen Menschen, und das konnte man ihm auch glauben. Er war den Ronnebergs nicht ergeben, auch das brachten sie aus ihm heraus, aber er konnte doch dort wohnen und essen, und mehr erwartete er wohl ohnehin nicht vom Leben.
Markus Wangen überließ alles Weitere gern dem Kommissar. Er wollte keinem der Ronnebergs weiterhin begegnen. Er wollte bei Nicola sein, und er wünschte sich auch sehnlichst, endlich seinen Sohn zu sehen. Doch Harbig hatte ihm abgeraten, sofort nach Basel zu fahren.
Nach München zurückgekehrt, telefonierte er mit Michelle Racine. Sie war zuerst kühl und auch zurückhaltend und schien Zweifel zu hegen, ob er wirklich Markus sei.
Er sprach von Nicolas Brief und sagte ihr, daß er wisse, daß Kommissar Harbig bei ihr gewesen sei. Da wurde sie zugänglicher. Den Kindern gehe es gut, sagte sie, und sie würden ständig unter Aufsicht stehen. Es wäre sicher nicht gut, Nico jetzt schon aus seiner gewohnten Umgebung zu reißen, auf die er fixiert sei, und allein Nicola dürfe entscheiden, was weiterhin geschehen sollte. Aber mit erstickter Stimme erkundigte sie sich dann nach Nicolas Befinden.
»Ich werde jetzt zu ihr fahren. Es geht ihr etwas besser«, erklärte Markus. Und er fügte hinzu, daß er ihr und ihrem Mann sehr dankbar sei, daß sie Nicola so beigestanden hätten. Er würde es ihnen tausendfach vergelten.
*
Seinen Assistenten Maxi Strasser hatte Kommissar Harbig zu Cordula Lennert geschickt, die im Präsidium angerufen hatte, um eine Erklärung abzugeben. Anscheinend hatte sie kalte Füße bekommen.
Höchstpersönlich bemühte sich Harbig darum, Karsten Badenski an die Strippe zu bekommen, aber er erfuhr, daß er sich jetzt bei seinem Sohn im Salzkammergut aufhalten würde.
Nun, das war nicht weit, und es lohnte sich wohl, sich selbst auf den Weg zu machen, falls ein Anruf keinen Erfolg haben würde. Doch dieser hatte Erfolg. Karsten Badenski erklärte sich sofort bereit, nach München zu kommen und auch seinen Sohn Arved und seine Schwiegertochter mitzubringen.
Leider konnte Kommissar Harbig nicht hören, welche Debatte sich dann zwischen diesen drei Menschen entwickelte.
»Was wollen wir denn in München, Vater?« fragte Arved.
»Familienangelegenheiten klären, über die ich bisher nicht gesprochen habe. Ein bißchen bange ist mir schon davor, aber bevor ich mal die Augen schließe, sollst du doch alles erfahren, Arved. Und selbstverständlich muß auch Dorle Bescheid wissen. Ich halte es für ein gutes Omen, daß sie den gleichen Vornamen wie deine richtige Mutter hat. Daß ich dich adoptiert habe, weißt du ja.«
Und dann erzählte er ihnen die Geschichte, die er auch über viele Jahre als sein Geheimnis bewahrt hatte.
Ein wenig ängstlich blickte er das Ehepaar an. »Und was soll sich jetzt ändern, Vater?« fragte Arved. »Du bist mein Vater. Wir möchten, daß du bei uns bleibst. Dorle will es genauso wie ich. Wir haben unser gutes Auskommen, und ich bin froh, daß Dorle einem Arved Badenski ihr Jawort gegeben hat, und nicht darauf aus war, einen Baron zu heiraten. Die Zeiten sind doch vorbei, als man noch vor Titeln gekatzbuckelt hat.«
»Ihr habt auch Kinder«, sagte Karsten Badenski. »Ich sehe nicht ein, daß meine Schwester Stella Nutznießerin dessen ist, was euch eigentlich zusteht. Es soll schon geklärt werden, das bin ich meinem Hauptmann schuldig, dem ich ein treuer Bursche war. Ich war dabei, als er nach der schweren Verwundung die Augen für immer geschlossen hat. Er hat gesagt, daß ich sein bester Freund gewesen sei.« Sein Blick wanderte zum Fenster hinaus, zum Himmel empor. »Ich meine, es hat mich alles überstehen lassen, weil ich immer daran dachte, worum er mich gebeten hatte. Und Gott war bei mir, auf meiner Seite. Daß ich so lange geschwiegen habe, mögest du mir verzeihen.«
»Es gibt nichts zu verzeihen. Du bist ein guter Vater«, sagte Arved. »Ich habe nicht vergessen, was Mama sagte, als sie von all ihren Schmerzen erlöst wurde. Ich weiß dich in den besten, treuesten Händen, mein Junge.«
Da wurden Karsten Badenskis Augen feucht. »Es hat lange gedauert, bis ich mein Versprechen ganz einlösen kann«, sagte er leise, »aber nun ist es soweit. Ihr könnt selbst entscheiden. Mir wird wohler sein, wenn alles geklärt ist.«
»Dann fahren wir mit Vater«, sagte Dorle. »Peter und Karin können bei meinen Eltern bleiben.« Sie schenkte ihrem Mann ein schüchternes Lächeln. »Nun weißt du wenigstens, warum du unbedingt Landwirt werden wolltest, Arved.«
»Daß es möglich wurde, habe ich nur Vater zu verdanken«, sagte Arved und legte seine Hände auf Karstens Schulter. »Und du wirst mein Vater bleiben.«
Und so fuhren sie nach München, ein Mann von sechsundsechzig Jahren, mit einem vom Leid hart geprägten Gesicht, ein jüngerer, der gerade sechsunddreißig geworden war, und Dorle, die fünf Jahre jünger war als ihr Mann, die jetzt doppelt stolz war, daß ihr Mann sein Leben gemeistert hatte, ohne von seiner adligen Herkunft zu wissen.
»Warum hat meine Mutter nie unseren richtigen Namen erwähnt?« fragte Arved nun doch gedankenvoll, während er umsichtig den Wagen steuerte.
»Um dein Leben nicht zu gefährden, Arved. Es waren sehr schlimme Zeiten. Die Großgrundbesitzer hatten keine Rechte mehr. Wer sich hinter einem anderen Namen verschanzen konnte, hatte eine Überlebenschance. Sie wurden damals als Ausbeuter betrachtet. Es mag in manchen Fällen auch zugetroffen haben, aber die
bowsteins waren nicht so und dein Vater auch nicht. Und deshalb wurde deine Mutter von niemandem verraten. So manch einer ist in eine andere Haut geschlüpft, um nur zu überleben, aber einige scheinen es ganz schön verstanden zu haben, sich gesundzustoßen.«
»Man sagt ja, daß die Haut einem näher ist als das Hemd, aber du warst nie so, Vater«, sagte Arved nervös. »Du hast das Recht auf einen ruhigen Lebensabend. Laß uns jetzt mal dafür sorgen.«
*
Als sie München erreichten, war Marina Ronneberg bereits in Lindau, und sie war in Hochstimmung, weil sie allem, was unangenehm war, entronnen zu sein glaubte. Sie hatte eine Tasche voll Geld, es mochten an die siebzigtausend Euro sein. Marina dachte nicht darüber nach, woher das Geld kam, wie es beiseite geschafft werden konnte. Ihr war es auch völlig gleichgültig, daß ihre Mutter jetzt doch allerhand auszuhalten hatte, was immer dazu auch der Grund war.
Im Krankenhaus hatte sie noch erfahren, daß der Zustand ihres Vaters äußerst besorgniserregend sei, aber das stimmte sie keineswegs traurig. Das einzige, was ihr zu schaffen machte, war die Tatsache, daß sie nicht mit ihrem Bruder sprechen konnte. Sie fürchtete ihn, nur ihn. Er hatte sie, die um sieben Jahre jüngere, immer als ein lästiges Übel betrachtet, er hatte sie tyrannisiert und manchmal geradezu sadistisch gequält. Er hatte sie in den dunklen Keller gesperrt, sie schon als knapp Vierjährige an einen Baum gefesselt, und er hatte sie brutal geschlagen, wenn sie sich ihm zu widersetzen versuchte, als sie größer geworden war. Und er konnte wie gedruckt lügen, wenn es galt, sich zu verteidigen. Das konnte sie allerdings auch. Aber insgeheim hatte sie doch immer auch eine gewisse Bewunderung für ihn gehegt, weil er mit jeder Situation fertig wurde.
Zum erstenmal in ihrem Leben hatte sie eine Entscheidung getroffen, und diese war von ihrer Mutter gutgeheißen worden, ohne daß Friedhelm gefragt wurde. Das allein vermittelte ihr doch das Gefühl eines Triumphes.
Sie fühlte sich nicht mehr als das Dummchen, als das sie von Friedhelm immer hingestellt und belächelt wurde. Sie hatte das Geld, sie hatte ihn ausgetrickst. Ein selbstgefälliges Lächeln lag auf ihrem Gesicht, als sie nun weitere Entscheidungen traf.
*
Kommissar Harbig hatte Karsten Badenski nicht einschüchtern wollen und deshalb mit Markus verabredet, in seinem Haus die erste Zusammenkunft stattfinden zu lassen.
Indessen wurde jedoch bereits Cordula Lennerts Telefon überwacht, da man die Hoffnung hegte, daß Friedhelm Ronneberg Verbindung zu ihr aufnehmen würde. Wo man ihn sonst noch suchen könnte, wußte niemand, und wenn er sich selbst nicht meldete, mußte es einfach dem Zufall überlassen bleiben, daß man ihn oder seinen Wagen fand, dessen Kennzeichen bekannt war.
Kommissar Harbig hatte nicht damit gerechnet, daß Karsten Badenski gleich seinen Pflegesohn und dessen Frau mitbringen würde, Markus dagegen war darüber nur erfreut. Arved konnte die Ähnlichkeit mit seinem Onkel Dietrich nicht leugnen, wenngleich er größer und kräftiger war als dieser. Für ihn bedurfte es keiner Erklärung mehr. Er wußte, wen er vor sich hatte. Arved hatte sogar die gleiche Augenfarbe wie Nicola, und das allein brachte ihm schon Markus’ Sympathie ein. Solche Augen konnten nicht lügen. Sie konnten forschend blicken oder nachdenklich, auch zornig, aber es waren ehrliche Augen.
»Herr Wangen ist ein Freund der Stiebenaus«, erklärte Kommissar Harbig, »und außerdem der zukünftige Mann von Nicola von Stiebenau, deren Mutter Miriam, Ihre Schwester, war, Herr Badenski.«
»Ich hatte zwei Schwestern, Stella und Marianne«, erwiderte Karsten Badenski verwirrt. »Marianne war ein Nachkömmling, die erst zehn Jahre war, als ich sie zum letztenmal sah, noch nicht mal zehn, wenn ich mich recht erinnere.«
»Aber sonst können Sie sich noch recht genau erinnern?« fragte Kommissar Harbig.
»Ja, ich denke schon, jedenfalls was meine Familie betrifft und vor allem den Arved, der meinen Namen trägt.«
»Sie haben alles sehr genau angegeben auf der Suche nach Ihren Angehörigen, Herr Badenski. Wenn Ihre Angehörigen auch nach Ihrem Verbleib geforscht hätten, wäre die Familienzusammenführung viel eher möglich gewesen.«
»Sie dachten doch gar nicht, daß ich zurückkomme. Das nehme ich ihnen nicht übel. Wer hatte denn damals schon noch Hoffnung, wer hätte geahnt, daß es doch noch mal gutgehen würde«, sagte Karsten Badenski nachdenklich. »Wir sind doch kein Einzelfall.«
»Darf ich auch etwas sagen?« fragte Arved.
»Bitte«, erwiderte Harbig.
»Ich erkenne diesen Mann als meinen Vater an, obwohl ich weiß, daß er mich nur adoptiert hatte. Jetzt weiß ich auch schon ein bißchen mehr. Aber ich möchte doch sagen, daß unsere Bindung sehr eng ist und auch bleiben soll.«
»Ist ja gut, mein Junge«, warf Karsten ein. »Es geht doch nur um Formalitäten, die ich geklärt wissen möchte.«
»Es geht um mehr als um Formalitäten, Herr Badenski«, sagte Kommissar Harbig. »Leider werde ich Ihnen wohl auch manchen Kummer nicht ersparen können.«
»Warum eigentlich nicht?« fragte Arved. »Wir haben alles, was wir brauchen. Und Vater kann bei uns bleiben. Wenn Sie ihm etwas sagen wollen, was ihm Kummer bereitet, unterlassen Sie das lieber. Ich trage den Namen Badenski mit Stolz.«
»Ist ja gut, Junge, aber ich möchte wissen, was mit Stella und Marianne ist. Eine Miriam gab es bei uns nicht.«
»Ihre Schwester Marianne nannte sich später so«, sagte Harbig. »Unter diesem Namen heiratete sie dann auch den Baron Dietrich von Stiebenau.«
Karsten Badenski sah ihn fassungslos an. »Das kann ich nicht glauben. Sie hat den Bruder von Arveds Vater geheiratet? Entschuldigen Sie, Herr Kommissar, aber ist da was Rechtswidriges geschehen? Ich komme nicht mehr mit. Ich habe dem Herrn Baron treu gedient, das schwöre ich.«
»Lassen Sie doch Vater in Ruhe«, warf Dorle jetzt ein. »Er hat sich ehrlich geplagt in seinem Leben.«
»Laß nur, Dorle, das übersteh ich auch noch«, sagte Karsten. »Ich habe mich mit Stella nie gut verstanden. Ja, ihr hätte ich schon zugetraut, daß sie sich mit dem Ronneberg was ausgedacht hat, aber die Marianne... Na, Sie werden schon alles erzählen. Wenn man schon durch die Hölle gegangen ist, kann es schlimmer nicht mehr kommen. Nur soll mir keiner nachher sagen, daß ich wissend so lange geschwiegen habe.«
»Das wird Ihnen niemand nachsagen. Ihre ehrlichen Aussagen haben weitgehendst zu einer Aufklärung eines besonders verzwickten Falles geholfen, Herr Badenski«, sagte Kommissar Harbig freundlich. »Ich wollte Sie nur bitten, mit Ihrer Schwester Stella zu sprechen, damit sie sich auch bereitfindet, der Gerechtigkeit genüge zu tun. Hören Sie mir jetzt bitte zu.«
*
Und während Karsten Badenski in der Villa von Markus Wangen erfuhr, was Dietrich von Stiebenaus Leben vor vielen Jahren so schicksalhaft verändert hatte, saß Stella Ronneberg am Bett ihres Mannes, dessen Erdendasein dem Ende zuging. Leere Augen blickten sie an, aber sie wich diesem Blick aus und verlegte sich auf haltloses Schluchzen. Mehr und mehr steigerte sie sich hinein, und schließlich sagte Dr. Großkopf, daß sie doch besser das Krankenzimmer verlassen solle.
»Der Kranke erfaßt Ihre Nähe«, sagte er tonlos, »aber er kann nicht sprechen. Er möchte es wohl, aber er ist nicht dazu fähig.«
»Er soll es doch sagen, daß wir von alldem nichts wußten«, jammerte sie. »Verstehen Sie denn nicht, wie schrecklich es für mich und meine Kinder ist, wie Verbrecher behandelt zu werden?«
»Ich bin kein Richter, Frau Ronneberg«, sagte Dr. Großkopf. »Warum ist Ihr Sohn nicht hier?«
»Er muß etwas gewußt haben. Er hat die Schande nicht ertragen können«, schluchzte Stella Ronneberg. »Man kann doch nicht unser aller Leben zerstören. Wie stehen wir plötzlich da? Ich bin mir keiner Schuld bewußt. Ich schwöre, daß…«
»Schwören Sie lieber nicht, Frau Ronneberg«, sagte Dr. Großkopf.
Sie blickte zu Boden. »Plötzlich sind alle gegen uns«, murmelte sie.
»Homines sumus, non dei«, murmelte er. »Es bedeutet: Wir sind Menschen, keine Götter. Wir dürfen uns nicht zuviel anmaßen.«
In ihren dunklen Augen begann es haßvoll zu funkeln. »Kommen Sie doch meinem Sohn mit Ihrem Latein. Er wird Ihnen die richtigen Antworten darauf geben«, stieß sie hervor.
»Das wiederum glaube ich nicht mehr. Seine Zeit ist vorbei. Wir haben unsere Gesetze, Frau Ronneberg.«
Da drehte sie sich um und verließ fluchtartig das Krankenhaus. Aber sie war allein. Sie wußte nicht, wohin. Sie hatte Angst, entsetzliche Angst, daß auch Marina sie hintergangen haben könnte. Und sie begriff nun auch, daß sie eigene Schuld auf niemanden abwälzen konnte.
Sie mußte den Heimweg zu Fuß antreten. Sie wagte nicht, jemanden darum zu bitten, sie heimzufahren. Früher hätte ihr kaum jemand eine solche Bitte abgeschlagen. Und jetzt wandten sich schon alle ab, grüßten nicht einmal mehr, weckten den Gedanken in ihr, daß alle fast mehr wußten als sie selbst.
So erschöpft sie auch war, begann sie, wahllos zu packen. Und immer wartete sie auf einen Anruf von Marina, doch das Telefon blieb stumm.
Und dann klopfte es an der Tür. Es ist Friedhelm, dachte sie. Er holt mich. Aber dann stand ihr Bruder Karsten vor ihr, mit verschlossener Miene. »So sehen wir uns wieder, Stella«, sagte er.
Sie wich ein paar Schritte zurück. »Wir haben es doch auch für dich getan, Karsten«, rief sie aus, klarer Gedanken nicht mehr fähig. »Schau mich doch nicht so an, nicht so feindselig. Du hättest doch dein Leben für Arved von Stiebenau gegeben.«
»Ja, das hätte ich, Stella, aber jetzt kann ich dir seinen Sohn bringen, der mit Stolz den Namen Badenski trägt. Das gleicht vieles aus, wenn auch nicht jede Schuld.«
»Ich werde euch alles erklären, Karsten, alles«, sagte sie bebend. »Friedrich liegt im Sterben, meine Kinder haben mich im Stich gelassen...«
»Und du packst, wie ich sehe. Wie zum großen Treck, damals. Warum habt ihr das getan, Stella, warum? Warum habt ihr euch nicht um Dorothee von Stiebenau und ihr Baby gekümmert? Warum nicht?«
»Du hast ja keine Ahnung, wie schnell alles ging, Karsten. Wir mußten weg. Wir hatten doch selbst ein Baby. Und es war ein so langer Weg.«
»Ich habe auch einen langen Weg hinter mich gebracht, Stella, und manchmal bin ich zusammengebrochen. Aber fallen ist keine Schande, nur das Liegenbleiben, und in weichen, sauberen Betten kann selbst ein schlechtes Gewissen ruhen.«
»Laß sie, Vater«, sagte Arved.
»Er sagt Vater zu dir«, stammelte Stella. »Arved von Stiebenau sagt Vater zu meinem Bruder.«
»Mit Stolz«, erwiderte Arved. »Er ist ein selbstloser, gütiger Vater. Wir sind glücklich, daß wir ihn haben. Sie verdienen diesen Bruder nicht. Komm, Vater, wir fahren heim.«
»Ihr werdet ja doch alles bekommen«, schrie Stella auf. »Ich will es nicht allein auf mich nehmen. Ich habe immer getan, was mein Mann sagte, und später mein Sohn. Laßt mich doch wenigstens gehen. Ich bin doch eine alte Frau. Wenn ich gewußt hätte, daß du lebst, Karsten...«
»Du hättest es erfahren können«, erwiderte Karsten rauh. »Ich habe lange nach euch gesucht, ohne zu ahnen, daß ich dich hier finden würde, hier auf Gut Stiebenau.«
»Hör doch nicht auf andere. Ich werde dir alles erzählen, wie es wirklich war. Wir haben gearbeitet. Wir haben uns Friedenau ehrlich verdient, bis wir Miriam holten.«
»Marianne, ich kannte nur eine Marianne.«
»Miriam gefiel ihr besser. Es paßte zu ihr. Sie war so schön. Sie hat den Baron bezaubert. Karsten, du weißt doch nicht, wie es wirklich war.«
»Ich habe aber viel gehört, was ehrlicher klingt«, sagte Karsten Badenski ruhig.
»Sie wurde seine Frau, eine Baronin, und sie schenkte ihm eine Tochter.«
»Die betrogen wurde wie er. Ich habe die Menschen kennengelernt, Stella. Mir kann keiner mehr etwas vormachen. Für mich zählt nur, was ich miterlebe.«
»Du kannst doch nicht gewollt haben, daß wir so elend untergehen, wie so viele tausend andere«, schrie sie auf.
»Ich wünschte, ihr wäret einen ehrlichen Weg gegangen, wie so viele andere«, sagte er ruhig. »Ich schäme mich für meine Schwestern.«
»Komm doch, Vater, du brauchst dich nicht zu schämen«, sagte Arved. »Wir fahren wieder heim.«
»Nein, wir fahren noch nicht heim. Ich will, daß du deine Ansprüche geltend machst, Arved. Es gibt noch eine Stiebenau. Die wird es auch wollen, dessen bin ich sicher. Dein Vater war mein Freund.«
»Du warst sein Stiefelputzer, sonst nichts«, geiferte Stella. »Wir hatten alles verloren.«
»Meine Ehre habe ich nie verloren, Stella«, sagte Karsten. »Und ich kann mit Stolz sagen, daß Arved von Stiebenau mich in seiner Sterbestunde seinen besten Freund nannte. Ich werde es niemals vergessen. Es war mir immer eine Verpflichtung.«
»Er hat dir mehr bedeutet als deine Familie«, sagte Stella tonlos.
»Darauf bin ich heute doppelt stolz. Ich werde dich nicht verkommen lassen, wieviel Schuld du auch auf dich geladen hast. Aber mein innigster Wunsch ist, daß hier ein Stiebenau sein Erbe antritt.«
Arved wollte etwas sagen, aber Dorle umschloß seine Hand mit fe-stem Griff.
»Reg Vater jetzt nicht auf, Arved«, flüsterte sie. »Er hat doch ein halbes Menschenleben nur dieses eine Ziel gehabt. Ich verstehe ihn.«
*
Zu dieser Stunde kam Friedrich Ronneberg noch einmal zum Bewußtsein. »Es war alles meine Schuld, nur meine«, murmelte er. Und er starb mit dieser Lüge auf den Lippen, wohl um seine Schuld zu sühnen, nicht ahnend, daß sein Sohn Friedhelm seinem Leben selbst ein Ende setzte, als Cordula Lennert ihm am Telefon sagte, daß sie nicht bereit sei, ihm das Alibi zu geben. Er hatte sich selbst eine tödliche Dosis Morphium gespritzt. Er hatte in den letzten, unendlich lang scheinenden Minuten seines Lebens dieses wie einen Film vor seinen Augen abrollen sehen. Die kleine Marina, die voller Angst vor ihm davonlief, die Mutter hatte er gesehen, die ihn mahnte, doch die kleine Schwester nicht so zu ängstigen. Frauen waren durch sein Unterbewußtsein geschwebt, deren Namen er nicht wußte, und dann Miriam, mit ihrem lockenden Mund, den großen glänzenden Augen! Er sah sie vom Pferd stürzen, als er aus purem Übermut einen Schuß aus der Pistole abgab, die er immer bei sich trug. Alles im Zeitlupentempo rollte vor seinen Augen ab. Auch Nicola, die ihre Hände gegen seine Brust stemmte, die sich mit so viel Kraft und katzenhafter Schnelligkeit gegen ihn wehrte.
»Du wirst mich nie bekommen, du widerst mich an«, rief sie. »Ich liebe Markus.«
Markus, Markus, Markus, das gellte in seinen Ohren, ihm war es übel. Er wollte sich aufrichten, aber er hatte die Kraft nicht mehr dazu. Und dann sah er Nicola davonlaufen und hörte den Hund bellen.
Der Film rollte weiter ab, als der Schuß fiel. Er sah Nicola taumeln, ein paar Schritte weiterlaufen, dann fallen. Und er lief zu ihr, wollte sie emporreißen und da oben stand Tönnies. Und er versetzte Nicola den Stoß, daß sie hinabstürzte, lief Tönnies nach, der ihn dann an der Jacke packte.
»Verfluchter Kerl, sogar die Jacke vom Markus nimmt er«, gellte Tönnies’ Stimme in seinen schon rauschenden Ohren, und dann fiel der nächste Schuß, und für Friedhelm Ronneberg war der Film seines Lebens vorbei. Er sank hinab in uferlose Tiefe, dachte und fühlte und sah nichts mehr von diesen Bildern.
Als man ihn fand, war er schon zwei Stunden tot, und auf seinem schon erstarrten Gesicht lag der Ausdruck von Furcht. Und niemand konnte erforschen, was an seinen geistigen Augen vorübergeglitten war, bevor das Herz stillgestanden hatte.
Wie es geschehen war, konnte Nicola erst eine lange Woche später erklären.
Da saß sie in ihrem Bett, und kurz zuvor hatte sie zu Dr. Norden, der sie besuchte, gesagt, daß sie sich an nichts erinnern könne.
»Ich war mit meiner Frau auf einem Ausflug, und wir fanden Sie nahe beim Wasserfall, Nicola«, sagte Dr. Norden. »Wie kamen Sie dorthin?«
»Am Wasserfall?« wiederholte sie fragend.
»Ihr Wagen wurde am Stellplatz unterhalb des Jagdhauses gefunden, das Markus Wangen gehört«, sagte Dr. Norden.
»Es gehörte seinem Vater«, sagte sie gedankenverloren. »Miriam hat sich dort mit ihm getroffen. Miriam hieß meine Mutter. Armer Papa.«
Erst langsam kehrte Nicola in die Wirklichkeit zurück, obgleich sie schon ein paarmal mit Markus gesprochen hatte. Aber er war wohl der einzige Mensch, der wirklich für sie existierte.
Dr. Daniel Norden, der sonst nie verzagte, gab es auf. »Sprechen Sie mit ihr, Markus«, sagte er zu dem Wartenden. »Haken Sie da wieder ein, als sie auf dem Stellplatz ihren Wagen parkte. Ich habe den Fehler gemacht, sie an ihre Mutter zu erinnern. Sprechen Sie bitte nicht von ihr. Ich bin überzeugt, daß Sie der einzige Mensch sind, dem sie ihr Vertrauen schenkt...«
»Ich will es versuchen, wenn es sein muß«, sagte Markus. »Mir wäre es lieber, es gehörte alles dem Reich der Vergessenheit an.«
Wenn sie gewußt hätten, was Friedhelm Ronneberg noch einmal durchlebt hatte, während er starb, wäre dieser Versuch überflüssig gewesen, aber der Schuldige hatte ja kein Schuldbekenntnis abgelegt. Und vielleicht war es doch gut, daß Nicola dann alles sagen konnte, daß sich diese quälenden Zweifel endlich auflösten!
»Du hast in deinem Brief geschrieben, daß du dich mit Friedhelm treffen wolltest, Nicola«, begann Markus nach einer langen sanften Vorbereitung. »Und daß ich alles andere selbst herausfinden müsse, wenn du mir den Brief nicht selbst geben könntest, aber ich kann nichts herausfinden. Friedhelm lebt nicht mehr.«
»Er ist tot?« fragte sie mit einem fast kindlichen Staunen. Ihre Augen waren ganz weit. »Hat Tönnies ihn erschossen?«
Er hielt den Atem an. Sie wußte ja noch nicht, daß Tönnies auch tot war. »Wie kommst du darauf, Nicola?« fragte er. »Es wäre so gut, wenn du dich erinnern könntest.«
»Ich wollte mit Friedhelm über das sprechen, was ich in dem Koffer gefunden hatte. Er gehörte doch auch zu einer anderen Generation. Ich wollte ihm und Marina eine Chance geben. Man kann doch die Kinder nicht für die Fehler ihrer Eltern verantwortlich machen, Markus. Ich habe auch ein Kind, und ich habe auch Fehler gemacht, aus Eigensinn, aus verletztem Stolz, auch aus Eifersucht. Jetzt gebe ich ja alles zu. Eine Zeit habe ich wirklich geglaubt, daß du und Marina…«
»Mein Gott, es war nie etwas«, fiel er ihr ins Wort. »Warum konntest du nicht offen mit mir darüber sprechen?«
»Ich bin eben auch nur eine Frau. Und nach Vaters Tod sagte Marina, daß ich für dich genauso ein Liebchen gewesen sei, wie Miriam für deinen Vater, und solche Frauen würden nur von einem alten Narren geheiratet, wie mein Vater einer gewesen wäre.«
»Und das hast du dir zu Herzen genommen?« fragte Markus erregt.
»Ich war in einer schlimmen Verfassung. Und dann, ganz langsam, kam mir die Erkenntnis, daß ich ungerecht gewesen sein könnte gegen dich, aber auch gegen Friedhelm. Schließlich war er ja als Arzt schon einige Jahre anerkannt. Mir kam der Gedanke, daß er auch seine Probleme haben könnte. Er war mir nie zu nahe getreten, Markus. Ich dachte tatsächlich, daß ich mit ihm ganz vernünftig reden könnte, um all das diskret zu bereinigen, was Vater schließlich in eine ausweglose Lage getrieben hatte. All die Zeit hatte ich doch gefürchtet, daß Papa etwas getan haben könnte, womit sie ihn erpressen konnten. Und als ich dann las, daß sie behaupteten, Friedhelm sei ein uneheliches Kind von Arved, dachte ich, daß er dann ja ein Recht auf das Gut hätte. Er, nicht seine Eltern.«
»Aber das stimmt nicht, Nicola. Arved war verheiratet, und es lebt ein ehelicher Sohn von ihm.«
»Es lebt ein Sohn von ihm«, wiederholte sie ungläubig.
»Das erfährst du alles noch genau, Liebes. Kommissar Harbig möchte so gern wissen, wie es wirklich war an jenem Morgen.«
»Ich wollte erst mit Friedhelm sprechen, dann mit ihm zu seinen Eltern gehen. Er wartete schon auf mich und war zuerst ganz freundlich. Er sagte, daß ich Basti noch im Wagen lassen solle, er müsse mir etwas zeigen, was auch sehr wichtig für mich wäre. Er sagte, daß du im Jagdhaus mit Marina ein Rendezvous hättest.«
»Und das hast du geglaubt?«
»Ich wollte es nicht glauben, aber er sagte, daß ich mich davon überzeugen könne. Er sagte, daß du auch nicht anders wärest als sein Vater. Bitte, verzeih mir, daß Zweifel in mir aufkamen.«
Zweifel, die ihr den Tod hätten bringen können, dachte Markus voller Entsetzen, und ein eisiger Schauer rann durch seinen Körper. Fest umschloß er ihre Hände.
»Wir könnten längst verheiratet sein, Liebstes«, sagte er bebend. »Ich habe immer nur dich geliebt, schon damals, als du noch ein kleines Mädchen warst.«
»Hast du nie an mir gezweifelt, Markus?« fragte sie leise.
»Nur daran, daß du mich so liebst, wie ich dich liebe. Ich war verzweifelt, weil du dich so sehr von mir entferntest.«
»Nur wegen des Kindes, Markus. Ich weiß jetzt, daß es töricht war. Aber irgendwann trifft wohl jeder Mensch mal eine törichte Entscheidung. Und nie wäre mir der Gedanke gekommen, daß Friedhelm, ein Arzt, zum Mörder werden könnte. Es war ein grauenvoller Augenblick, als er plötzlich eine Pistole in meinen Rücken drückte und sagte, daß die Stiebenaus nun restlos ausgelöscht würden. Ganz kalt hat er es gesagt. Ich sagte, daß Aufzeichnungen von Papa vorhanden wären, die die Wahrheit ans Licht bringen würden, aber er hat nur höhnisch gelacht und erwidert, daß Papa ein seniler Träumer gewesen sei. Er packte mich am Arm und trieb mich auf die Schlucht zu. Und dann kam Wastl. Das irritierte ihn. Ich riß mich los, aber ich stolperte und fiel, und da schoß er. Ich war wohl ziemlich betäubt, als er mich emporriß und hinunterstieß, und schon im Fallen war es mir, als würde ich Tönnies sehen, aber dann war alles dunkel.«
»Und deshalb mußte Tönnies wohl auch sterben«, sagte Markus leise.
»Er ist tot, Tönnies ist auch tot?« schluchzte Nicola auf.
»Du darfst dich jetzt nicht aufregen, Liebes«, sagte Markus zärtlich. »Niemand wird dir jetzt noch etwas zuleidetun. Friedhelm hat sich dem irdischen Richter entzogen, und sein Vater ist wohl letztendlich doch an seinem Schuldbewußtsein gestorben. Und ich danke Gott, daß du lebst und daß ich dich in den Armen halten kann.«
*
Am nächsten Tag lernte Nicola ihren Cousin Arved und seine Frau Dorle kennen. Karsten Badenski, der sich seiner Schwestern schämte, wollte erst wissen, ob Nicola bereit sein würde, auch ihm die Hand zu reichen.
Zuerst führte Nicola aber ein langes Gespräch mit Arved. Sie bat ihn herzlich, doch sein rechtmäßiges Erbe anzutreten und auch in Erinnerung an seinen Vater den Namen Stiebenau zu tragen.
»Ich werde Markus Wangen heiraten«, sagte sie. »Du hast einen Sohn, Arved, Friedenau stünde euch sowieso zu.«
»Ich verdanke Karsten Badenski so viel, Nicola«, sagte er nachdenklich. »Er war mir ein richtiger Vater. Er hat nie nach Gewinn getrachtet. Er hat nur gegeben. Jetzt schämt er sich seiner Schwestern.«
»Das braucht er nicht. Er hat alles gutgemacht, was sie den Stiebenaus angetan haben. Meinst du nicht, daß es für mich schlimmer ist zu denken, daß ich eine solche Mutter hatte? Ich würde verzweifeln, wenn Markus mich deshalb nicht lieben könnte. Und Karsten Badenski wird zu uns gehören, weil er deinem Vater so treu ergeben war und weil er dich zu einem tüchtigen Mann erzogen hat.«
»Wenn du so senkst, werde ich Friedenau übernehmen und Stiebenau für dich verwalten. Wir werden dies alles ganz korrekt regeln, Nicola. Vielleicht macht es Vater sogar Freude, sich noch nützlich machen zu können, und schön wäre es schon, wenn es uns gelingen würde, seine Kinder, die ich als meine Geschwister betrachtet habe, zu uns zu holen.«
»Ja, es wäre schön, wenn auf den Gütern wieder gutes, frohes Leben herrschen würde«, sagte Nicola leise, »wenn es so wäre, daß wir gern kommen. Ich habe hier ein paar gute Freunde, die nun auch ihr Recht bekommen sollen. Nur Stella und Marina möchte ich nie mehr sehen.«
»Stella ist schon gegangen«, sagte Arved. »Sie kann ihrem Bruder auch nicht in die Augen schauen.«
Erschütternd war die erste Begegnung zwischen Nicola und Karsten Badenski. Aber als Nicola ihm beide Hände entgegenstreckte und sagte: »Ich habe gar nichts dagegen, daß Arved sich Badenski von Stiebenau nennen will«, glitt ein heller Schein über sein leidgeprägtes Gesicht. Er küßte ihr beide Hände und sagte: »Gott wird es euch vergelten.«
»Ich mache allerdings eine Bedingung«, sagte sie mit einem weichen Lächeln. »Ich sage auch Vater, und du sagst du zu mir.«
Verstohlen wischte er sich die Tränen aus den Augen. »Dieses Glück, wenn sie es doch hätten erleben können.«
*
»Siehst du, Fee, es gibt so viel Treue«, sagte Daniel Norden gedankenverloren. »Treue über den Tod hinaus.«
»Und Liebe«, sagte sie leise. »Es war kein verlorenes Wochenende, und wenn wir jetzt zum Gut Stiebenau fahren, wird kein Schatten diesen Tag trüben.«
So sollte es sein. Es wurde eine fröhliche Hochzeit gefeiert. Die Hochzeit von Tresi und Jakob Brandner. Nicola und Markus hatten schon zuvor in aller Stille geheiratet, und der kleine Nico sollte es nicht anders wissen, als daß sein Papi, an den er sich so schnell gewöhnt hatte, von einer langen Reise endlich zu ihnen zurückgekehrt war.
Nicola und Arved hatten es sich nicht nehmen lassen, Tresi und Jakob die Hochzeit auszustatten. Und es wurde eine Hochzeit, wie man es auf dem Lande gewohnt war. Auch aus Österreich waren alle Verwandten von Dorle gekommen. Noch immer konnten sie es nicht begreifen, daß ihre Tochter, Nichte und Enkelin nun plötzlich eine Baronin wurde, aber Nicola war gewiß, daß sie eine würdige Stiebenau sein würde. Und auch Karsten Badenskis Kerstin und Torsten konnten mit ihnen feiern. Wer wollte ihnen verdenken, daß sie sich wie in einem Märchen fühlten. Und es spann sich schon wieder eines an, als Klaus Portner die reizende Kerstin kennenlernte.
Auch der Kommissar Harbig war mit seiner Familie gekommen, um einmal eine richtige Hochzeit auf dem Lande zu erleben und nach recht traurigen Erlebnissen hier an so viel Freude teilnehmen zu können, und Maxi Strasser ließ Harbigs hübsche Nichte Uschi nicht von seiner Seite.
Es lag Jahre zurück, daß die Akte Ronneberg geschlossen worden war. Die letzten Steinchen hatte Kommissar Harbig allerdings mit seiner Kombinationsgabe hinzufügen müssen. Bevor Friedhelm Ronneberg das Leben des alten Tonnies auslöschte, war er zum Jagdhaus gelaufen, hatte dort das Durcheinander geschaffen, und dann die Lederjacke von Marius angezogen, um den Verdacht auf ihn abzuwälzen.
Ja, nur so konnte es gewesen sein, denn Nicola hatte gesagt, daß er die Jacke noch nicht trug, als sie ihn traf. Die Gerechtigkeit hatte gesiegt und die Liebe. Man brauchte sie nur anzusehen, all die glücklichen Menschen und allen voran Markus und Nicola mit ihrem kleinen Nico, der nicht von der Hand seines Vaters wich. Er hielt ihn allerdings auch so fest, als könnte man ihm das Kind wieder nehmen.
»Vielleicht werde ich jetzt doch lieber Landwirt«, sagte der Peppi Brandner zu seinem großen Bruder. »Spaß wurde es mir schon machen beim Arved. Der ist pfundig.«
»Folge deinem Herzen, Peppi«, sagte Jakob. »Jetzt herrscht hier wieder ein anderes Leben.«
»Und es ist halt unsere Heimat«, sagte Peppi. »Deshalb wollten wir doch auch nichts aufgeben. Aber Arved läßt auch unser Haus instandsetzen, hat er mir versprochen, und brauchen kann er ja auch jeden, um alles wieder richtig in Schwung zu bringen.«
»Vielleicht sattle ich jetzt auch noch um«, sagte Jakob. »Was meinst du, Tresi?«
»Gar keine so schlechte Idee. Und unser Papa ist ja mit Arved und Vater Badenski auch schon auf du und du. Und schau mal die Schwester Mathilde an, wie sie mit dem Dr. Großkopf tanzt. Die verbringen nun vielleicht sogar ihren Lebensabend miteinander.«
»Aber ein guter Arzt muß her«, meinte Jakob. »Jetzt, wo ich in den Gemeinderat gewählt bin, werde ich schon dafür sorgen.«
Alle waren zufrieden, auch die beiden Vierbeiner Waßtl und Bastian, die übermütig auf der Wiese herumtollten. Sie genossen ein glückliches Hundeleben.
»Zufrieden, Fee?« fragte Daniel Norden, als sie die Heimfahrt antraten.
»Mehr als das«, erwiderte sie.