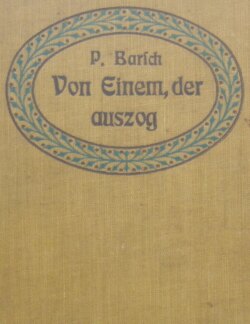Читать книгу Von Einem, der auszog. - Paul Barsch - Страница 10
In Breslau.
ОглавлениеDie Rocktragen hochgeschlagen, die Hände in die Taschen versenkt, die Stecken zwischen Arm und Leib geklemmt, die Köpfe tief na vorn geneigt und die Augen halb zugekniffen – so strebten wir dem nassen Sturm entgegen. Die Augen waren feucht und die Wangen; ich wusste nicht, ob das von Schneeregen kam, oder ob ich weinte.
Der Sturm heulte vor Wut, weil er uns nicht hinwerfen konnte, und weil auch die Straßenbäume zu fest standen. Doch freuten wir uns nicht unserer Kraft.
Durch Dörfer marschierten wir, und Menschen sahen zu den Fenstern heraus. Keiner von allen diesen Menschen lud uns ein, in eine Stube zu kommen, uns zu wärmen, auszuruhen und zu stärken.
Johann ging voraus; er ging so schnell, dass wir ihm kaum folgen konnten. Franz wimmerte und klagte sich an, weil er nicht zu Hause geblieben. Am Abend auf der Streu war er so klug und großsprecherisch gewesen, wie ein viel erfahrener, furchtloser Mann, und nun zeigte er sich verzagt, wie ein kleines Kind. Ich bat Johann, nicht so schnell zu laufen; das war aber ein Grund für ihn, noch schneller auszuschreiten, und da ich nicht zurückbleiben wollte, ging mir fast der Atem aus. Johann sagte, er sei durch und durch nass geworden und müsse sich nun im Laufschritt erwärmen. So liefen wir von Ort zu Ort – immer weiter. Und wir hatten noch nicht gefrühstückt.
Unser Bund war nahe daran, der Auflösung zu verfallen; nur durch meine Besonnenheit ward er gerettet. Obgleich ich keuchend nach Atem rang, erzählte ich eine Geschichte von einem Manne, der auf schlaue Weise Krähen fing, und Johann gern solche Tiergeschichten hörte, zwang ich ihn, ohne dass er meine Absicht erriet, langsamer zu gehen. Allmählich brachte ich ihn soweit, dass er meinen Vorschlag, uns irgendwo zum Frühstück hinzusetzten, lebhaft billigte. Als Franz vom Frühstück hörte, bekam er frische Kräfte und hielt gleichen Schritt mit uns.
Wie am vorhergegangenen Tage, erstand ich Brot, Butter und Salz in einem Wirtshaus, und da der Regen nachgelassen und der Sturm sich ein wenig gelegt hatte, konnten wir uns im Freien niederlassen. Wir saßen freilich auf feuchten Grunde; bei unserer großen Müdigkeit kümmerten wir uns aber nicht daran. Der unserer Himmel blieb regendüster; unsere Gemüter dagegen klärten sich beim Frühstück auf, und da Johann während der Unterhaltung den Gesprächsstoff des vorhergegangenen Abends berührte, geriet Franz in eine lachende Lebendigkeit. Aber die gute Laune ging in den nächsten Wanderstunden abermals verloren, da immer aufs Neue stürmische Regen- und Schneeschauer los brachten und der todmatte Franz auch Zahnschmerzen bekam.
Spät nachmittags erblickten wir die Türme von Breslau. Johann sah sie zuerst. Ich ärgerte mich, dass er diesen Ruhm errungen hatte, da ich selbst gern die große Stadt zuerst gesehen hätte. Der Anblick war erhebend für uns alle drei. Mein Herz wogte auf in wilder Begeisterung.
Breslau!… Die große, große Stadt!… War mir doch in der Schule gelehrt worden, dass sie größer sei, als alle Städte des Regierungsbezirks Oppeln insgesamt! In meiner Einbildung lebten Vorstellungen von wolkenhohen Türmen, sechsstöckigen Häusern, meilenlangen Straßen und vornehmen Palästen; ich war begierig, die Liebichshöhe zu sehen, die Pferdebahn, den Dom und die vielen andern Kirchen, besonders aber das Haus, in dem der Bischof wohnte. Wie prächtig und wie groß musste dieses Haus sein! Der Bischof kam ja gleich hinter dem Papste! Er war so berühmt und so mächtig, dass ihm alle Pfarrer und Kapläne in ganz Schlesien gehorchen mussten. Auch die bewunderungswürdigen Plätze und Denkmäler, von denen ich gelesen und gehört hatte, sollte ich bald mit eigenen Augen schauen. Wer in meiner Heimat behaupten konnte, dass er in Breslau gewesen, war von mir als glücklicher Mensch betrachtet worden, weil er sich immerzu freuen konnte in der Erinnerung an die Herrlichkeiten, die er gesehen. Und nun sollte mir selbst dieses Wunder werden!
„Wir sind doch schon weit in der Welt!“ sagte Johann. Doch schämte er sich sogleich seines aufwallenden Empfindens und fügte daher verächtlich hinzu:
„Gegen Berlin und Leipzig ist Breslau gar nicht!“
„Wenn wir jetzt nach Hause kämen und erzählen würden, dass wir Breslau gesehen haben!“ sagte Franz. „Die würden schöne Augen machen!“
Johann meinte, in einer Stunde wären wir drin. Da bleib Franz erschrocken stehen und fragte: „Ihr wollt doch nicht hinein gehen?“
„Wohin denn sonst?“
„Nach Breslau geh ich nicht mit!“ rief er mit Bestimmtheit. „Lieber dreh ich um und geh nach Hause!“ Dann begann er zu weinen.
„Bei dem pickt’s“ sagte Johann und tippte bedeutsam mit dem Finger nach der Stirn. Langsam ging ich mit Johann weiter; Franz blieb zurück und sah uns mit bittendem Gesicht nach. Sein Verhalten war mir unbegreiflich. Ich ging zu ihm hin und fragte zornig, was ihm einfalle und ob er verrückt geworden sei, oder etwa glaube, dass in Breslau die Menschenfresser wohnen. Johann forderte mich auf, den dummen Affen ruhig stehen zu lassen; ich aber fühlte trotz meines Zorns ein tiefes Mitleid für ihn und verlangte zu wissen, was ihm in den Sinn gefahren sei. Unter Schluchzen gab er mir kund, dass er nicht mit in die Fremde gegangen wäre, wenn er gewusst hätte, dass wir nach Breslau gehen würden. Wir hätten ihm das bald sagen sollen; dann hätte er seinen guten Sonntagsanzug mitgenommen. In seinem schlechten Rocke könne er sich nicht in Breslau zeigen. Wenn ich ihn auch auslachte und einen einfältigen Narren nannte, besaß ich doch Verständnis für seine Gefühle. Auch ich hatte mich schon gefragt, ob es passend sei, in schlechter, nasser und schmutziger Kleidung eine berühmte Stadt zu betreten, in der ja lauter vornehme und fein gekleidete Menschen wohnten. Doch ich ließ mein Bedenken nicht merken, sondern tat so, als sei Franz auch in meinen Augen der allergrößte Narr. „Komm doch – sieh doch bloß! Zum Totlachen!“ schrie ich dem vorauseilenden Johann nach und wand und drehte und schüttelte mich so belustig beim Lachen, dass Johann, einen guten Spaß vermutend, herbeieilte. Wir lachten jetzt gemeinsam über Franz und sagten ihm, dass er der dämlichste Esel sei, den Gott geschaffen. Scherzhaft rieten wir ihm, dass er schnell umkehren solle, da ihn die Breslauer, wenn sie ihn sähen, sogleich einfangen und als Affen in den Zoologischen Garten sperren würden.
Unser Spott erschütterte ihn nicht in seinem Entschlusse; er heulte wie ein Verzweifelnder und war nicht von der Stelle zu bringen. Da schlug ich einen anderen Ton an. Während Johann weiter höhnte und spottete und mittendrein auch bedauerte, dass er mit so einem grünen Jungen in die Fremde gegangen sei, redete ich dem verzweifelnden Freunde zu, doch endlich vernünftig zu sein und nicht im Regen auf der Straße stehen zu bleiben. Ich erbot mich, ihm mein einziges Vorhemd zu leihen und ihn mit meiner Bürste sauber abzuputzen. In Breslau – versicherte ich ihm – sei ein sauberes Vorhemd die Hauptsache; wer ordentlich um den Hals aussehe, könne getrost durch die feinsten Straßen gehen. Mit solchen Worten bewältigte ich seine Furcht, bis er mitging. Langsam, watend, immer im Regen, strebten wir jetzt der Stadt zu. Das Hemd klebte mir am Körper; so tief war schon der Regen gedrungen; die rauen Leinwandhosen klatschten mir beim Gehen schwer und nass an die Beine. Als wir die Türme der Stadt schon deutlicher sahen und auch bereits der ersten hohen Häuser zu erblicken glaubten, gingen wir von der Straße ab in ein Gebüsch und bereiteten uns dort für den Einmarsch vor. Ich gab mein Vorhemd hin, das ich selbst gern angelegt hätte; wir bürsteten die Kleider und Stiefel und kämmten unser Haar.
Johann beteuerte wieder, dass Breslau ein elendes Nest sei im Vergleich zu Berlin; doch bürstete und putzte er so fleißig, wie Franz und ich. - - Beim schwachen Reste des Tageslichtes zogen wir dann in die Stadt ein. Soviel ich auch den Blick umherschweifen ließ, vermochte ich doch nichts von den erwarteten Herrlichkeiten zu sehen. Die Straße, die wir durchschritten, war lang und breit; aber die Häuser und Schaufenster waren nicht größer und schöner als in der kleinen Stadt, aus der wir kamen. Nur die Pferdebahn fand meine Bewunderung. Ich erstaunte über das Pferd, das mit Leichtigkeit einen Wagen ziehen konnte, der fast so groß war, wie ein Eisenbahnwagen, und ich glaubte, es müsse dressiert sein wie ein Zirkuspferd, wie es immer schnurgerade zwischen den Schienen lief. Voll Spannung verfolgte ich seinen Lauf, beständig in der Erwartung, es werde einen Fehlsprung nach rechts oder nach links machen und den Wagen zum Entgleisen bringen; doch es entgleiste kein Wagen.
Manchmal sah ich Männer auf der Straße stehen, die dunkelblaue soldatische Uniformen und Helme trugen. Der Säbel befand sich unterhalb des Rockes; nur der Griff und unten das Ende der Scheide waren zu sehen. Das hielt ich für etwas Sonderbares. Allmählich kam ich auf die Vermutung, dass diese Männer Polizisten seien. Vielleicht keine richtigen Polizisten, da sie doch sonst wohl rote Kragen gehabt hätten und nicht so gleichgültig gewesen wären gegen uns Handwerksburschen. Sie sahen friedlich und freundlich aus, ganz anders als daheim die Polizeimänner, und achteten gar nicht auf uns, obgleich wir an einigen ganz nahe vorüber strichen. Ich gewann ein solches Vertrauen zu ihnen, dass ich kühn an einen herantrat und fragte, wo die Herberge sei.
„In welche Herberge wollen Sie?“
„Wenn’s eine Tischlerherberge gäbe…“
„Geh’n Sie doch lieber in die christliche Heimat!“ riet er mir. „Dort sind Sie am besten aufgehoben. Die christliche Heimat ist in der Holteistraße.“ Er beschrieb uns die Wege und ging einige Schritte neben uns her. Ich war entzückt von seiner Freundlichkeit und hielt es für unmöglich, dass ein solcher Mensch einen anderen Menschen einsperren könne; insbesondere hielt ich ihn für einen Freund der Handwerksburschen.
Fortan gefiel mir Breslau, obgleich ich noch kein prächtiges Gebäude, kein Denkmal und keinen hohen Turm gesehen hatte. In den Gesichtern der Menschen fand ich den gleichen Ausdruck der Güte, den ich im Antlitz des Polizisten gefunden hatte. Ich nahm mir vor, der Mutter eine Schilderung von Breslau zu schreiben und darin hervorzuheben, dass in meinem Heimatdorfe kein einziger Mensch so gut von Herzen sei, wie hier die Polizisten. Aus der Freundlichkeit der Polizei könne sie auf die Freundlichkeit der gewöhnlichen Menschen schließen.
An einige große Schulkinder, die auf der Straße plauderten, richtete ich die Frage, wo der Bischof wohne. Sie wussten es nicht; ein Mädchen aber sagte, ich solle in das Adressbuch sehn. Auch die Kinder gefielen mir. Sie hatten artig geantwortet und höhnten nicht hinter mir her, wie es bei mir zu Hause die Kinder in einem solchen Falle getan hätten. Aber verwunderlich war es mir, dass sie nicht einmal zu sagen wussten, wo der Bischof wohne. Ich dachte so bei mir: wenn ich ein Breslauer Kind wäre, würde ich alle Tage das Haus des Bischofs betrachten und nicht eher ruhen, bis ich ihn einmal selbst und ganz nahe gesehen hätte. Überhaupt war es sonderbar, dass die Breslauer alle so gleichgültig des Weges gingen – ganz so, wie die Menschen in der kleinen Stadt. Kein Gesicht verriet mir den Ausdruck des stolzen Bewusstseins, in einer berühmten Stadt leben zu dürfen. Ich sah sogar Menschen, die noch schlechter gekleidet waren als wir.
Franz weinte wieder. Er sagte nicht, weshalb. Wenn ich ihn fragte, was ihm fehle, weinte er noch mehr.
Endlich fanden wir die Herberge zur christlichen Heimat. Ohne Zaudern gingen wir hinein. In einem großen Zimmer, das einer Wirtshausstube ähnlich sah, saßen Gäste an den Tischen, junge Leute zumeist. Die Unterhaltung wurde in gedämpftem Tone geführt. Einige der Gäste richteten Fragen an uns; doch ich verstand sie nicht und grüßte nur. An einem frei gebliebenen Tische, ganz im Hintergrunde, ließen wir uns nieder. Franz presste beide Hände an eine Wange und schluchzte und stöhnte weiter. Er litt wieder Zahnschmerzen. Auf unsere Ratschläge hörte er nicht, und selbst Johanns eindringliche Ermahnung, einen Zigarrenstummel zu suchen und den Schmerz durch Zigarrenrauch zu betäuben, fand keine Beachtung. Immerzu lispelte er wimmernd, ihm könne kein Mensch helfen; er müsse sterben. Da wurde Johann grob und verbot ihm, uns durch sein Gewinsel zu blamieren. Er erbot sich, mit ihm hinauszugehen und den kranken Zahn mir einem Bindfaden herauszuziehen. Aus den Schnüren seines Bündels löste er einen Faden und bereitete daraus eine Schlinge. Da die Lampe nur wenig Licht nach unserem Tische entsendete und die Gäste sämtlich in ihre Unterhaltung vertieft waren, verstand er sich auf mein Zureden dazu, sein Kunststück im Zimmer zu vollbringen. Franz wurde gezwungen, zwischen Bank und Tisch auf die Diele niederzuknien, so dass die Gäste seinen Kopf nicht sehen konnten,
„Nicht mucken! Sonst . . .“
Johann versuchte, seine Schlinge an den kranken Zahn zu befestigen und sah sich dabei genötigt, gleichfalls unter den Tisch zu schlüpfen. Leider ging die Arbeit nicht so lautlos vor sich, wie wir gehofft hatten. Franz ächzte und stöhnte, und da er den Mund nicht so weit aufriss, wie Johann es wünschte, wurde er von diesem gescholten. Die Gäste sahen zu uns herüber und jemand rief: „Die Kunden dort werden meschugge!“
Johann fuhr empor aus dem Versteck; auch Franz nahm seinen Platz auf der Bank wieder ein. Mehrere Personen traten zu uns heran und besahen uns mit sonderbaren Blicken. Damit sie nicht auf die Vermutung kämen, dass wir am Ende irrsinnig seien, sprach ich rasch: „Der hier hat Zahnschmerzen und weiß sich keinen Rat mehr.“
„Zahnschmerzen? – Rausziehen! Das einfachste!“
„Den Pfropfenzieher nehmen und rausdrehen!“
„A’n Hammer und a Stemmeisen und rausstemmen!“
„’s beste is eene Maulschelle, dass der Zahn vor Angst alleene raus springt.“
„Geh zum Schmied, borg Dir eene Zange und bring se her! Ich zieh ihn raus!“
So machten sich die herzlosen Menschen lustig über den armen Franz, und als sie sahen, dass er weinte, spotteten sie noch heftiger. Einer jedoch, ein junger blasser Mensch, nahm nicht teil an diesem Gespött; er erklärte sich ernsthaft bereit, den Zahn zu ziehen; er habe das Zahnziehen studiert und besitze die nötigen Instrumente.
„Wenn’s nur nicht zu viel kosten möchte!“ entgegnete ich ihm zaghaft.
„Eenen Bleier!“
„Was ist das?“
„Der da frägt, was ‚n Bleier is!“
Als ob ich eine urkomische Frage gestellt hätte, lachte die ganze Gesellschaft und belustigte sich über uns. Nur der junge blasse Mensch blieb ernst. Ein Bleier, sprach er, seien zehn Pfennige. Beim richtigen Zahndoktor koste das Ausreißen drei Flachsen; er reiße den Zahn viel geschickter und verlange nur einen Bleier.
„Ja, der kanns!“ versicherte einer aus der Schar. „Der is Rüsselschaber und Doktor.“
„Wenn der mit seiner Zange einen Meilensteen an der Chaussee anfasst – riß! Is der Steen raus.“
Zehn Pfennige, - das war nicht viel. „Wollen wir?“ wandte ich mich an Johann.
„Los!“ entgegnete er, und dein Gesicht verriet, dass er sich auf das Vergnügen freute.
„Also los!“ rief der Rüsselschaber und Doktor, nahm einen Stuhl und verließ damit das Zimmer. Franz war furchtsam, ließ sich aber von Platze zerren und in den Hof führen. Ich ging nicht mit hinaus. Die erwartungsvolle Freude der andern an dem Schauspiele war mir unfassbar, widernatürlich, empörend. Außerdem litt ich vielleicht mehr Angst, als Franz selber.
Ein Vorgang kam mir in den Sinn, der sich vor vielen Jahren ereignet hatte. Ich sollte einst beim Fleischer einen Auftrag meines Vaters bestellen und sah bei dieser Gelegenheit, dass der Bleischergesell eine Kuh in den Schlachtraum zog. Er schlug die Kuh mit einem Stecken und rief dabei lachend einer Magd zu, die am Hoftore stand: „Komm, Therese, den Schwanz halten, damit sie stille hält, wenn ich sie ermurkse!“ Mich ergriff damals ein grauenhaftes Entsetzen vor dem Fleischergesellen; in meinen Augen war er ein Unmensch, weil er kein Erbarmen mit der Kuh empfand und noch lachen und scherzen konnte, bevor er sie ermordete. Für mein Fühlen war das etwas unerhört Widernatürliches, und schnell suchte ich fort zukommen aus dem Bereich der Blutstätte. Laut weinte ich vor mich hin und wusste nicht, ob aus Mitleid für unglückliche Kuh, oder aus Empörung darüber, dass solche Dinge in der Welt möglich waren. Ähnlich erging es mir jetzt, da Franz unter rohem Spottgelächter hinausgeführt wurde. Ich wusste, dass meine Entrüstung und Weichherzigkeit lächerlich war, dass es der Beruf eines Fleischergesellen sei, Tiere zu schlachten, und dass ein Zahn, der herausgezogen worden, keinen Schmerz mehr verursachen könne; doch das Gefühl des Abscheus verließ mich nicht.
Was war ich doch für ein schwächlicher, weichlicher, dummer Mensch! Währen ich in Ängsten und Grauen zitterte und die Hände verstohlen an die Ohren presste, kehrte Franz, von vielen Kunden begleitet, wohlbehalten in den Saal zurück. Eilig kam er auf seinen Platz; aus den wenigen Worten, die ich ihm herauspresste, und aus der lebhaften und listigen Unterhaltung der Kunden erfuhr ich, dass er mit dem Stuhle zusammengebrochen und der Zahn im Munde geblieben sei. Aber der Schmerz hatte nachgelassen. Der Rüsselschaber kam an unseren Tisch, redete grobe, beleidigende Worte und tat so, als wollten wir ihn um seinen Lohn prellen. Ich gab ihm die vereinbarten zehn Pfennige, und befriedigt ging er davon. Wir kauften uns später ein Abendbrot. Als wir noch aßen, erschien ein Mann, den wir bis dahin noch nicht gesehen hatten, stellte sich mitten ins Zimmer, faltete die Hände und begann zu beten. Die Gäste hörten stehen zu. Nach dem Gebet stimmte der Mann ein Lied an. Uns wurde ein Buch auf den Tisch gelegt, in dem das Lied gedruckt stand; ich sang nicht mit, da mir solches Beten und Singen in einer Gaststube zu neu und zu wunderlich vorkam. Alle die Gäste, die jetzt so fromm taten, hatten kurz vorher kein Mitgefühl für Franz empfunden; hatten sich sogar an seiner Qual ergötzt und ihn verspottet. Das machte mich nachdenklich.
Zeitig gingen wir zur Ruhe. Vorher hatten wir uns nach dem Preise des Nachtlagers erkundigt. Unser Geld reichte hin; doch nur noch eine Kleinigkeit blieb uns übrig. Vor dem Schlafzimmer angelangt, mussten wir Halt machen und Rock und Weste ausziehen, worauf zwei Angestellte der Herberge die Kragen unsere Hemden und die Nähte an unseren Unterkleidern einen peinlichen Besichtigung unterzogen. Ich erfuhr, dass jene Gäste, bei denen man verdächtige Zeichen entdeckte, auf einer Strohstreu schlafen mussten. Wir drei wurden als rein befunden und durften in Betten schlafen. Ich teilte mein Bett mit Franz; dadurch ersparten wir dreißig Pfennige.
Der Saal, in dem wir lagen war groß und umfasste viele betten. Alle unsere zahlreichen Schlafgefährten plauderten; doch hörte ich nicht zu, und ich war auch unfähig, selber ein Wort zu sagen. Starr war ich geworden vor Müdigkeit und besaß nicht mehr die Kraft und den Willen, meine Glieder zu rühren…