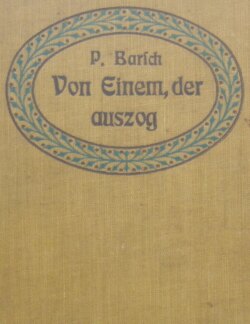Читать книгу Von Einem, der auszog. - Paul Barsch - Страница 12
Der Fechtmeister.
ОглавлениеAls die letzten Häuser hinter mir lagen, ward mir freier und leichter zu Sinn. Die innere Erregung hatte mich schnell vorwärts getrieben, und Franz war ein Stück zurück geblieben. Während ich auf ihn wartete, sah ich, dass hinter ihm drein ein Mann kam, der durch die Art seines Ganges auffiel. Ich glaubte, er sei betrunken, und fürchtete, von ihm behelligt zu werden, da er mit einem Stecken in der Luft herum focht und auch sonst ein wenig gefährlich aussah. Als er näher herangekommen war, sah ich, dass er trotz des nassen Weges und des schlechten Wetters rote Niederschuhe an den Füßen trug. Auch im Übrigen war er so leicht gekleidet, dass es den Anschein hatte, als könnte ihm die Kälte nicht anhaben. Da er eine schwarze Seidenmütze, wie sie von Fleischern getragen wurde, auf dem Kopfe und ein rotes Tuch um den Hals trug, hielt ich ihn für einen Metzgergesellen. Er mochte dreißig Jahr alt sein und hatte einen blonden Schnurrbart. Seinem Gange nach konnte man ihn aus einiger Entfernung wirklich für betrunken halten; denn dieser Gang hatte etwas Trippelndes, Tänzelndes, Stolperndes – und dabei wankte der Mann immer in Zickzacklinien vorwärts. Mich erreichte er gleichzeitig mit Franz.
„Na, Kunden, wohin?“ fragte er mit lauter Stimme.
Ich glaubte, der sonderbare Mensch wolle sich lustig über uns machen, und schwieg daher.
„Donnerwetter, Ihr seid doch Kunden?“ fragte er, auf unsere Bündel deutend.
Ich wusste nicht, was er von und wollte.
„Könnt Ihr die Schnuten nicht ufsperrn, wenn ein tafter Kunde mit Euch spricht?“ Seine Stimme klang schroff – und drohend erhob er die Haselgerte, die er in der Rechten hielt.
Ich verfiel auf die Vermutung, dass der Mann von Sinnen sei. Damit er nicht wütend werde, fragte ich ihn bescheiden, was er von und wolle.
„Die Losung will ich!“ schrie er.
„Was denn für eine Losung?“
„Na, do koof mir eener a Mäßel gebackene Pflaumen! Kennen diese Nashörner die Losung nicht! „Kenn“! ist die Losung „Kenn“! Verstandibus?“
Ich sagte „ja“, obgleich mir seine Worte immer närrischer und rätselhafter vorkamen. Er begann zu lachen und meinte, mir unsere Dummheit könnten wir Häuser einrennen. Solche Nummern seien ihm noch nicht begegnet.
Vor Fleischern besaß ich von frühauf eine mächtige Scheu; daher gewährte mir die Entdeckung, dass der Rock des Mannes mit Farbenschmutz behaftet war, eine Beruhigung. Der Mann war sicher kein Fleischer, er war ein Maler oder Lackierer.
„Ihr kommt von Muttern, Ihr Ignatze“, sprach er und betrachtete uns wohlwollend. „Wie lange seid Ihr schon fort von derheeme?“
Ich gab ihm Auskunft, und er entgegnete, dass wir ihm schon beim ersten Blick grasegrün vorgekommen seien. Schnell kam er wieder auf die Losung zu sprechen und gab uns darüber einige Aufklärungen. „Kunde“, erläuterte er uns, „ist die Losung, „Kenn“ die Gegenlosung. Wenn ich Euch also frage, ob Ihr Kunden seid, wie habt Ihr da zu antworten?“
„Kenn!“ erwiderte ich rasch. Mir war klar geworden, dass das Wort der Handwerksburschensprache angehörte. War etwa der Mann selber ein Handwerksbursche?… Nein, er gehörte wohl nach Lissa, da er ja niedere Tuchschuhe trug. In solchen Schuhen kann doch kein Mensch im Winter wandern!
„Gut gesagt!“ rief er. „Und wohin tippelt Ihr?“
Auch dieses Wort war mir neu und unverständlich.
„Wohin Ihr tippelt?“ wiederholt er heftig. „Ihr Affenpinscher wisst nicht einmal, was tippeln heißt! Das heißt laufen. Könnt Ihr laufen?“
„O ja!“
„Dann vorwärts, wenn Ihr mit wollt! Ich habe nicht Lust, hier bei Euch stehen zu bleiben!“
Er sprach so herrisch, dass wir ihm gehorsam nachfolgten, obgleich ich zum Hinlaufen matt war und Franz an dem gleichen Übel litt. Zwar ging er schnell; doch kam er zu unserem Glück nicht allzu rasch vorwärts, da er kurze Schritte machte, mit den Beinen schlenkerte und bald auf der einen, bald auf der anderen Straßenseite war.
„Schon drei Wochen tippelt Ihr?“ fragte er plötzlich.
„Nein erst drei Tage.“
Er blieb stehen, drückte die Hände in die Seiten und beugte sich vornüber. „Au, au! Ich kriege Leibschmerzen, wenn ich so was höre! Solche Milchgeburten! Mir wird schwach!“ Im Weitergehen behauptete er, ich hätte zuerst gesagt, wir tippelten schon drei Wochen, und beruhigte sich erst, nachdem ich zugegeben hatte, dass ich mich versprochen habe. „Da seid Ihr freilich noch nicht taften! Ihr sollt sehn, dass ich kein schlechter Kerl bin: ich werde Euer Schulmeister sein! Aber ufgepaßt, sonst setzt es verdammte Haue!“ Wieder erhob er drohend die Haselgerte und ließ sie durch die Luft sausen. „Ufgepatzt, Ihr gottverfluchten Hunde!“
Franz sprang erschrocken beiseite; er glaubte, der Wüterich schlüge nach ihm. Dieser lacht gell und sagte dann höhnend: „Hast Du Angst, mein Engel? Komm an mein Herze! Haue gibt’s erst, wenn Ihr nichts lernt… Könnt Ihr schon dalfen? Das heißt so viel wie fechten?“
Ich gestand ihm, dass wir zu furchtsam zum Fechten seien, und hätte ihm gern auch gestanden, dass wir entsetzlichen Hunger litten; doch sparte ich mir die Worte, weil ich überzeugt war, dass er uns nicht helfen könne. In der Absicht, mit bei ihm ein wenig in Ansehen zu bringen, erzählte ich ihm, dass ich schon ein Hühnerei erfochten habe, und wie es mir dabei ergangen war. Er hörte nur mit halben Ohren hin und versicherte mehrere Male, wir wären die dümmsten Käfer, die ihm je begegnet. Überhaupt trug er kein Verlangen, unsere Vergangenheiten kennen zu lernen, obgleich ich ihm gern davon erzählt hätte. Er fragte nicht einmal, welchem Handwerk wir angehörten. Wenn ich von unseren Erlebnissen zu reden begann, ward er sogleich verdrießlich und fing zu spotten an. Dagegen sprach er viel von sich, und auf meine Fragen nach seinen Angelegenheiten gab er bereitwillig Auskunft, allerdings immer nur in prahlerischer Weise. Wie er ernsthaft erklärte, war er der gescheiteste Mensch in Europa. Er lasse sich, versicherte er, keinen Wind vormachen – „von keinem Menschen nich“; er wisse alles und könne alles.
Seiner „Religion“ nach war „Wagenschmierer“, was im gewöhnlichen Leben Lackierer heißt. Er tippelte nur zu seinem Vergnügen. Wenn er wollte, könnte er erste Klasse bis Paris fahren und dort wie ein Graf leben; die Mittel wären vorhanden. Aber das Tippeln sei seine liebste Beschäftigung; daher tipple er. Wohl ein Dutzend Mal erklärte er nachdrücklich dass er aus Berlin stamme. In meiner Unwissenheit zeigte ich bei dieser Mitteilung kein Erstaunen; daher trat er vor mich hin, zwang mich zum Stillstehen, sah mich mit durchbohrenden Blicken grimmig an und wiederholte streng:
„Ich bin ein echtes Berliner Kind, mit Spreewasser getooft! Verstehste, wat det heeßt?“
Jetzt begriff ich, dass ich ein ehrfurchtsvolles Gesicht zu machen habe. Mit meiner Leistung muss er wohl zufrieden gewesen sein; dann er setzte hierauf seine Wanderung und seine Erzählung fort. In Breslau habe er „geschennigelt“ – auf Deutsch: gearbeitet; er habe jedoch seinem „Krauter“- auf Deutsch: Meister – den Krempel vor die Füße geworfen, da er, sobald er Sonnenschein sehe, alsbald das Jucken in die Beine bekomme. Von seinem sechzehnten Jahre an tipple er schon in der ganzen Geographie herum. Darum werde man ihm zugeben müssen, dass er mehr von der Welt verstehe als wir Grünschnäbel. - - Da er nicht immer in berlinischen Tone, sondern meistens in der Mundart unserer Dorfheimat redete, die uns geläufig war, vermutete ich, dass er lange Zeit in Schlesien gelebt habe. Seine Laune war unbeständig und unzuverlässig. Voll herzlicher Vertraulichkeit erzählte er, dass er eine Mutter habe, die in Berlin jeden Tag in die Kirche gehe und auf den Knien bete für ihren Jungen. Er könnte jedes Mal weinen, wenn er an die liebe, herzensgute, fromme Frau denke. Seine Worte waren ergreifend und mir ging das Herz über. Ich fühlte, dass er ein edler Mensch sei, den man lieb haben müsse, und war glücklich, ihn kenne gelernt zu haben. Dass ich auch an meine liebe, herzensgute, fromme Mutter dachte, war natürlich. Halblaut und mit weichen Gefühl sprach ich die Worte: „Meine betet auch für mich.“
Da tat er ein paar Sprünge, als ob er fortlaufen wollte; er schüttelte sich, trippelte dabei im Zickzack und stieß endlich im Tone des Ärgers und der Erregung heraus:
„Tunke! Das ganze Gebet is Tunke! Unsinn is es… O, Ihr Natzla vom Dorfe! Olle mitnander seid Ihr de timmsten Hergotsbrüder!… Ei a Himmel kummen welln se, - ei a Himmel kummen! -… O, Ihr tumme Luder!“
Wieder schüttelte er sich, als ob er etwas Lästiges von sich abwehren wollte. Plötzlich wendete er sich um und sagte in veränderter Tonart – nicht zornig mehr, doch verweisend:
„Du kannst doch nicht Deine Mutter mit meiner vergleichen! Du musst wissen, dass meine Mutter mit Gräfinnen verkehrt und mit der Kaiserin! Mit der Kaiserin is sie befreundet! Verstehste, Du Dämelack!“
Sein Unmut verflog, und er redete wieder traulich von seiner Mutter, seiner Jugend, seiner Ruhelosigkeit. Trotz aller Vorsicht gelang es mir nicht, ihn bei guter Laune zu erhalten. Jede Bemerkung, die ich zu seinen Mitteilungen machte, galt ihm als albern; schwieg ich, so gefiel ihm das erst recht nicht, und dann sagte er, dass er altersschwach zu werden beginne, weil er mit einem Kalbe rede. Im Eifer des Erzählens entfuhr ihm die Mitteilung, dass sein Vater ein alter Breslauer Bürger sei und einmal beinahe Schiedsrichter geworden wäre. Ich wagte nicht, zu fragen, wie es komme, dass sein Vater ein alter Breslauer, er selbst aber ein Berliner Kind sei. Gern rühmte er sich, dass er sämtliche Pennen und Pennebosse – zu Deutsch: Herbergen und Herbergsväter – im ganzen Lande und den umliegenden Staaten kenne; auch hielt er es für einen großen Ruhm, unzählige Male „verschütt“ gegangen zu sein und auf diese Weise die Gefängnisse aller Länder gründlich kennen gelernt zu haben. Auf der „Drehscheibe“ – das heißt: im Arbeitshause – sei er ebenfalls schon gewesen. Erst, wenn man alle diese Dinge kennen gelernt, sei man ein „tafter Kunde“.
Ich freute mich, diesen klugen Menschen gefunden zu haben; in machen Minuten aber ängstigte ich mich vor ihm, besonders, wenn ich daran dachte, dass er schon in allen Ländern eingesperrt gewesen. Ein Schulmeister war er in Wirklichkeit für mich. Durch ihn fand ich bestätigt, was ich manchmal schon als Lehrjunge aus dem Munde der Gesellen vernommen hatte, dass nämlich die Handwerksburschen ihre besondere Sprache hätten. Diese Sprache war mir so interessant, dass ich begierig zuhörte, wenn er mir Unterricht in der Kundensprache erteilte. Dabei vergaß ich den Hunger und die Müdigkeit. - - Franz beteiligte sich nicht am Gespräch. Schwerfällig schleppte er sich hinterdrein und weinte leise vor sich hin. Den fremden Mann aber ließ er nicht merken, dass er weinte. Ich wunderte mich, dass er das Laufen noch immer aushielt.
Ein Dorf kam in Sicht. Mein Schulmeister deutete mit der Haselnussgerte darauf hin, belehrte mich, dass ein solcher Ort „Kaff“ genannt werde, die Bauern demnach „Kaffern“ seien – und dass ich jetzt anfangen müsse, das Dalfen zu erlernen. Er fügte hinzu, dass er Appetit verspüre und in dem Kaff eine guten „Pickus“ – nämlich etwas Zünftiges für den Magen – herausschlagen wolle.
„Schiebt Ihr auch Kohlendampf?“
Ich sah ihn fragend an.
„Ob Ihr Hunger habt. Ihr Schlappschwänze?“
„O ja! Sehr großen!“
„Hunger haben heißt Kohlendampf schieben. Na, da sollt Ihr was erleben! Ihr seid zwar gar nicht wert, dass ich Euch das Dalfen beibringe! Ihr sollt aber sehen, dass ich ein guter Kerl bin!“
Ein Tausch des Frohlockens durchbrauste mich; voll inniger Dankbarkeit sah ich in dem Schulmeister unsern Erretter. Auch Franz hatte begriffen, um was es sich handelte. Er beschleunigte seinen Schritt und ging mir zu Seite. In seine trüben Augen war frischer Glanz gekommen.
„Also, soll ich Euch das Dalfen beibringen oder nicht?“
„Wenn Sie so gut sein wollen . . .“
„Herrgottsapperschieferdach, hört uf, mich zu siezen! Ihr seid zwar Quärge gegen mich; aber ich bin Kunde und Ihr seid Kunden. Uf der ganzen Welt – in Spanien nich und in der Türkei nich – hat noch kein Kunde den andern gesiezt. Passt uf oder es gibt gottverdammte Hiebe! Ick bin een Berliner Kind und verstehe keenen Spaß nich!“
Mir fiel es schwer, den älteren Mann zu duzen, zumal ich einen gewaltigen Respekt vor ihm besaß. Das erste Du kam recht verschämt und kleinlaut von den Lippen.
„Wer von Euch Rindviechern hat den meisten Mumm?“ fragte er, als das Dorf erreicht war. „Du, Dicker“, wandte er sich an mich, „Du siehst am dämlichsten aus. So einen brauch’ ich zum Renommieren. Und Du, Kleener, gehst bis hinter das Kaff und wartest auf uns!“
Ich bekam einen Genickstoß und musste vor dem Schulmeister hertrotten, wie ein Gefangener. „Winde für Winde wird umgestoßen!“ sprach er. „Winde heißt Haus. Die kleenen Kaffern stecken am besten. Wirst Du laufen, Du verkrüppelter Usinger!“ Er versetzte mir wieder einen Stoß und deutete auf eine Zauntür. Da ich nicht schnell genug war, nahm er mich zornig an der Schulter und schob mich zu der Tür hin. Mit kalter Entschlossenheit eilte ich vor ihm her in den Hof.
In dem elenden Hause, vor dem wir standen – dem ersten der Ortschaft – wohnten arme Leute. Am Gatter empfing uns eine Frau, die schrecklich abgezehrt aussah und krank zu sein schien. Sie klagte mit gebrochener Stimme, dass sie bald selber betteln gehen werde, da ihr Haus zu Versteigerung komme. Augenblicklich knöpfte mein Schulmeister den Rock auf und zog aus tiefen Taschen mehrere Stücke Brot hervor. „Für die Hühner, gutes Mutterle!“ sprach er gütig und überreichte der Frau die Bettelstücke.
In mir bäumte sich etwas auf, wie das Gefühl eines erlittenen Unrechts. Franz und ich hatten noch nicht gefrühstückt – und dieser Mensch war wohl eine Stunde lang mit uns gegangen und hatte nicht gesagt, dass er Brot besitze. Jetzt sollten die Hühner das Brot fressen, während Franz und ich vor Hunger beinah umfielen.
„Bezohl’s Euch der liebe Gott!“ sagte die Frau.
Ich fand nicht Zeit, mich der Entrüstung und dem Grame hinzugeben; der Schulmeister ließ mich durch einen Puff verstehen, dass wir bei der armen Frau nichts mehr zu suchen hätten. Flinken Schrittes marschierten wir zum Nachbarhause.
„Hier müssen wir Speck rausschlagen!“ raunte er mir zu.
Mehrere Hunde sprangen uns bellend entgegen. Der Schulmeister fand Vergnügen an den wütenden Tieren. Durch Grimassen, durch Schnalzen mir der Zunge, durch Zischen und krächzende Laute, durch allerhand drohende Bewegungen reizte er sie dermaßen, dass einer von ihnen beim Bellen überschnappte und nur noch heisere Quitschtöne hervorzubringen vermochte. Ich fürchtete, der Bauer werde mit seinen Knechten herbeikommen und uns zum Tore hinaus prügeln. Auch hier erschien eine Frau am Türgatter. Aus zornigem Gesicht warf sie uns feindselige Blicke entgegen. Durch Zurufe suchte sie die Hunde zum Schweigen zu bringen, und zwischendurch gebot sie uns schimpfend, die Tiere zufrieden zu lassen. Ein kalter Schauer durchlief mich, als ich in das abweisende, böse Gesicht der Frau sah, und meine Füße gerieten ins Wanken. Der Schulmeister dagegen rief:
„Ihre Hunde sein ja niederträchtige Äfter! Die fressen einen ja, wenn man sich nicht wehrt!“
Darauf macht er vor dem Gatter eine komische Verbeugung, sagte: „Guten Tag, hübsche, junge Frau!“ und begann eine laute Rede.
„Wie gut, junge Frau, dass wir Sie so hübsch allein treffen!“ – so ungefähr fing er an. „Der Herr Gemahl ist sicher zu Markte gefahren! Er bringt ihnen was Feines mit – was ganz feines! Wir kommen nicht etwa Kälber koofen; wir sind zwei ganz arme reisende und bitten um eine Unterstützung. Sehen Sie bloß das arme Jüngel da an! Das hat eine böse Stiefmutter zu Hause, und weil es immerfort bloß Prügel und Wassersuppe kriegte, ist es fortgelaufen. Jetzt quietsch es vor Hunger. – Immer ran ran, Dicker, dass Dich die Leute ordentlich sehen! Komm, quietsche, dass die junge Frau Deinen Hunger kennen lernt!… Wenn er den Rock auszieht, können Sie seine Rippen zählen. Und wenn ich ihm die Hosen ‘runterzöge, könnten Sie seh’n, wie ihn seine Stiefmutter, die alte Hexe, zerdroschen hat. Mit ’m Besen, mit ’m Rechen, mit der Mistgabel und was sie gerade in die Hände kriegte, schlug sie auf ’n los Ach, gute, liebe Frau, erbarmen Sie sich, sonst verhungert mir der Dingrich unterwegs! Zu Ihnen kommen wir ja ganz gewiss nich umsonst! Ach, Sie glooben ja gar nich, was es hier im Dorfe für geizige Gesellschaft gibt! Wissen Sie, da war da drüben in dem großen Hause eine Frau – pfui, Spucke! So vornehm tat sie, und ihre Nase reckte sie so hoch wie meine Mütze, und nicht ein Stückel trockenes Brot hat sie uns gegeben. Aber dafür geht sie sicher jeden Tag in die heilige Messe. Wissen Sie junge Frau ich und mein Freund hier, dessen Nährmutter ich bin – wir stammen auch von sehr frommen Eltern; wir kennen die heiligen Gebote und halten sie; wir gehen jeden Sonntag, den der Herrgott gibt, in die Kirche, auch manchmal unter der Woche; aber fromm tun, auf ’n Knien rutschen, dem lieben Herrgott die Füße ablecken und arme Leute verhungern lassen – nee, das hat in unserm Katechismus nich gestanden.“
Er hatte so schnell gesprochen, dass er jetzt einer Atempause bedurfte. Anfänglich schien sich die Frau unwillig und verächtlich abwenden zu wollen; dann aber. Als er von der Frau aus dem großen Hause drüben redete, war sie aufmerksam geworden. Der Schulmeister hatte seine hohe Mütze abgenommen und strich mit den Fingern über den glänzenden Stoff. Jetzt stülpte er wieder auf den Kopf und begann abermals zu reden:
„Wir haben seit drei Tagen keinen vernünftigen Bissen in den Mund gekriegt… Ei der Tausend! Schockschwerenot! is das hübsche Mädel da Ihre Tochter? Herrgott, hat die junge Frau schon eine heiratsfähige Tochter? Gar nicht möglich!… Nanu weeß ich genau, was ich zu tun habe! Übers Jahr werde ich Meester, lasse mir von meinen Alten das große Grundstück hinter der Hasenheide vermachten und hol mir das Mädel zu Frau. Ich bin nämlich een echtes Berliner Kind, mit Spreewasser getooft! In Berlin, Mädel, haben Sie’s gut! Da gehen wir im Tiergarten spazieren, und alle Tage sehn wir uns den ollen Kaiser an… Aber Sie, hübsche Schwiegermutter, müssen heut schon einmal den Schlüssel in die Fleischkammer stecken, das geht nicht anders! Denken Sie doch, die Schande, wenn ihr Schwiegersohn so verhungert aussieht!! Sehen Sie und holen Sie uns ein gutes Stück Schinken oder Speck, damit wir wieder zu Kräften kommen!… Potz, Dunnerkeil, is das ’n hübsches, strammes Mädel!“
Mir wurde während dieses Geplappers zum ersten Male völlig klar, dass ich wirklich ein dämlicher, dummer, unbeholfener Mensch war. Wenn ich doch auch so klug gewesen wäre, wie der Schulmeister, und auch so klug hätte reden können! Ach, dann brauchte ich sicher nicht zu hungern in der Welt! Am erstaunlichsten waren die Lügen, die er hervorsprudelte, ohne schamrot zu werden. Dass er der Frau vorgelogen hatte, ich besäße eine böse Stiefmutter, verdross mich, weil es mich wie eine Beleidigung meiner Mutter berührte. Ich erinnerte mich, dass die Mutter mir beim Abschied gesagt hatte, in der Welt gebe es viele schlechte Menschen. Vielleicht war das ein schlechter Mensch?… Er hatte die Bauersfrau offenbar verblüfft durch sein Gerede. Sie schien im Zweifel zu sein, ob sie schimpfen oder lachen, ob sie uns fortjagen oder freundlich behandeln solle. Leise redete sie mit ihrer Tochter, die sich verschämt hinter der Mutter verborgen hielt und nur manchmal flink hervorlugte… Der Schulmeister merkte, dass seine Worte noch nicht genügend eingewirkt hatten auf die zähen Natur der Bäuerin; daher plapperte er weiter, fragte nach dem Ausfall der vorjährigen Ernte und dem gegenwärtigen Preise der Butter. Ohne auf eine Antwort zu warten, erzählte er, was die Butter in Berlin, was sie in Hamburg und in Breslau koste. Dann rühmte er wieder die Schönheit des Mädchens.
„Nun, hören Sie, schöne Frau!“ fuhr er unermüdlich fort. „Sie werden doch nich so sein wollen, wie die andern Frauen hier im Dorfe! Den Geiz dieser Weiber wollen wir in der ganzen Welt verkünden. Nicht wahr, Dicker? Auf ein hübsches Stück Speck kommt es doch bei einer so reichen, hübschen, jungen Frau nich an, überhaupt, wenn sie seine so wunderhübsche Tochter hat. Sein Sie dem lieben Gott dankbar dafür und haben Sie Erbarmen mit ein paar ganz armen Schluckern! Er wird’s Ihnen neunundneunzig Mal vergelten. Wir wollen auch beten, dass Ihre Schweine bis zum Herbste recht fett werden.“
Jetzt wurde der starre Mund der schweigsamen Frau durch ein gewährendes Lächeln bewegt; langsam wendete sie sich zu ihrer Tochter und flüsterte ihr etwas zu. Das Mädchen hüpfte davon und verschwand.
„Nein, im Ernst“, nahm der Schulmeister wieder das Wort, „das Mädel is wirklich eine Pracht! Die würde mancher Graf heiraten, wenn er wüsste, dass sie lebte. Wenn die in Berlin wäre und pikfeine Kleider trüge, da blieben die Menschen vor Erstaunen stehen und sähen ihr auf der Straße nach. Die muss einen reichen Mann kriegen, bei dem sie nicht arbeiten darf. Zehn Dienstmädel und eine Kammerzofe muss sie haben! Passen Sie uf, es kommt noch so weit!“
Er redete immerfort; die Frau jedoch schwieg. Nach einigen Minuten kehrte das Mädchen zurück und hielt ein große Stück Speck in der Hand. Mich ergriff das Entzücken und ein gieriges Verlangen. Aber ein Unglück geschah. Die Frau sah den Speck, riss ihn dem Mädchen unwirsch aus der Hand und wollte in das Haus eilen. Da – in diesem bösen Augenblick vollbrachter der Schulmeister ein großartiges Heldenstück. Mit einem Sprunge war er am Gatter, griff nach der Frau und bekam eines ihrer Schürzenbänder zu fassen. Der Knoten der Schürze löste sich; einen Zornschrei ausstoßend, wandte sich die Frau um, und nun ergriff der Schulmeister ihre Hand. Die Bäuerin schrie und drohte; die Hunde, die sich inzwischen beruhigt hatten, fuhren auf den Schulmeister los; dieser aber rang über das Gatter hinweg mit der Frau und bestürmte sie mit Bitten und Vorwürfen.
„Wollen Sie in die Hölle kommen?“ rief er mit unheimlicher Betonung. „Wollen Sie Ihre Tochter zum Geiz erziehen? Das Mäderl ist ein Engel ohne Flügel… Geben Sie her das Zeug! Es ist nicht zuviel! Sie kennen unsern Hunger nich. So - - wir danken recht schön! Sie sind eine gute Frau!… Weg, ihr verdammten Hunde, ich schlag’ euch tot!“
Er hatte das Stück Speck, das eine halbe Spanne lang war, erobert und schlug jetzt mit der Haselgerte auf die Hunde los. Ob er der Frau den Speck entrissen, oder sie ihn freiwillig losgelassen hatte, blieb mir verborgen. Ich glaubte, das Geschäft sei nun erledigt, und da die Bäuerin tüchtig schimpfte, beeilte ich mich, die Straße zu gewinnen. Ein Zuruf des Schulmeisters zwang mich zur Umkehr.
„Lümmel, haste keene Bildung?“ schrie er mich an. „Rennt fort, ohne sich zu bedanken! Gleich machst Du einen hübschen Knicks!“
Er nahm mich hinten an den Haaren und drückte meinen Kopf vornüber. „So siehst Du, gehört sich’s! Und jetzt bitte hübsch, dass wir noch ein wenig Käse kriegen! Ein paar kleine Kuhkäse! Ich esse sie für mein Leben gern. Man kriegt sie nirgends so gut, wie in dieser Gegend. In Berlin schon gar nicht!… Ach, Sie sind ja eine so reiche Frau, dass es Ihnen gar nicht darauf ankommt! Wenn Sie wüssten, wie Sie uns glücklich damit machen! Bitte, bitte, bitte!“ Dabei klatschte er mit den Händen wie ein bittendes Kind und wehrte mit den Füßen die Hunde ab, die sich jetzt nicht mehr beruhigen wollten. – Die Frau sah ängstlich und verstört aus; sie schien sich zu fürchten vor dem Schulmeister. „Bleib do!“ befahl sie dem Mädchen und ging in das Innere des Hauses. Bald kam sie wieder und reichte schweigend eine neue Gabe über das Gatter: Käse, der in Papier gehüllt war.
Der Schulmeister dankte und lobte wieder die Schönheit des Mädchens. In süßlich-zärtlichen Tone sprach er „Ach, diese lieben Guckäugel! Wenn meine Mutter ihren Sohn verlieren sollte, so ist dieses hübsche Mädel schuld daran. Ich sterbe vor Liebe – vor lauter Liebe! Aber vor meinem Tode möcht’ ich noch einmal frische Butter essen. Ach, Lenchen oder Mariechen oder Ännchen oder Kathrinchen oder Klärchen oder wie Sie heißen: bitten Sie doch Ihre liebe Mama, dass sie uns ein Stückel Butter gibt! Als künftiger Schwiegersohn…„
Er brach seine Rede ab, weil die Frau das Mädchen beiseite riss und die Haustür zuschlug. Ich hörte, dass ein Riegel vorgeschoben wurde, und dass die Frau heftig schalt.
„Fertig!“ sagte der Schulmeister – und wir gingen davon.
„Das war eene dufte Winde. Nicht grade zum Besten; aber immerhin dufte… Haste gesehn, wie’s gemacht wird? Aber wenn Du wieder drei Meilen hinter mir bleibst und die Leute bloß so anglotzt, wie Frosch, kriegste Ohrfeigen! Immer den Rachen ufreißen und ein helles Wort mitreden! - - - Renne doch, Du Gamel! Vor mich hin gehörst Du, nich hinter mich!“
Wieder erhielt ich einen Stoß, dass ich ins Stolpern kam.
„Ich bin im Dalles, Du bist in Kluft. Auf die Kaffern machts einen besseren Eindruck, wenn sie zuerst einen Kerl sehn, der in Kluft ist!“
Wir waren schon wieder in einem Hofe. Diesmal trat uns ein Bauer entgegen. Er zog eine wollene Börse aus der Tasche und gab jedem von uns schweigend und bedächtig einen Zweipfennig. Wir dankten und gingen weiter.
„Mit solcher Sorte is nichts anzufangen“, belehrte mich der Schulmeister. „Man muss es den Leuten gleich an der Landkarte ansehn, was mit ihnen los is.“
Nachdem wir noch einige Bauernhöfe besucht und überall Kupfermünzen empfangen hatten, gelangten wir auf einen herrschaftlichen Gutshof. Vor dem Schlosse befand sich ein großer Garten, und auf einem Sandplatze dieses Gartens spielte ein Husarenleutnant mit feinen Fräulein ein Ballspiel. Ehrerbietig zog ich den Hut, doch dankte mir niemand. Der Schulmeister kniff mich in den Arm und raunte mir zu: „Lauf – oder der Deixel holt Dich! Was gehen Dich die Affen an!“ Auf einem breiten Kieswege liefen wir dem Schlosse zu. Beim Eintritt sagte der Schulmeister: „Jetzt fest druf! Wir müssen die Köchin erwischen!“ Wir traten in einen breiten Flur, der mit bunten Steinplatten ausgelegt war. Aufmerksam musterte der Schulmeister die vielen Türen, schritt dann auf eine zu und pochte. Er pochte stärker und stärker; doch wurde kein Laut von innen her vernehmbar. „Na, denn nicht!“ brummte er. „Ausgestorben kann doch das Nest nich sein!“ Er huschte nach einer anderen Tür und klopfte dort erst leise, dann heftiger und immer heftiger. Schließlich donnerte er mit der Faust an. Da – plötzlich ging die Tür auf, an die er zuerst gepocht hatte, ein weiblicher Kopf kam zu Vorschein und fragte keck und unwirsch, was wir im Schloss zu suchen hätten. Ich, der ich in der Nähe jener Tür stand, brachte erschrocken und stotternd unser Anliegen vor.
„Hier gibt’s nichts! Es ist niemand zu Hause!“ gab das weibliche Wesen zur Antwort.
„Aber, hübsche Jungfer, Sie sind ja zu Hause!“ rief der Schulmeister sogleich und kam schnell herbei. „Sie werden doch zwei hübsche Jungen - - - „
Er brachte den Satz nicht zu Ende. Die Jungfer schrie etwas von Frechheit und die Tür flog zu. „Hier kriegen wir nichts!“ sprach ich beklommen und wollte mich entfernen. „Esel, biste verrückt“? faucht er mich an und ballte drohen die Faust. „Eine solche Winde willste liegen lassen? Du bist der rechte Jakob!“
Er klopfte an die Tür. Keine Antwort. Er klopfte wieder – klopfte in einem fort, so lange, dass mir in meiner Angst die Zeit wie eine bange Ewigkeit erschien. Er klopfte, bis endlich die Jungfer die Tür aufriss.
„Wenn Sie nicht auf der Stelle fortgehen, lass ich die Hunde losbinden!“ rief sie kreischend. Die Tür schloss sich mit lautem Schlag, und wieder war es beängstigend still in dem großen Prachtgebäude… Der Schulmeister stutzte unschlüssig und tat einen Schritt nach der Haustür zu; doch besann er sich schnell, trat zurück an die weiße Tür und klopfte wieder. Dabei zeigt er sich so ruhig und gelassen, dass mich das Entsetzen packte und ich an seiner Vernunft zu zweifeln begann. Er klopfte fortwähren, Wohl zehn Minuten lang und länger, während ich, auf ein Unglück gefasst, fluchtbereit am Ausgange stand. Gern wäre ich davongerannt; doch fürchtete ich den schweren Zorn des bösartigen Menschen.
Das Schreckliche trat ein. Als er einige Male mit der Faust an die Tür gehauen hatte, ging sie zum dritten Mal auf, und diesmal sprang das Weibliche Geschöpf in weißer Küchenschürze wie eine Furie heraus und rannte wild an uns vorbei. „Herr Leutnant, schnell, bitte, schnell! Helfen Sie mir doch! Zwei freche Bummler sind da und geben keine Ruhe!“
Der Unhold, mein Fechtschulmeister, las in meiner Seele. Bevor mir der starke Schrecken Zeit ließ zum Entspringen, fühlte ich eine feste Hand im Nacken, die mich am Kragen hielt. „Hier bleiben, oder der Satan holt Dich!“
Schon kam der Herr Leutnant mit zornglühendem Gesicht herbei gerannt. Die Köchin berichtete ihm keifend und schimpfend von unserer großen Frechheit. Ich ergab mich bebend in mein Schicksal und empfahl meine arme Seele dem heiligen Geist und meinem Schutzengel. Der Schulmeister zog seine Mütze, stellte sich in die Haustür und empfing den Herrn Leutnant mit einer tiefen Verbeugung. Dieser wagte nicht, nahe heranzukommen. Er schnaufte uns an, nannte uns unverschämtes Lumpengesindel und schrie nach den Knechten. Ich zupfte voll Todesangst den Schulmeister am Ärmel, um ihn zum Entfliehen zu bewegen; allein er versetzte mir einen Stoß, verneigte sich abermals und bat den Herrn Leutnant um eine Reiseunterstützung.
Da kein Knecht kam, befahl der Leutnant der Köchin, eine peitsch zu holen. Am Gartenzaun erschien das schöne Fräulein, mit dem er gespielt hatte, und fragte, was geschehen sei.
„Entschuldigen Sie mich, Fräulein Isolde, ich habe hier etwas zu tu!“ rief er und richtete sich hoch auf, als gelte es einen Kampf auf Leben und Tod, und als wollte er der Dame einen Beweis seiner großen Tapferkeit liefern. So gefährlich sah er aus, dass ich gar nicht anders konnte, als mit kühnem Sprunge die Freiheit suchen. Am Schulmeister vorbei und am Herrn Leutnant vorüber entfloh ich aus dem Garten in den Hof und gewann von dort aus glücklich die Straße. Keiner war so flink, mich festzuhalten. Im Davonlaufen sah ich, dass die Köchin mit einer großen Peitsche über den Hof gelaufen kam und ein Mann ihr nachfolgte. Ich lief eine Strecke weit auf der Dorfstraße fort und stellte mich dann hinter einen Baum, der am Wege wuchs. Lange hatte ich nicht zu warten auf den Schulmeister.
„So ’ne miese Winde is mir in meinem menschlichen Dasein noch nich begegnet!“ hörte ich ihn schon von weiten schimpfen. Als er mich erblickte, kam er grimmig auf mich zu, schlug mit der Faust nach mir und schalt mich einen miserablen Feigling, der die gesamte Kundenehre besudelt habe. In jäher Empörung über diese schimpfliche Behandlung griff ich nach einem Steine; doch bevor ich ihn dem Schulmeister ins Gesicht schleudern konnte, bekam ich einen Fußtritt, dass ich in den Dorfgraben glitt, in dem sich eine schlammige Wassermasse befand. „Ersauf Kanickel!“ schrie er und trippelte weiter, die Straße hinab.
Doch ich ersoff nicht. Ein Stiefel nur hatte Wasser geschöpft. Bewegte ich den Fuß, dann gab es im Stiefel ein unangenehmes Quappen und Quirlen. Aus Furcht, der Leutnant könne uns die Knechte nachsenden und uns einsperren lassen, nahm ich mir nicht Zeit, den Stiefel auszuziehen und den flüssigen Inhalt heraus sickern zu lassen; hinkend suchte ich mich schnell in Sicherheit zu bringen.
An Schläge war ich gewöhnt. In den Schuljahren waren mir an jedem Tage meine Prügel beschert worden, und während der Lehrzeit arbeiteten in unserer Werkstadt fast immer Gesellen, die mit Ohrfeigen nicht sparten. Dennoch hatte mich die durch den Lackierer erlittene Misshandlung dermaßen gekränkt und in Wut versetzt, dass ich in den ersten Minuten fähig gewesen wäre, ihn aus Rache totzuschlagen. Als ich den Graben bereits verlassen hatte und nassen Fußes flüchtete, war ich noch immer willens, dem verhassten Menschen mit einem Steine den Hinterkopf zu zerschmettern, Dann empfand ich, dass es feig sei, einen Menschen von hinten anzufallen, und ich schämte mich meines feigen Rachegedankens. Nach und nach gestand ich mir auch zu, dass ich wenig tapfer gewesen sei, und dachte milder über den Schulmeister. Sein Gesicht war mit Blut gefleckt gewesen: wahrscheinlich hatte er mit dem Leutnant einen harten Kampf zu bestehen gehabt. Er besaß Mut, ich nicht; er hatte mich im Zorn über meine Feigheit geschlagen, und ich hatte die Schläge verdient. Als die Köchin die Peitsche gebracht, hätte ich den Schulmeister nicht in der Not verlassen sollen, schon aus Dankbarkeit dafür, dass er mich im Fechten unterweisen wollte… Am Ende des Dorfes sah ich ihn bei Franz stehen; beide schienen auf mich zu warten. Ich getraute mich nicht zu ihnen heran und war daher sehr froh, als mit der Schulmeister zurief:
„Immer dalli, dalli!“
Mit Schimpfreden empfing er mich und erzählte Franz, wie erbärmlich ich mich betragen habe. Wenn er statt eines Hasenfußes eine taftene Kunden bei sich gehabt hätte. Lägen jetzt die Knochen des Leutnants auf dem Misthaufen! „Haut mich der Hund in die Fisasche! Aber einen Schubs hat die Kanaille von mir gekriegt, dass sie fünf Schritte weit an den Zaun flog!“
Er tastete mit den Fingern nach der Wunde im Gesicht und ich sah, dass sich ein blutiger Striemen über seine linke Wange bis hinauf nach der Stirn zog. Das Auge war rot und verschollen. Dann gab er mir den Befehl, in das Kaff zurück zu gehen und in der nächsten Winde Pfeffer und Salz zu dalfen.
Der Auftrag war mir willkommen. Ich konnte ihn als eine kleine Buße betrachten und zugleich ein Beispiel meines Mutes liefern. Mit dem Wasser im Stiefel wankte ich in das nächste Haus und bat um Pfeffer und Salz. „Wir haben ein Stück Speck gekriegt“, erzählte ich offenherzig, „und haben kein Geld auf Pfeffer und Salz.“
„Salz können Sie kriegen; Pfeffer haben wir selber nicht:“ Schließlich entdeckt aber die Frau, die das sagte, dass auch noch einige Körnchen Pfeffer im Hause waren, und zu meiner hellen Freude konnte meine Bitte erfüllt werden. Siegesfroh lief ich nun zu den Gefährten.
Auf einem Steinhaufen wurde gegessen. Der Schulmeister zerschnitt mit seinem Messer den Speck in drei gleiche Teile und zog Brot aus seinem Rockfutter.
Währen meine Lehrzeit hatte ich mir oft eingebildet, dass ich Hunger leiden müsse; den wirklichen Hunger aber hatte ich nur zum ersten Male kennen gelernt. Die Sonne war bereits im Sinken; wir waren meilenweit gelaufen und hatten noch nicht gefrühstückt und auch sonst nichts währen der langen Zeit genossen. Gierig biss ich in das Brot, gierig in den Speck und dachte dabei, dass mir noch kein Essen so gut gescheckt habe, wie dieses. Franz macht beim Kauen ein andächtiges Gesicht, als verrichte er ein hochernstes Geschäft, und schlang die Speise so schnell hinab, dass die Pupillen seiner großen Augen beängstigend hervorquollen. Der Schulmeister schimpfte noch immerzu auf mich; doch zürnte ich ihm nicht mehr, da ich mir der Dankbarkeit, die ich ihm schuldete, tief bewusst war.
Auch den Käse verteilte er gleichmäßig, und als das Essen vorbei war, versetzte er uns in Erstaunen und Verlegenheit, indem er von dem erfochtenen Gelde nur den dritten Teil für sich behielt und die andern beiden Teile uns gab. Ein Pfennig, der beim Teilen übrig geblieben war, wurde verlos. Wir baten ihn, wenigstens zwei Teile des Geldes für sich zu behalten; doch da wurde er schlimmer Laune und erklärte, dass er ein ganz miserabler Kunde wäre, wenn er nicht ehrlich teilen wollte. Die Reichen seien Gauner und Spitzbuben; der Kunde müsse ehrlich sein. Wenn wir ehrliche Kerle wären, würden wir ihm nicht den Rat geben, unehrlich zu teilen.
Die Luft war kalt geworden und ein scheidender Wind wehte immer schärfer; daher blieb der Schulmeister nicht lange sitzen. Ich hätte gern noch länger gesessen, trotz des Windes und der Kälte und meines nassen Fußes, denn meine Müdigkeit war gar zu arg… Unterwegs fragt der Schulmeister plötzlich, welcher politischen Partei wir angehörten. Franz gestand, dass er von solchen Dingen nichts verstünde; ich aber glaubte, mit meiner Belesenheit Staat machen zu können. In der Meinung, den Beifall des Schulmeisters zu finden, erklärte ich, dass ich nationalliberal sei. In der Zeitung nämlich, die mein Meister mitgehalten hatte, war die nationalliberale Partei immer gelobt worden; somit hatte sie meine Anerkennung gefunden. Wie die anderen politischen Parteien hießen, war mir unbekannt.
„Was?“ fragte der Schulmeister verdutzt, und sprang zur Seite und über den Straßengraben hinweg. „Du bist nationalliberal?“ forschte er drüben vom Feldrande aus in einem Tone, der höchste Verwunderung, Hohn und Verachtung zugleich in sich schloss. „Wenn Du etwa nach Leubus zu den Verrückten willst, so haste hier nicht weit!“ Er sprang zurück auf die Straße und dann wieder über den Graben. „Dieser schifbeenige Schöps is nationalliberal!… Bist Du’s wirklich?“
„Warum denn nicht?“ fragte ich beleidigt.
Statt zu antworten, hob er einen Ackerklotz auf und schleuderte ihn nach mir. „Mach, dass du fort kommst! Mir aus den Augen, Du nationalliberales Luder! Wenn ich einen Nationalliberalen sehe, muss ich speien. Mir wird schon viel übel!“
Seinen Grimm meidend, ging ich ihm aus dem Wege, so gut ich konnte. Da ich meine politische Wissenschaft aus der Zeitung geschöpft hatte, zweifelte ich nicht, dass ich in dieser Streitfrage der Kluge, er der Dumme war. Sein Zorn schien aber diesmal nicht so arg, als ich befürchtet hatte. Er kam an mich heran und fragte spöttisch, ob ich denn wisse, was nationalliberal sei. Er glaube nicht, dass ich es wisse; denn ich sei viel zu dämlich dazu.
O, ich wusste genau, was nationalliberal ist! Das Unglück war nur, dass ich nicht gleich die rechten Ausdrücke zur Erklärung fand. Ich wusste, dass die Nationalliberalen kluge und gelehrte Menschen waren, dass sie die Pfaffen hassten und den gehörnten Siegfried, Otto von Bismarck, liebten. Außerdem hatte das Wort „nationalliberal“ einen schönen, erhebenden Klang. Als ich endlich meine Sinne soweit gesammelt hatte, dass ich hätte reden können, ließ mich der Schulmeister nicht mehr zu Worte kommen. Er spottete über meine Dummheit und sagte, dass er Sozialdemokrat sei. Mir wurde ein wenig ängstlich zumute, denn ich war gewohnt, unter einem Sozialdemokraten einen verrohten, zerlumpten und gefährlichen Schnapsbruder zu verstehen. In der Stadt meiner Lehrjungenjahre war diese Anschauung vorherrschend. Wenn ein verwegen und verschwiemelt aussehender Kerl sich auf der Straße blicken ließ, hieß es: „Das ist sicher ein Sozialdemokrat.“
Nachdem sich der Schulmeister eine Zeitlang über meine geistige Beschränktheit lustig gemacht und geärgert hatte, sprach er, es sei wichtig, dass ich mich von ihm belehren lasse. Jeder Kunde sei verpflichtet, Sozialdemokrat zu sein. – Mein Gemüt lehnte sich auf gegen diese Verpflichtung; doch verhielt ich mich ruhig, weil ich ihn nicht reizen wollte und weil ich belehrende Reden zu hören hoffte.
Er sagte, die Nationalliberalen seien noch schlechter als die Konservativen; die Konservativen aber stammten von den Raubrittern her, die nur vom Raube gelebt und sich auf Kosten des arbeitenden Volkes gemästet hätten. Das Rauben liege ihnen noch immer im Blute. Die armen Leute müssten schwer arbeiten für schäbigen Lohn, damit die Reichen – die Konservativen nämlich und die Nationalliberalen – Millionäre würden und fette Bäuche bekämen. Das müsse anders werden; eine große Revolution müsse anbrechen. Dann hielt er einen langen Vortrag, in dem ich oft das Wort „Überproduktion“ zu hören bekam. Der Kunde, der nicht arbeite, sondern in der Welt umher tippele, leiste dadurch dem Staate einen Dienst, da er sich nicht an der Überproduktion beteilige. In der Welt stelle man viel mehr Waren her, als die Menschen verbrauchen können. Schon auf Jahre hinaus sei die Welt mit Waren versorgt, und dennoch arbeiteten die Maschinen Tag und Nacht weiter. Das sei ein schlimmer Fehler. Er wolle nur an die Schuster erinnern. In Berlin gebe es eine Fabrik, die mache jeden Tag viele hundert Paar Schuhe und Stiefel fertig. Außerdem seien in Berlin mindestens zehntausend Schuhmachermeister, dreimal so viele Gesellen und zehnmal so viele Stifte. Da wäre es doch klar wie Tinte, dass so viele Maschinen und Menschen viel mehr Schuhe und Stiefel fertig brächten, als gebraucht würden. Die schreckliche Folge davon sei, dass die Schuhmacher, um ihre Kundschaft zu erhalten und neue zu finden, immer billiger und billiger arbeiten müssten, die Gesellen immer schlechtere Löhne bekämen und die Stifte immer mehr Hunger zu leiden hätten. Auch stehe der Zeitpunkt bald bevor, da es überhaupt keinem Schuster mehr möglich sein werde, Arbeit zu bekommen, außer Flickarbeit, da die Welt bereits überfüllt sei mit fertigem und billigem Schuhwerk. Schon jetzt habe er viele Schuhmachermeister kennen gelernt, die wegen Mangel an Arbeit fechten gehen mussten.
Ich lauschte diesen Reden mit Spannung, und vor meinen geistigen Blicken enthüllten sich mächtige Bilder, die überraschen neu für mich waren. Was der Schulmeister von den Schuhmachern sagte, leuchtete mir ein. Wenn ich mir vorstellte, wie lange ein Paar Schuhe oder Stiefel aushalten müsse, bis ein neues Paar gekauft werde, und wenn ich an die vielen Schumacher dachte, die in allen Orten zu sehen waren, so begriff ich gar nicht, dass sie noch immer Arbeit finden konnten und nicht schon seit langem allesamt fechten gingen. Dachte ich gar an die Fabrik in Berlin, in der täglich viele hundert Schuhe hergestellt wurden, so fragte ich mich, warum denn die Minister so unverständig sei, eine solche Fabrik zu dulden. Wenn ich Minister wäre, hätte ich sie längst verboten. Die unglücklichen Meister und Gesellen in Berlin und die hunderttausend hungernden Stifte taten mir herzlich leid; eine schwarze Bangigkeit erfüllte mich bei dem Gedanken an das Elend, das ihnen noch drohte. Auch vom Tischlerhandwerk redete der Schulmeister und sagte, dass die Tischler noch schlimmer daran wären als die Schuster, da ein Schrank zwanzig bis dreißig Jahre, ein Schuh aber höchstes ein Jahr aushalte. Bei dieser Erklärung, die mir durchaus richtig erschien, verlor die Welt auf einmal allen Glanz für mich. Stumm und in starrer Hoffnungslosigkeit schritt ich neben dem Schulmeister dahin. Dieser meinte, dass heutzutage ein Bauernknecht besser daran sei, als ein Tischler. Mein Vormund hatte gewollt, dass ich Bauernknecht werde; er hatte gesagt, für das Handwerk fehle mir die nötige Grütze. O, wie war ich dumm und verblendet gewesen, als ich darauf bestand, Tischler zu werden! Jetzt sah ich meinen Untergang kommen! Es wäre ja frevelhaft von mir gewesen, einen Meister um Arbeit zu bitten, da doch bald die Zeit kommen musste, die allen Tischlermeistern durch Überproduktion den Zwang auferlegen würde, selber zum Bettelstab zu greifen!
Ich erfuhr durch den Schulmeister, dass die Ursache dieser schauderhaften Übelstände in dem vielen Arbeiten zu suchen sei. Wenn man täglich nur zwei bis drei Stunden arbeiten wollte – etwa von acht Uhr früh bis zehn oder elf Uhr vormittags –, dann wäre die Welt gerettet, dann würde man so viele Arbeitskräfte brauchen, dass jeder Kund bald Arbeit bekäme und keiner mehr zu tippeln brauchte. Alle Menschen könnten dann gute Tage erleben; die Löhne wären auf einmal hoch, die Überproduktion hätte ein Ende, die fertigen Waren fänden den raschesten Absatz.
Gegen die Forderung, dass der Mensch jeden Tag nur drei Stunden arbeiten solle, sträubte sich mein Gemüt. Es fiel mir ein, dass wir einmal einen Sarg zu bauen hatten. Für eine dicke Gastwirtin war er bestimmt. Alle in den Sargmagazinen vorrätigen Särge hatten sich als zu schmal erwiesen. Hätten wir täglich nur drei Stunden arbeiten dürfen, wäre der Sarg erst nach Tagen fertig geworden und zu spät gekommen. Gegen die Forderung des Schulmeisters sprach übrigens auch das Gebot Gottes, das da sagt, dass der Mensch sechs Tage arbeiten und erst am siebenten ruhen solle. Sie erschien mir als etwas Ungeheuerliches, das ich nicht zu erfassen vermochte. Eine andere Stimme meines Innern jedoch raunte mir zu, dass der Schulmeister vielleicht auch in diesem Punkte klüger sei, als ich, und dass ich mich daran gewöhnen müsse, solche großartigen Gedanken zu begreifen. Mein anfänglicher Glaube, von Politik mehr als der Schulmeister zu wissen, war bereits kläglich zerstoben; daher beugte ich mich vor seiner Klugheit. Nicht um mein Wissen zu bereichern, sondern um ihm fühlbar zu machen, dass ich imstande gewesen, seiner Rede zu folgen, richtete ich die Frage an ihn, wie man es den Menschen beibringen könnte, täglich nur drei Stunden zu arbeiten. Weshalb ihn diese Frage beleidigte, weiß ich nicht. Wir Brausewasser fuhr er auf, schnellte plötzlich seitwärts, bebte vor Wut und sagte:
„Du bist tümmer, wie ein pulsches Weib! Der reene Kürbis bist Du! Die reene Wassertonne! Ein ausgemachter Strohwisch! Um jedes Wort is es schade, das man zu so ’nem Klumpen Unverstande redet!“
Doch – er redete weiter; allerdings erst, nachdem sein Zorn verbraust war. Nun erläuterte er mir, dass die Sozialdemokraten berufen seien, die Welt von allen Übeln zu befreien. Noch ungefähr fünf Jahre werde es dauern, dann seien fast alle Menschen Sozialdemokraten. Die gegenwärtige Regierung hole dann der Schinder. Sämtliche alten Gesetze würden abgeschafft und durch neue ersetzt. Der gesamte Ackerboden werde als Staatseigentum erklärt und zu gleichen Teilen unter die Menschen verteilt, bis jeder ein Stück Acker habe. Auf seinem Felde könne dann jeder nach Belieben arbeiten; sonst aber sei zu Vermeidung der Überproduktion das überflüssige Arbeiten bei Gefängnisstrafe verboten. Das Militär werde abgeschafft. Jeder Mann müsse schießen lernen, wie es Sitte sei in der Schweiz, und wenn es zu einem Kriege komme, müsse jeder sein Gewehr nehmen und das Land verteidigen. Richter brauche man dann nicht mehr, das es keine Spitzbuben mehr geben werde. Jeder Mensch hätte ja satt zu essen, und somit sei das Stehlen überflüssig. Die Mörder würde man durch Volksgerichte verdonnern, manchmal auch freisprechen. Wenn nämlich jemand einen schlechten Kerl totschlage, sei das kein Verbrechen, sondern eine gute Tat. Heutzutage strotze die Erde von Ungerechtigkeit. Der eine besitze zehntausend Morgen Land, der andere nichts. Wenn aber ein armer Teufel sich ein wenig ins Gras lege, so komme der Gendarm und sperre ihn ein. Das sei erklärlich, da doch die Gesetze von reichen Ruppsäcken gemacht würden. Später werde das Volk die Gesetzte machen. Heute sei es so: wer Millionen zusammengaunere und stehle, bekomme Orden; wer aus Hunger eine Wurst stibitze, komme ins Zuchthaus. Der Dummkopf könne heute, wenn er Beamter sei, gescheite Menschen anschnauzen; später würden die Dummköpfe das Maul halten müssen. Zum Schluss erfuhr ich noch, dass die Sozialdemokraten große Staatswerkstätten gründen werden, aus denen jeder Staatsangehörige jährlich zwei Anzüge, zwei Paar Stiefel und viele andere Dinge bekommen solle, die zum Leben nötig seien. Dafür habe dann der Empfänger weiter nichts zu zahlen, als seine Steuern.
Nachdem ich diese Erklärungen vernommen, war ich nicht mehr nationalliberal. Sozialdemokrat aber auch nicht; denn obzwar ich jetzt den Schulmeister als einen Propheten und Welterretter betrachtete, gelang es mir nicht, den Widerwillen gegen die Sozialdemokraten aus meiner Seele auszurotten. Er war darin zu fest gewurzelt. Mir wurde klar, dass es zwei Sorten von Sozialdemokraten gäbe: ein, die klug sei und die man lieben, eine andere, die Branntwein trinke und die man fürchten müsse. Der klugen Sorte, zu der ich den Lackierer zählte, gehörte mein Herz. Sehnlich wünschte ich die baldige Ankunft der glücklichen Zeit, die er verkündet hatte, und wenn er verlangt hätte, ich solle schwören, dass ich mich an der ausbrechenden Revolution beteiligen werde, würde ich sofort mit ehrlichem Gewissen geschworen haben. Doch ich wollte kein Sozialdemokrat sein; das Wort hatte für mich einen abscheulichen Klang.
Ob Schiller ein Sozialdemokrat gewesen war?… Die Frage kam mir plötzlich in den Sinn, und ich zögerte nicht, sie auszusprechen.
„Schiller? Und ob der einer war, Du Schafskopf! Schiller und Goethe gehören zu uns! Kennst Du nicht das Lied: Zu Mantua in Banden?“
„Den Anfang kenn’ ich!“
„Solche Lieder muss man ganz auswendig kennen. Das hat Schiller gedichtet und das ist ein sozialdemokratisches Lied, Du Holzkopf!“
Ich hatte das Gedicht in dem Buche von Schiller nicht gefunden und glaubte daher, dass es in einem der Bänder enthalten sei, die ich nicht kannte. Meine Bewunderung wuchs immer mehr; ich zählte den Lackierer jetzt zu den Gelehrten und Gebildeten, da er Schiller und Goethe kannte. Ich bat ihn, das Lied einmal aufzusagen, damit ich es auswendig lernen könne; diese Bitte verdross ihn aber und er sagte nur – dabei begann er zu springen und sich zu schütteln – das Lied sei viel zu gut für mich; ein solcher Einfaltspinsel, wie ich, brauche es nicht zu hören! Das war die schlimmste von allen Schmähungen, die ich bisher durch ihn erduldet hatte. Er hielt mich nicht für würdig, ein Gedicht von Schiller zu hören – mich, der ich doch die innerste Überzeugung hegte, dass Schiller der beste, der edelste und berühmteste aller Menschen war, und der ich doch Bescheid wusste in der Dichtkunst. Ich war ein unbeholfener und erbärmlicher Mensch; ich gab dem Lackierer im stillen recht, wenn er mich einen Schafskopf, einen Holzkopf und einen Einfaltspinsel nannte; doch in meinem Innern lebte etwas Heiliges, Hohes, Großes und Starkes, durch das ich zuweilen emporgehoben wurde aus meiner Niedrigkeit – hoch empor, so dass ich mich geistig verwandt fühlte dem großen Friedrich von Schiller; und wenn dieses wunderbare Heiligtum meines Lebens verkannt und verhöhnt wurde, so lehnte mein Stolz sich trotzig auf und der Zorn bewegte mir die Lippen zu scharfer Abwehr des verletzenden Hohns. Aber ich war gezwungen, die Lippen geschlossen zu halten und die Schmähung still zu erdulden. Hätte ich dem Lackierer erklärt, dass ich selbst ein Dichter sei und vielleicht einmal ein sehr berühmte Mann sein werde, würde er mir keinen Glauben geschenkt und mich entsetzlich verspottet haben. Er hielt mich ja für so grenzenlos dumm… O, hätte ich ihm doch das vertauschte Kind vorlesen können! Aber – er ließ mich ja nie zu Worte kommen!… Wenn ich doch Arbeit fände! Und wenn der Meister ein freundlicher Mann wäre! Wie ich dann schuften und nebenbei dichten wollte! Und Ruhm wollte ich mir dann erwerben, gewaltig viel Ruhm, dass die Welt über erstaunen sollte! Dann müsste auch der Lackierer zu mir kommen und reuevoll eingestehen, dass er mich einst böse verkannt habe. Um Verzeihung sollte er mich bitten und zu Strafe das Lied „Zu Mantua in Banden“ hersagen. An diesem Gedanken richtete sich mein verwundeter Stolz wieder auf – und der ohnmächtige Grimm legte sich…
Auch der Lackierer wurde wieder guten Sinns. Er zog einige gedruckte Papiere aus der Tasche und sagte, das seien sozialdemokratische Flugschriften. Eines der Blätter gab er mir zur Ansicht und erklärte, es sei von allen Blättern das Beste. Als er zum ersten Male gelesen, habe er sich halb tot darüber gelacht. Ich las es, doch verstand ich den Sinn des Inhalts nicht recht. Es handelte von einem Oberst in Dresden. Er war mit Namen genannt und führte den Beinamen Quarkmichel. Seine Soldaten hießen Latschkenfritzen.
Der Schulmeister entriss mir das Blatt. „Du verstehst ja doch nicht davon, Du Dämlack!“ rief er grob. „Mit so einem Säugling lässt unsereiner sich ein!… Geh’ mir aus den Augen!“ Wütend erhob er die Haselgerte zum Schlage, und ich wich zurück. In Zickzacklinien trippelte er ein Stück vorwärts, wandte sich dann nach mir um und schalt mich ein nationalliberales Luder. Ich wagte irgendein keckes Gegenwort und reizte ihn dadurch noch mehr zu Wut. Er drohte, mich totzuschlagen und in den Graben zu werfen, hielt mir wieder die Feigheit vor, deren ich mich dem Leutnant gegenüber schuldig gemacht, und schrie, ich hätte einen Kunden schändlich in Stich gelassen, weshalb kein tafter Kunde mehr mit mir reden und mit mir tippeln dürfe. Eine miserable Schildkröte sie ich, ein Lump. Vor Hunger solle ich im Graben krepieren, und die Raben mögen mich dann fressen…
„Komm, Kleener, wir beede tippeln zusammen!“
Diese Aufforderung war an Franz gerichtet, der bislang schweigend und teilnahmslos, nur über sein Unglück nachsinnend, hinter uns drein marschierte. Jetzt blieb er stehen und schien unschlüssig zu sein, welcher Partei er sich anschließen solle. Ich erkannte an seinem Gesicht, dass er geneigt war, meinem Feinde zu folgen. Da ergriff ich ihn fest am Arme – ich weiß nicht, aus welcher Ursache – und schrie ihn an:
„Du gehörst zu mir!“
Durch diese Heftigkeit gewann ich ihn für mich. Auf sein unentschlossenes Gemüt wirkte sie entscheidend.
„Na, kommste, oder kommste nicht?“ rief der Lackierer fragend.
Da presste ich den Arm des Freundes noch fester. „Du gehörst zu mir!“
„Nehmen Sie’s nicht übel! Er ist mein Lehrkollege!“ sagte Franz bittend.
Der Lackierer lachte gell, und sein Lachen war Wut. „Nehmen Sie’s nicht übel!“… äffte er in verzerrten Lauten meinem Begleiter nach und wand sich dabei vor Wutlachen. „Einen Kunden redet diese Kreatur mit „Sie“ an. Und mit solchen Mücken hab ich mich abgegeben!“ Er stand vor uns, höhnte, schimpfte, fuchtelte mit der Hasengerte und drohte, uns umzubringen. In weiter Runde war kein Mensch zu schauen, der uns hätte zu Hilfe eilen können; dem Zorne des schrecklichen Menschen waren wir preisgegeben. Langsam wichen wir zurück; er aber kam uns immer näher, und seine Gerte fauste dicht vor meinem Gesicht. Ich hielt Franz noch immer fest. Darüber ärgerte sich der Lackierer anscheinend am meisten; aus seinen Schimpfreden ging das hervor. - - Wir befanden uns in der Nähe eines Fahrweges, der von der Landstraße ab nach einem Dorfe führte, das ungefähr eine Viertelmeile seitab lag. Rasch kam mir der Einfall, auf diesem Wege mit Franz davon zu laufen. Auf der menschenleeren Straße konnten wir nicht bleiben. Eine Versöhnung mit dem Lackierer war jetzt nicht mehr möglich; das las ich aus seinen furchtbaren schwarzen Augen. Unseres Lebens waren wir nicht mehr sicher und mussten daher aus seiner Nähe zu entweichen suchen.
„Komm schnell!“ raunte ich Franz zu, und raschen Schrittes ging ich nach dem Seitenwege. Franz kam so langsam nach, dass ich umdrehen, ihn bei der Hand nehmen und fortzerren musste. Der Lackierer blieb zurück. Er schimpfte und fluchte in einem fort. Schon glaubten wir, ihm entronnen zu sein, da kam er uns wie ein Rasender nachgerannt. Wir liefen, so schnell wir konnten; doch der Boden war aufgeweicht und lehmig und der Lackierer hatte schnellere Füße als wir: In meiner Todesangst sprang ich auf ein Ackerfeld, watete tief durch den aufgeweichten Boden und gelangte auf einen Feldrain. Franz, der mir nachgekommen war, stürzte in der Nähe des Feldraines hin, blieb auf dem Bauche liegen und brach in ein weinendes Heulen aus.
„Steh’ doch auf!“ schrie ich und wollte ihn empor reißen. „Er kommt ja schon!… Er bringt uns um!… Wir müssen uns wehren!“
Franz wollte aber nicht ausstehen. Immer tiefer wühlte er sich in den nassen Ackerboden und schien in wahnsinniger Angst darauf zu warten, dass er totgeschlagen werde. Diese erbärmliche Feigheit bracht mich in so wilden Zorn, dass ich die klare Besinnung verlor. Wütend stampfte ich mit dem Stiefel auf den unzuverlässigen Gefährten; dann schlug ich ihn mit dem Stocke, schlug mit aller Kraft, Hieb auf Hieb, und während er sich hilflos und grässlich schreiend im Schmutze wand und der Lackierer nun auf dem Feldraine auf mich losgestürzt kam, fuhr ein Jubelgefühl der Kraft in meine Glieder; eine luftige Taumelwut überkam mich; alles war mir gleichgültig geworden – Tod und Leben, Himmel und Hölle. Ich bebte in rasender Streitlust, in Vernichtungsfreude. Die Haselgerte des Todfeindes traf mich; sie brannte mir auf dem Kopfe, im ganzen Gesichte. Dunkel wurde mir vor den Augen; doch verließ mich die starke Kraft nicht. Blindlings und in Todeslust wehrte ich mich mit meinem Stecken; Riesenstärke verspürte ich in mir; ich drehte mich wie im Wirbel und schwenkte den Stock über dem Kopfe und fühlte, wie der Stock sein Ziel traf; ich sah, wie der Lackierer taumelte, wie ihm die Gerte entfiel, wie er mit vornüber gebeugtem Körper auf mich losfuhr; ich fühlte seine Hand an meinem Halse – er packte mich an der Brust; den Stecken ließ ich fallen und hieb dem Feinde mit der Faust ins Gesicht, riss ihn am Ohre und kratzte ihn. Da ließ er mich los, presste beide Hände an die Augen und taumelte zurück. Kein Wort sprach er, keinen Laut gab er von sich. Einer seiner Schuhe lag zu meinen Füßen; die Mütze hatte der Wind ins Feld getrieben. Ich stampfte den Schuh in den Ackerschlamm und eilte auf den Weg, von dort nach der Landstraße.
Franz hatte sich aufgerafft und kam mir nun nach. Mein Mut war verflogen; die seltsame Kraft hatte mich verlassen und ich fürchtete die Rache des Lackierers. Alle meine Sinne waren auf schnelle Flucht gerichtet; zugleich aber beseelte mich der trotzige Wille, den feigen Freund seinem Schicksal zu überlassen. Schwer gestraft sollt er werden für seine Feigheit.
Auch diese Racheglut währte nur wenige Minuten. Bald wich sie dem Mitleid und meinem bangen Empfinden, dass ich einen Wanderkameraden nicht entbehren könne. Denn der Gedanke an das Alleinsein schreckte mich, und da ich den Lackierer nicht mehr sah, vorläufig also sicher vor ihm war, überwand ich schnell den spärlichen Rest von Rachetrotz und wartete auf Franz… Er sah schlimmer aus als ein Ziegelmacher, der das ganze Jahr hindurch seine Kleider nicht wechselt. Auch sein Gesicht war gänzlich mit Erde beschmutzt. Er hatte viel geweint; das sah ich an den Streifen, die sich feucht über seine Wangen zogen. Die Tränen rannen noch immer, er schluchzte und wimmerte, ließ aber kein Wort des Vorwurfs vernehmen.
„Du musst Dich waschen!“ sprach ich. „Jetzt aber noch nicht; zunächst müssen wir sorgen, dass uns der Lackierer nicht kriegt.“ Nun strebten wir, so schnell es ging, zurück auf der Straße; dabei sah ich mich oft nach dem Lackierer um. Da ich ihn nicht erblickte, wandelte mich die Furcht an, dass ich ihn vielleicht gefährlich verletzt habe. Es schien mir, als sähe ich ihn am Feldrain liegen und qualvolle Schmerzen erdulden. Ob ich ihm ein Auge ausgestoßen?… Oder ob er von meiner Faust tödlich getroffen worden?… Wenn er gar stürbe… Und wenn es herauskäme, dass er den Tod durch mich empfangen?… Wenn der Gendarm mich festnähme?… Wenn ich dem Scharfrichter überliefert würde?… O, meine liebe Mutter!… Und was würde der Vormund sagen?… Doch, der Gendarm konnte ja nicht wisse, wer den Lackierer umgebracht! Und wenn er’s erführe – nun, so war ja Franz mein Zeuge! Franz konnte mit gutem Gewissen sagen, dass ich mich nur gewehrt habe… Manchmal wurde meine von Furcht verfinsterte Seele durch lodernde Siegesfreude erhellt. Ich, der schwächliche, verschüchterte Junge, hatte einen Menschen besiegt, der im Vergleich mit mir ein Riese war. In meinem Siegerstolz kam ich mir vor wie ein richtiger König David. Dann wieder war mir, als müsse ich laut weinen, weil doch er, der Ärmste, den ich vielleicht zu Krüppel geschlagen mein Erretter und Wohltäter gewesen.
„Er kommt – er kommt!“
Franz schrie diese Worte im Tone des ärgsten Entsetzens und rannte flüchtend an mir vorbei. Er kam wirklich – der Lackierer. Noch war er weit hinter uns; leicht hätte ich mit Franz entfliehen können; aber die Füße wurden mir plötzlich so schwer, dass ich nicht zu rennen vermochte. Ob der Schrecken und die Angst mich gelähmt hatten – ob ich glaubte, dass ein Entlaufen zwecklos wäre, da wir dem schnellfüßigen Feinde kaum entkommen konnten – ob es mir schimpflich vorkam, die Flucht zu ergreifen – – ich weiß es nicht. Kraftlos fühlte ich mich und machtlos; mit Grauen sah ich, wie der wütende Feind auf mich zugelaufen kam, wie sein schwarzer Blick voll tödlichen Hasses starr auf mich gerichtet war, wie seine Faust sich drohen erhob; ich wusste, dass er mich elend oder gar tot schlagen würde – dennoch blieb ich gelassen. Rasch betete ich einen Spruch und rief dem fliehenden Freunde die Bitte zu, mir beizustehen… Mein Blick fiel auf einen Haufen klein geklopfter Steine, die zur Ausbesserung des Weges dalagen und sogleich erklang in mir eine Stimme: „Wehr Dich mit Steinen! Es geht auf Tod und Leben!“
Von einem Schulgefährten, dem Sohn eines Dominialschäfers, hatte ich gelernt, mit Steinen leicht das Ziel zu treffen. Im Vertrauen auf dieses Können stellte ich mich an den Steinhafen und hob einige Steine auf. Alle Willenskraft bot ich auf, um mich mit kalter Entschlossenheit zu wappnen. Der Lackierer hatte das Aufheben der Steine bemerkt; nun hemmte er seinen wilden Ansturm und versah sich gleichfalls mit Steinen.
„Mach’ Dein Testament, Du Hund!“ erscholl es auf seinem Munde.
Ich zielte und warf – zielte und warf wieder. Ein Stein, den der Lackierer geschleudert hatte, traf mich am Schienbein. Aber ich fand nicht Zeit, auf den Schmerz zu achten, da der Gegner abermals auf mich zugestürzt kam. Mit fieberhafter Schnelligkeit und voll Todesfurcht schleuderte ich Stein auf Stein, und so gelang es mir, ihn zum Zurückweichen zu bringen. Jetzt endlich gewann Franz den Mut, heranzukommen und mir beizustehen, Mein Erfolg hatte ihn dreist gemacht. – – Der Kampf nahm ein Ende, und der Lackierer begnügte sich schließlich, uns zu drohen. Wir drohten ebenfalls, und ich forderte ihn mit prahlerischen Worten auf, heranzukommen. Mein stiller Wunsch war aber, dass er uns fernbleiben möge. Mit Freuden sahen wir, dass sich einige Lastwagen näherten. Anfänglich war ich in Angst, weil der Lackierer – von den Wagen gedeckt – leicht an uns heran hätte kommen können; er blieb aber zurück, und so konnten wir im Schutze der Fuhrwerke weiter marschieren.
„Ihr führt wohl Krieg?“ fragte einer der Kutscher.
„Ja! Der dort will uns prügeln. Nehmen Sie uns doch ein Stück mit!“
Ein Kutscher gestattete uns, aufzusteigen, und so waren wir einstweilen geborgen. Wir fuhren ungefähr eine halbe Meile weit; dann langten wir auf dem Dominium der Fuhrleute an. Im Dorfe verließen wir die Straße, um den Verfolger von seiner Fährte abzubringen, und wanderten auf einem schmalen Fahrwege weiter. Unterwegs redeten wir von unserem glorreichen Siege, und ich verlangte fortwährend von Franz, dass er sich über meine Tapferkeit erstaunt zeige.
„Nicht wahr, so ’was hättest Du mir nicht zugetraut?… Was sagst Du dazu?… Wenn er wieder an mich herangekommen wäre – mausetot hätt’ ich ihn geschlagen! Mir sieht’s keiner an, was ich für einer bin. Wenn ich Soldat werde, und es kommt ein Krieg, so sollst Du was erleben!... Hast Du gesehen, was für Angst er zuletzt vor mir hatte?“…
So prahlte ich eine lange Weile mit meinem Heldentum, und Franz hörte geduldig zu. Dabei litt ich den ganzen Tag und auch während der folgenden Tage an Furcht vor einer neuen Begegnung mit dem Lackierer. Ich glaubte, er werde in den Dörfern nach uns fragen und unsere Spur verfolgen. Mehrere Male geschah es, dass wir vor friedfertigen Personen davonliefen oder uns verbargen, weil sie in der Entfernung dem Lackierer ähnlich sahen. In den Rocktaschen trugen wir beständig Steine, um gerüstet zu sein, wenn er etwa plötzlich aus einem Hinterhalt auf uns zustürzen sollte. Franz musste geloben, mit mir sein Leben zu wagen für unsere Ehre.