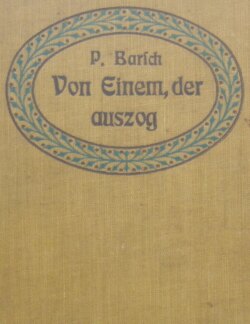Читать книгу Von Einem, der auszog. - Paul Barsch - Страница 6
Meine Mutter.
ОглавлениеIch besaß keine Heimat mehr. Von Stunde zu Stunde kam mir dieses wehe, trostlose Gefühl deutlicher zum Bewusstsein. Die Mutter war gut zu mir und sorgte für mich mit opferfroher Liebe. Sie ehrte mich, wie einen lieben Gast, und buk mir zu Ehren Tiegelkuchen. Doch ich war eben nur noch Gast in ihrem Stübel; ich gehörte nicht mehr zu ihr. Mit weichen, schonenden Worten gab sie mir das zu verstehen.
Der Vater war seit mehreren Jahren tot. Die Mutter hatte unser Häuschen verkauft und sich freie Wohnung im Stübel ausbedungen. Der Kaufvertrag enthielt die harte Bestimmung, dass ich nur bis zum sechzehnten Jahre berechtigt sei, bei der Mutter zu wohnen. Wolle sie mit mir zusammenleben, so müsse sie in eine andere Wohnung ziehen. Der Hauswirt, ein schrullenhafter Mensch, fasste die Bestimmung so auf, dass ich ohne seine Erlaubnis nicht einmal bei der Mutter übernachten dürfte. Nur auf vieles Bitten hin gestattete er ihr zögernd, mich einige Tage lang zu beherbergen. Die Mutter grämte sich, weil sie in diese Stelle des Vertrages eingewilligt hatte; sie meinte, Mutter und Sohn gehörten von Natur aus zusammen. Doch während ihre Tränen noch flossen, widersprach sie ihrer eigenen Rede. Sie sagte, wenn die jungen Schwalben flügge seien, müssten sie das Nest verlassen und sich selbst ihr Futter suchen. So sei es überall in der Natur, und ich müsse daher, da ich nun siebzehn Jahre zählte, auf Selbstständigkeit bedacht sein.
Bei solchen Reden beschlich mich eine große Bangigkeit. Ich kam mir vor, als sei ich überflüssig in der Welt, und ich fühlte nicht die Kraft, mir einen sicheren Platz unter der Menschheit zu erringen.
Das Stübel war ein kleiner Anbau aus Lehm. Es mochte wohl schon hundert Jahr alt sein, da es dem Einfallen nahe war. Von allen drei Seiten war es mit Baumpfählen gestützt, und sowohl im Winter, als auch im Sommer waren die Außenwände mit Laub und dürren Kartoffelkraut bekleidet, weil sonst durch die vielen Löcher und Brüche Regen, Schnee und Wind eingedrungen wären. Der Raum, den zwei Betten, ein Tisch, ein alter rissiger, rauchgeschwärzter Kachelofen, ein Glasschrank, eine Kommode und zwei Stühle übrig ließen, war so eng, dass zwei Personen kaum zur Not sich darin bewegen konnten. Trotzdem war das Stübel hübsch und traulich. Alle die Gegenstände riefen Erinnerungen an meine Kindheit in mir wach; ich betrachtete sie gern, und oft erfasste mich ein Erstaunen, weil ich Eigenheiten an ihnen wahrnahm, die mir früher entgangen waren. Am liebsten sah ich den Glasschrank. Hinter blank geputzten Scheiben standen in drei Fächern viele feine bemalte Kaffeetassen und Andenken an berühmte Wallfahrtsorte. Am schönsten schien mir eine Kapelle aus Porzellan, in der ein goldener, verschnörkelter Hochaltar mit einem Muttergottesbilde zu sehen war. In geschliffenen Gläsern lagen bunte Ostereier, rote Äpfel, merkwürdig gewachsenen Melonen und geweihte Gebilde aus Wachs, wie sie der Jungfrau Maria von kranken Menschen als Opfer dargebracht werden. Auch Wachsstöcke und farbige Kerzen waren vorhanden, darunter die heilige Totenkerze, die gebrannt hatte, als der Vater und die Geschwister starben… In einem Fache fiel eine reichhaltige Bilderausstellung auf. Dort waren alle die Heiligen, die dem Herzen der Mutter besonders nahe standen, in bunten Bildern versammelt. Auch unheilige Bilder befanden sich in dieser Versammlung. Da war zum Beispiel ein Schornsteinfeger, der eine Müllerin küsste. Dann ein betrunkener Mann, der aus dem Gasthause kam und dem ein Affe im Nacken saß. Verschiedenartige Einladungskarten erinnerten an Tanzkränzchen und Wurstabendbrote längst vergangener Jahre. An den Wänden hingen Wallfahrtsmadonnen, Heiligenbilder, Papst Pius und die eingerahmten Patenbriefe.
Die Mutter war arm. Für das Haus hatte sie nur wenige hundert Taler bekommen, und der größte Teil dieses Geldes war bei der Tilgung der Schulden zerflossen. Sie bestritt ihren Lebensunterhalt auf verschieden Weise. Gewöhnlich arbeitete sie als Tagelöhnerin bei den Bauern. Sie verstand auch, die Nadel gut zu führen. Nicht nur Mägde, auch Bauersfrauen ließen Schürzen, Röcke und Jacken von ihr anfertigen. Von Vater, der Tischler gewesen, hatte sie verschiedene Künste erlernt, die sie ebenfalls zu ihrem Nutzen verwertete. Zuweilen polierte sie bei Gutsherrschaften alte Möbel frisch auf und leimte herab gefallene Zierstücke fest. Sie flocht Stuhlsitze und strich Hof- und Gertenzäume, Tore, Türen, Fenster und Geräte mit Ölfarben an. Das ganze Jahr hindurch war sie immerzu beschäftigt, und wenn sie in ihren Lohnforderungen nicht gar zu bescheiden gewesen wäre, hätte sie ein gutes Auskommen haben können. Geld bekam sie selten; gewöhnlich nur Ersatz für ihre baren Auslagen. Als Lohn für ihre Mühe erhielt sie Brot Speck, Fleisch, Kartoffeln und Erbsen. An Lebensmitteln war sie manchmal so reich, dass sie die Armen des Dorfes beschenken konnte. Solches Wohl tun war ihre beste Freude. Sie bildete sich dabei ein, dass sie im Überfluss lebe. Obwohl sie zu manchen Zeiten viele Tage lang kein Geld besaß und in arger Bedrängnis schwebte, klagte sie nie über Armut. Sie war ganz anders, als andere Frauen. Auch die reichsten Bäuerinnen jammerten gern über schlechte Zeiten und machten dabei Gesichter, als wühlte der Hunger bereits in ihren Leibern. Meine Mutter rief dann lachend: bei ihr sei keine Not; sie habe mehr Schuldner, als der Großbauer. Gegen das Armsein und Entbehren müssen hegte sie einen tiefinnerlichen Widerwillen. Viele Leute, die von ihr beschenkt wurden, besaßen Acker, Vieh und Haus und wohl auch mehr Geld als die Mutter; dennoch wurden sie von ihr als arme Leute bedauert. Oft erklärte sie, dass sie sich schon längst ein Sofa beim Sattler bestellt hätte, wenn nur das Stübel nicht zu klein dazu wäre.
Ungemein stolz war sie auf die Achtung, die sie genoss. Herkommen und Sitte brachte es mit sich, dass zwischen reichen und armen Dorfbewohnern eine strenge Scheidung bestand. So würde ein Bauer seinen Wert preisgegeben und das Ansehen des ganzen Standes geschädigt haben, wenn er sich im Wirtshause mit einem Häusler oder gar einem Inwohner an einem Tisch gesetzt hätte. Bauern, die mehr als fünfzig Morgen Acker besaßen, genossen das Recht, in der Nebenstube des Kretschams zu sitzen, wo der Herr Schullehrer und der Herr Kaplan saßen. Die Kleinbauern ließen sich in der großen Stube nieder, in der die fremden Fuhrleute verkehrten; sie hielten aber darauf, dass sie mit geringen Leuten, die als Inwohner oder Knechte im Dorfe lebten, nicht in Berührung kamen. Die Hofarbeiter durften sich überhaupt nicht niedersetzen. Verging sich einer gegen diese Sitte, so galt er als frecher Mensch. – Auch die Frauen bildeten unter sich gesellschaftliche Gruppen. Bei ihnen traten die Standesunterschiede am deutlichsten in der Kirche und während des Heimganges aus der Kirche zutage. Die reichen Frauen saßen in den vordersten Bänken, und nach beendetem Gottesdienste gingen sie miteinander; Frauen aus den ärmeren Ständen durften sich nicht zu ihnen gesellen.
Meine Mutter machte eine glückliche Ausnahme. Mit den drei reichsten Bauersfrauen des Ortes war sie herzlich befreundet, und herzlich waren auch ihre Beziehungen zu vielen anderen Frauen. Auch unter den Hofarbeitern, die zu der niedersten Menschensorte gerechnet wurden, befand sich eine Frau, mit der sie einen festen Seelenbund geschlossen hatte. Als Ratgeberin in schweren Herzensfragen genoss meine Mutter vieles Ansehen, auch als liebevolle Trösterin im Kummer. Da sie kein Geheimnis verriet, das ihr anvertraut worden, kamen viele Menschen, die sich von Gewissensschuld bedrückt fühlten, zuerst zur Mutter, bevor sie zur Beichte gingen. Sie wurde zu Hilfe gerufen, wenn Eheleute in schlimmen Zwist geraten waren; ungehorsame Söhne und Töchter musste die zur Besserung ermahnen; verlassene Bräute kamen zu ihr, wenn sie des Trostes bedurften. Aus eigenem Antriebe mischt sie sich nie in fremde Angelegenheiten; erst wenn sie als Richterin oder Helferin oder Trösterin angerufen wurde, folgte sie dem Rufe, und es lag dann etwas Feierliches, Priesterliches in ihrem Wesen. Als weise und gelehrt galt sie, obgleich sie nur wenige Bücher gelesen hatte und selten eine Zeitung in die Hände bekam. Zu den Talenten, deren sie sich gern rühmte, gehörte ihre gute Handschrift, und sie behauptete mit Stolz, fehlerfrei schreiben zu können.
In meinem Heimatdorfe wurde viel gelesen, aber nur in Heiligenlegenden, Räubergeschichten und vielen kleinen Heften, in denen berichtet war von den Schicksalen arme Seelen, die im Jenseits keine Ruhe fanden und des Nachts auf die Erde zurückkehren mussten. In Wäldern und Sümpfen, an Kreuzwegen und Grenzgräben, auf Kirchenhöfen, in Scheunen und Gärten und Kellern irrten sie in schauriger Mitternacht oder an heißen Nachmittagen, wenn die Sonne brannte und kein Lüftchen sich regte, suchend umher, bis sie endlich durch ein gewisses Gebet erlöst wurden. Das gewisse Gebet war in der Regel am Schusse des Heftes abgedruckt. Einmal kam durch einen jungen Mann, der die Schriftsetzerei erlernt hatte, ein hoch gelehrtes Buch in das Dorf. Ein gelehrter Professor, der zugleich Arzt war, hatte das Buch geschrieben. Es handelte vom Wohnsitze der Seele im menschlichen Körper. Die Seele wohnt nicht in der Brust; sie wohnt im Kopfe, ganz dicht unter der Schädeldecke, in einem Gehäuse, das nicht größer ist, als ein Hirsekörnchen. Sie hat die Farbe der Luft und ist daher unsichtbar. Beim Tode des Menschen entflieht sie durch den Mund, nachher findet sie den Weg durch die feinsten Ritzen oder durch das Schlüsselloch. Ich bekam das Buch in die Hände, las es, verstand aber sehr wenig davon, da es eine Menge von Worten enthielt, die mir fremd waren. Die Mutter aber las das Buch mit Verständnis und sprach dann oft mit anderen Frauen darüber. Ich hörte zu und erstaunte dabei über die Klugheit meiner Mutter. Sie sagte, dass die nun genauen Bescheid wisse über die Seele, und dass die Leute gewöhnlich eine gänzlich falsche Vorstellung davon hätten. Dringend empfahl sie, beim Sterben eines Menschen ein Fenster oder die Tür zu öffnen, damit die Seele auf schnellem Wege zu Gott gelangen könne, und nicht nötig habe, nach einer Ritze oder einem Schlüsselloch zu suchen… Bei Kinderkrankheiten oder Krankheiten der Haustiere wurde meine Mutter gleichfalls zu Rate gezogen. Sie heilte nicht nur mit Kräutern und anderen gegenständlichen Mitteln, sie heilte auch durch geheime Bannsprüche und wirkungsvolle Gebete, durch das Auflegen der Hände und sonderbare Gebärden. Sie „besprach“ den Kindern das „Fröschel“ – eine Halskrankheit, die ich nicht näher kennen gelernt habe – und befreite die Pferde durch ein Sympathienmittel von den Würmern. Während meiner Lehrlingszeit las ich einmal, dass Sympathiemittel in das Bereich des schwärzesten Aberglaubens gehörten, und dass sehr viel Dummheit dazu nötig sei, an ihre Wirkung zu glauben. Da ich alles, was in der Zeitung und in Bücher stand, für unbedingt zuverlässig und wahr hielt, kam ich zu der bitteren Erkenntnis, dass meine Mutter dumm und abergläubisch sei. Mit schwerem Herzen nahm ich mir vor, sie vom Irrtum zu erretten. Als sie eines Sonntags zum Besuch bei mir weilte, begann ich zaghaft von den Sympathienmitteln zu sprechen. Sie sah mich fragend an, und der gütige Ausdruck ihres Gesichtes schwand. Ich erschrak vor ihrem forschenden Blick und hätte gern geschwiegen; doch sie verlangte zu wissen, was ich sagen wollte. Umständlich und verlegen erzählte ich ihr, was ich gelesen hatte, und als sie merkte, wohin ich mit meiner Weisheit zielte, unterbrach sie mich hart:
„Sei stille! Du gleebst, Du bist klug, und Du weest nich, wie tumm Du bist! Der Glaube tutt Wunder! Doas merk Der fersch ganze Leben!“
Ich habe nie wieder gewagt, sie zu bekehren.
So war meine Mutter.
Über meine Heimkehr freute sie sich nicht. Sie ließ sich von mir über das Verschwinden des Meisters berichten und fragte, was ich nun beginnen werde.
„Mir einen neuen Meester suchen“, erwiderte ich.
Sie schwieg nachdenklich, als könne sie an die Geschichte vom Verschwinden das Meisters nicht recht glauben; doch äußerte sie kein Wort des Zweifels und war und blieb sanft. Am anderen Morgen führte sie mich zum Vormund, einem reichen Bauern. Sie hielt es für ihre Pflicht, ihm sogleich das wichtige Geschehnis zu melden und mich zu seiner Verfügung zu stellen. Er fuhr mich rau an:
„Du bist durchgebrannt! Der Teifel bricht Dir’s Genicke, wenn Du mich beleugst! Olle Knuchen schlo ich Dir atzwee!“
Ich beteuerte, dass ich nicht gelogen habe, worauf er in milderem Tone erklärte, dass er zu Markte nach der Stadt fahren und sich nach meinem Meister erkundigen werde. Damit war der Besuch beendet. Der Vormund wechselte noch leise ein paar Worte mit meiner Mutter und geleitete uns an die Haustür. Während wir dann über den weiten Hof schritten, versicherte mir die Mutter, er sei ein sehr guter Mann und aufrichtig für mein Wohl bedacht. Ich solle mich über seine Grobheit nicht ärgern; ein richtiger Vormund müsse streng sein. – Unser Weg ging durch die Scheune und den Garten, da wir „hinter den Zäunen“ schneller nach Hause kamen als auf der Dorfstraße. Im Garten stürzte plötzlich ein Weib auf mich los, schlug mich und schimpfte schrecklich.
„Du meschantes Früchtel!“ schrie das erboste Weib. „Wenn Dich Deine Mutter lieber derwegt hätte, wie De uf de Welt kamst! Nä, a su anne Schande fer de ganze Verwandschaft!“
Ungebärdig stritt ich gegen das alte Weib für meine Freiheit. Die Mutter kam mir zu Hilfe.
„Loß da Jungen zufrieden!“ befahl sie gebieterisch und ergriff meine Feindin an den Händen. Mir gelang es, mich frei zu machen und zu entschlüpfen. Jetzt richtete die Alte ihren Unmut gegen die Muttter.
„Der liebe Goot werd Dich schun strofn, derfiere, dass De und Du tust da kriewatschige Balg afu verziehr! Wenn De und Du hätt’st ’n olle Tage tüchtig dorchgehaun, do hätt’ as schun ausgehalen beim Meester und wär nich ausgerückt, dar Bengel, dar rotzige!“
Die Mutter gab ihr den Rat, sie möge nur die eigenen Kinder gut erziehen; dann folgte die mir nach und sagte, ohne sich weiter zu kümmern um das schmutzige Geschimpfe, das hinter uns erschall: „Se is halt afu! ’s de enzige Schwaster vu Deinem Voater, und Du musst se achten!“
Meine Tante, die, gleich meiner Mutter, Witwe war, lebte mit ihren beiden Kindern in größter Dürftigkeit. Wegen ihres Lästermundes und ihrer Klatschsucht war sie sehr gefürchtet. Sie arbeitete damals bei meinem Vormunde, und zufällig hatte sie die groben Worte vernommen, mit denen ich vom Vormund empfangen worden war. Sogleich war sie überzeugt gewesen, dass ich meinem Meister durchgebrannt sei, und um den Leuten zu zeigen, dass sie auf Familienehre halte, war sie über mich hergefallen.
Mir zuliebe ging die Mutter vormittags nicht in Arbeit. Ich trug in mir das brennende Verlangen, ihr zu sagen und zu beweisen, dass ich ein Dichter geworden sei, und dass sie stolz auf mich sein könne. Dieser Vormittag schien mir als geeignete Zeit zur Ausführung meines Vorhabens. Sie sollte das Vertausche Kind lesen und daraus ersehen, dass ich der Verwandtschaft keine Schande mache, sondern das Zeug und den Willen besaß, ihr die höchsten Ehren zu bereiten. Ach, wie schade, dass das Stück nicht fertig war! Wenn ich wenigsten alle die Brettstückchen hätte mitbringen können, auf denen die neuesten Reden aufgeschrieben standen! Sicher gingen mir die kostbaren Brettstückchen verloren!… Der Gedanke an den Verlust brachte mich dem Weinen nahe… Die Mutter hatte sich auf den Stuhl gesetzt und das Stickzeug ergriffen. Jetzt war die rechte Zeit gekommen. Ich zog das Heft aus der Tasche; doch in dem Augenblick, in dem ich es vor sie hinlegte, übermannten mich Scham und Widerwillen, und es kostete mich Mühe, die Worte hervorzuwürgen:
„Das hab’ ich gedichtet.“
Mir war, als entblößte ich mein innerstes, geheimstes Leben und müsse vor Scham zerfließen. Ich wollte davonlaufen; doch die Begierde, das staunende Gesicht der Mutter zu sehen, zwang mich zum Bleiben. Ich stand im dunklen Winkel zwischen Bett und Glasschrank, verfolgte lauernd das Spiel ihrer Mienen und wartete auf die Laute, die ihre Lippen sprechen würden.
Zuerst betrachtete sie die schlecht zusammengehefteten Blätter flüchtig; dann blätterte sie darin, las hier und da einen Satz und begann endlich von vorn zu lesen. Keine Spur von Überraschung, von Erstaunen, von Freude zeigte sich in ihrem Gesicht; sie schien noch nicht zu wissen, was meine Gabe bedeutete und was sie damit anfangen sollte. Sie las die erste Seite nicht zu Ende, legte das Heft aufs Bett, erhob sich, ging zum Ofen und schürte das Feuer. Als sie wieder auf dem Stuhle saß, nahm sie abermals das Strickzeug und ließ mein Heft auf dem Bette liegen.
Da krampfte sich mein Herz zusammen, und Schmachgefühl und Verzweiflung schnürten mir fast die Kehle zu. Alle meine Lebensfreude war tot. Mein ganzes Dasein war mit einem Male wertlos geworden. Was galt mir das Leben ohne den Ruhm! Und was galt mir der Ruhm, wenn meine Mutter nicht stolz auf mich war, und wenn sie nichts verstand von meinen Dichtungen. Gehetzt von entsetzlichen Gedanken und Gefühlen lief ich hinaus, klomm über den Gartenzaun und rannte über das Schneefeld in eine Sandgrube. Dort warf ich mich hin und weinte und schrie. Immer deutlicher kam mir die entsetzliche Wahrheit zum Bewusstsein, dass ich bei der Mutter nie ein rechtes Verständnis finden könne für mein heiligstes Streben, und dass ich verlassen und dass ich verlassen und verloren sei. Johann und Franz waren ja auch kalt geblieben bei den ersten Akten des Vertauschten Kindes; aber so gleichgültig wie die Mutter hatten sie sich nicht gezeigt. Die Mutter – meine liebe, liebe Mutter! – war kalt und gleichgültig geblieben! Ein paar Zeilen nur hatte sie gelesen von dem Werke, das mich berühmt machen und auch ihr zu unermesslicher Ehre verhelfen sollte! Der Name von Schillers Mutter war ja auch nur deshalb gedruckt worden, weil der Sohn Berühmtheit erlangt hatte…
Meine Mutter hatte mich missachtet und beleidigt, indem sie mein Werk missachtete! Sie hatte mein heiliges Vertrauen zu ihr vernichtet für alle Ewigkeit! Immerzu sah ich im Geiste, wie sie beim Lesen des ersten Blattes sich langweilte und dann das Heft nachlässig aufs Bett warf… Ich war verloren… Ich schrie und heulte immer lauter und wälzte mich dabei im Schnee und im Sande. Da ich nur dürftig gekleidet war, fror mich in dem kalten Winde, und ich nahm mir vor, zu Hause auf den Boden zu steigen, mich ins Stroh zu verstecken und dort weiter zu weinen.
Als ich auf den Boden schlüpfen wollte, öffnete die Mutter die Stübeltür. Ich wischte rasch meine Tränen fort; doch sie merkte, dass ich geweint hatte.
„Was is Dir Denn?“ fragte sie.
„Nichts“ log ich.
Sie befahl mir, ins Stübel zu kommen. Dort führt sie mich zum Fenster, blickte mir ins Gesicht und sagte, ich müsse etwas auf dem Gewissen haben. Mein Gesicht sei verstört, und sie merke mir an, dass ich geflennt habe. Sie könne die Angst nicht loswerden, dass ich in der Stadt irgendetwas Böses begangen habe.
„Gestieh mir’s ei!“ bat sie freundlich und zärtlich.
Der ungerechte Verdacht reizte meinen ohnehin arg verletzten Stolz, und fand den Mut, im schroffen Tone zu antworten:
„Geh doch in die Stadt und frag!“
Da ward ihr mildes Gesicht finster; ihre Hand zuckte auf, und mich traf ein derber Backenschlag.
„Lümmel!“ schrie sie zornerregt. „Du willst Deiner Mutter übers Maul fahren? Noch emol a sittes Wurt – und fer Dich is kee Platz meh eim Stübel… Itz wirst Du Kartuffeln schäl’n!“
Gehorsam setzte ich mich nieder und schälte Kartoffeln. Meine Seele war voller Trotz; doch sah ich mich gezwungen, ihn zur verbergen. Ich durfte die Mutter nicht weiter reizen, sonst hätte sie mich unbarmherzig zum Vormund geführt, und dieser wäre dann schauderhaft grob gewesen. Sie setzte sich gleichfalls an den Tisch und beschäftigte sich mit einer Näharbeit. Mit verstohlenen Blicken sah ich, dass ihre Augen feucht von Tränen waren. Abermals marterte mich ein schneidender Seelenschmerz. Das war jetzt nicht mehr das sterbensbittere Gefühl des verkannt Seins – das war brennende Reue. Ich hatte der Mutter wehgetan! Wenn ich doch die Macht besessen hätte, sie zu umarmen und küssend um Verzeihung zu bitten! Den Willen dazu besaß ich; doch eine unerbittliche Gewalt in meinem Inneren hielt mich zurück. Wenn ich das Heft ansah, das auf dem Bette lag, ward mir wieder schwarz vor den Augen, und mit den glühenden Gefühlen meiner Liebe begannen andere Gefühle, die da behaupteten, ich sei meiner Mutter fremd geworden, ein stürmisches Ringen. So blieb ich sitzen, schälte Kartoffeln und geriet aus einer verzweiflungsvollen Stimmung in die andere. Wie recht hatte doch Tante Barbara gehabt, als sie sagte, für mich wär’s besser gewesen, die Mutter hätte mich bald nach der Geburt erwürgt.
Die Nacht meiner Pein wurde manchmal ein wenig erhellt durch den leisen Strahl der Hoffnung, dass die Mutter sich im Laufe des Tages auf das Heft besinnen, darin lesen und endlich den hohen Wert meiner Dichtung erkennen werde. Sie wusste vielleicht gar nicht, um was es sich handelte, und hatte möglicher weise meine Erklärung, dass ich das Stück selbst gedichtet habe, nicht verstanden oder für einen Scherz gehalten. Dann sagte ich mir wieder, dass die Mutter, wenn sie Verständnis für die Dichtkunst besäße, das Heft nicht vorzeitig weggelegt, sondern in einem Zuge bis zum letzten Wort ausgelesen hätte. Die Einleitung gehörte ja zu den großartigsten Stellen des ganzen Buches. Der Ritter erzählte den Vögeln des Waldes, dass er einst ein guter Mensch gewesen. Er habe eine Grafentochter geliebt, so heiß und treu, wie sonst auf Erden kein Mensch lieben könnte; sie aber habe ihn verschmäht, und da sei er ein Wüterich geworden, der nach schrecklicher Rache lechze. Sie habe nun ein Kind bekommen von seinem Nebenbuhler; das wolle er rauben, und keine zehntausend Höllengeister könnten ihn an dieser Tat hindern. Die Vögel des Waldes sollten Zeugen seines schrecklichen Schwures sein. Mitten in dieser herrlichen Rede hatte die Mutter zu lesen aufgehört…
Der tosende Aufruhr in meiner Seele wollte sich lange nicht bezwingen lassen, und als er sich endlich gelegt hatte, waltete an seiner Statt eine hoffnungsleere, dumpfer Ergebung. In mancher Minute sehnte ich mich nach einem erlösenden Worte aus dem Munde der Mutter; doch sie sprach es nicht aus und griff auch nicht nach dem Vertauschten Kinde. Ihre Teilnahmslosigkeit reizte mich zu neuem Grimme, zu neuer Empörung, und ich nahm, ohne dass sie es merkte, das Buch und trug es hinaus, in der Absicht, es zu zerreißen und die Fetzen dem Winde zu überlassen. Die Schuld, dass unsere Familie nun unberühmt bleiben und ihr letzter Sprosse kein großer Dichter werden würde, sollte auf das Haupt der Mutter kommen. Draußen riss ich das Heft quer durch entzwei; gleichzeitig aber erschrak ich über mein Beginnen und gebot meinen Händen Einhalt. So zwecklos mir auch das ganze Dasein und alles, was damit zusammenhing, geworden war, - ich fühlte mich doch nicht fähig, meine Dichtung zu vernichten. Statt die Blätter in den Wind zu schleudern, trug ich sie auf den Boden, umhüllte sie sorgfältig mit Papier und versteckte sie hinter einem Dachsparren. Jetzt grämte ich mich, weil ich die schönen, sauber beschriebenen Blätter zerrissen. Jeder Bogen Papier hatte zwei Pfennige gekostet.
Abend erinnerte sich die Mutter an das Heft. Sie fragte, wo es sei.
„Aufgehoben hab ich’s,“ erwiderte ich.
„Woas war’s denn, woas De da ufgeschrieben hast?“
„Ein Theaterstück!“
„A Theaterstück?“
„Ja, ein Theaterstück!“
In dem tone, in dem ich meine Antworten sprach, musste etwas liegen, das ihr auffiel. Sie fragte betroffen:
„Derf ich’s nicht lesen?“
Die Frage verletzte mich in Verlegenheit. Die rechte Erwiderung, dass ich ihr das Stück zu Lesen hingereicht, sie mich aber durch ihr gleichgültiges Verhalten gekränkt habe, hätte ihr wehgetan. Auch durfte ich ihr nicht sagen, dass ich das Heft im Zorne zerrissen hatte; sie wäre dann erst recht in Missmut geraten. In solcher Not redete ich etwas von schlechter, undeutlicher Schrift und suchte das Gespräch von dem Hefte abzulenken… Nun mochte sie wohl empfinden, dass meine Verstimmung im Zusammenhang mit dem Hefte stand; denn sie sagte mit sanftem Vorwurf, dass sie nun Zeit zum Lesen hätte. Bei Tage habe sie die Gedanken zu sehr bei der Arbeit. Vergebens erwartete sie, dass ich das Heft herbeiholen werde; doch redete sie nicht mehr davon.
Der Misston, der durch das Vertauschte Kind in mein gut stimmendes Verhältnis zur Mutter gekommen war, störte den Frieden der Tage, die ich im Stübel verlebte. Ich weinte viel in jenen Tagen, da ich über den finsteren Peingedanken nicht hinwegkommen konnte, dass ich von dem einzigen treu liebenden Herzen, das ich auf Erden besaß, in meinem inneren Wesen und Werte, in meinem Wollen und Streben nicht erkannt wurde.