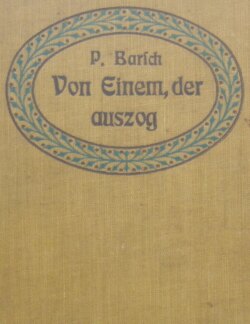Читать книгу Von Einem, der auszog. - Paul Barsch - Страница 14
Der Meister.
Оглавление„Heda! Soll ich Ihnen etwa das Frühstück ans Bett bringen?“
Mit einem Satze war ich auf den Füßen. „Ich komme schon Herr Meister!“
„Ich will’s auch hoffen! Das ist hier nicht Mode, dass ich Ihnen wecke. Um fünf Uhr früh geht’s los!“
Wie ich mich ärgerte, dass ich’ verschlafen hatte! Was sollte der Meister von mir denken! Er musste ja schon von vornherein eine schlechte Meinung von mir bekommen! Binnen wenigen Sekunden war ich angekleidet. Ich eilte hinab in die Werkstatt. Ungewaschen trat ich an die Hobelbank. Der Meister machte ein paar Kommoden aus Fichtenholz. Ich sollte ihm dabei behilflich sein. Mit feurigem Eifer stürzte ich mich in die Arbeit; ich war willens, mir mein Brot redlich zu verdienen.
Um sechs Uhr erging die Aufforderung zum Frühstück. Der Meister hatte den Kaffee selbst gekocht, und zwar auf einem eisernen Öfchen, das in der Werkstatt stand. Der Kaffee schmeckt mir nicht, weil er bitter getrunken werden musste. Wir aßen trockenes Schwarzbrot dazu. Beim Frühstück wurden wir durch eine Frau gestört, die laut schluchzend in die Werkstatt kam und einen Sarg bestellte. In der Nacht war ihr der Mann gestorben. Der Meister ging mit der Frau fort, um an der Leiche das Maß für den Sarg zu nehmen. Während seiner Abwesenheit wusch ich schnell mein Gesicht in einer Waschschüssel, die neben dem Ofen stand, und fühlte mich wohlig erfrischt.
Eine böse Ahnung, die mich beschlichen hatte, ging in Erfüllung. Der Meister beauftragte mich, den Sarg anzufertigen. Ich wusste mir keinen Rat. Bei den wenigen Särgen, die in der Werkstatt meines Lehrmeisters gemacht worden waren, hatte dieser das Zuschneiden des Holzes stets selbst besorgt. Zaghaft gestand ich meine Unkenntnis. Da schimpfte der Meiser auf meinen Lehrmeister. Er sagte: Sarg und Wiege seien zwei Dinge, auf die jeder Tischler „eingefuchst“ sein müsse, sonst habe er nicht das Recht, sich Tischler zu nennen. Er begreife nicht, wie man einen Menschen zum Tischlergesellen machen könne, der nicht fähig sei, einen Sarg zu bauen. Ich erwiderte ihm, in der Stadt meines Lehrmeisters kaufe man die Särge in den Sargmagazinen, daher hätten die meisten Tischler keine Gelegenheit, Särge herzustellen; er aber wich von seiner Meinung nicht ab. Nun machten wir uns daran, gemeinschaftlich das letzte Wohnhaus für den toten Mann zu zimmern.
Im Laufe des Vormittags kam Franz. Leise pochte er an; auf das „Herein!“ des Meisters öffnete er behutsam und nur ein klein wenig die Tür und blieb draußen. Ich bat den Meister um einen Vorschuss von einer Mark. Zu meiner Bewunderung gab er mir das Geld, ohne dabei ein Wort zu verlieren. Ich drückte dem Freude das Markstück in die Hand, worauf er sich ohne ein Abschiedswort zurückzog. Er schien sich vor dem Meister zu fürchten. Was er sonst noch empfand, verrieten mir deutlich seine tränenfeuchten Augen. Ich begleitete ihn zur Treppe hinab bis in den Hausflur. Dort sah er mich starr und bittend an, und sein Blick schnitt mir wie ein scharfes Messer in die Seele.
„Adje! Ich muss hinauf! Lass Dir ’s recht gut gehen!“
Wir drückten einander die Hand. Große Tränen rannen über seine Wangen.
„Leb wohl! Schreibe bald! Und wenn Du in Not bist…“
Der Meister öffnete oben die Tür und hustete. Wir erschraken beide. Franz lief hinaus, ich eilte die Treppe hinauf…
Ich hatte keinen Kameraden mehr.
Die Stadt, in der ich jetzt wohnte, hieß Prieseberg.
Der Meister war ein Junggeselle, ungefähr fünfundvierzig bis fünfzig Jahre alt, und von grämlicher Natur. Lachen konnte er nicht; es fiel ihm sogar schwer, ein freundliches Wort zu reden. Schon in den ersten Tagen wurde mir klar, dass er nicht gern arbeitete. Von mir dagegen forderte er den allergrößten Fleiß und hatte die Gewohnheit, mich fortwähren durch Zurufe zu rascher Tätigkeit aufzumuntern. Sein Lieblingsruf war: „Schlafen Sie nicht!“ Auch dann bekam ich diese Ermahnung zu hören, wenn ich mit aller Kraft und Hingabe an der Arbeit war. Zur Abwechslung sagte er dann und wann auch: „Fangen Sie keine Gedankenmücken!“ oder „Werden Sie mir nicht starr!“ – oder er fragte höhnisch: „Soll ich Leinöl bringen?“ Dieser geheimnisvollen Frage gab ich die Deutung, dass er dabei an das Einschmieren meiner Glieder dachte, um sie gelenkiger zu machen… Ungefähr zehnmal des Tages begann er plötzlich mit wahnwitziger Eile zu arbeiten. Der Hobel fauste und fauchte dann mit einer Schnelligkeit und Gewalt über das Holz, dass ich schier glaubte, es müsse Feuer fangen; die Säge ächzte und kreischte vor Schreck, und die ganze Hobelbank geriet in wilde Bewegung. Dabei verwünschte er „die verdammte faule Schlendere“, was natürlich mir galt, und richtete die Augen zornig und forschend auf mich; er wollte sehen, ob ich das großartige Beispiel des Fleißes und der Kraftaufwendung richtig nachahme. Ich gab mir Mühe, seinen Wunsch zu erfüllen. Gewöhnlich hielt sein Fleiß zwei oder drei Minuten an; dann überwältigte ihn die angeborenen Trägheit, und er stürzte zum Ofen oder in sein Wohnstübchen, als sei ihm plötzlich eingefallen, dass er dort wunderwichtige Dinge zu verrichten habe; in Wirklichkeit war es ihm aber nur darum zu tun, mit Anstand von der Hobelbank fort zukommen… Weilte er in seinem Stübchen, das an die Werkstatt angrenzte, so pflegte er manchmal unhörbar die Tür zu öffnen, in der Hoffnung, mich beim Müßiggange zu überraschen. Damit die Tür nicht knarre, ölte er die Angeln sorgfältig ein. Desgleichen kam er oft, wenn er von einem Ausgange heimkehrte, leise und behutsam angeschlichen, damit ich ihn nicht höre, und riss dann jäh die Tür auf. Zwar gelang es ihm nicht, mich beim Faulenzen zu ertappen, da ich aus eigenem Antriebe fleißig arbeitete; doch mochte er sich mit dem Gedanken trösten, dass ich durch seine Schlauheit gezwungen sei, stets in Furcht vor ihm und somit ununterbrochen bei der Arbeit zu sein. Jedes Mal nach seiner Heimkehr prüfte er genau, was ich in seiner Abwesenheit geleistet, und stets bekam ich den Vorwurf zu hören, dass ich faul gewesen. In den erste Tagen erschien mir dieser Zustand so unerträglich, dass ich bereits ernstlich den Gedanken erwog, wieder auf die Wanderschaft zu gehen; allmählich aber gewähnte ich mich daran, wie ich mich auch an den bitteren Kaffe gewöhnen musste.
Dreimal in der Woche aßen wir mittags im „Deutschen Kaiser“, An den anderen Tagen bereitete der Meister unsere Kost auf dem kleinen Ofen in der Werkstatt. Gewöhnlich bestand sie aus Kartoffelspeisen und Mehlsuppen; manchmal holt der Meister einen Hering herbei… Im „Deutschen Kaiser“ bekam ich stets ein gutes Stück Fleisch; dennoch aß ich lieber daheim in der Werkstatt. Aus dem folgenden Grunde:
Wir teilten im Gasthause den Tisch mit zwei Schneidergesellen. Der kleinere der beiden war ein Vielfraß. Das Fleisch lag für jede Person abgeteilt auf dem Teller; die Kartoffeln oder die Klöße befanden sich in einer gemeinsamen Schüssel. Der kleine Schneider kaute keine Speise; er verschlang sie so, wie er sie in den Mund gesteckt, und wenn ich nicht schnell zugriff und meine Zähne rasch arbeiten ließ, war mein Schaden groß. Beim Essen mussten bestimmte Anstandsgesetze befolgt werden. Als Regel galt, dass jeder Kostgänger zuerst nur wenig Speise auf seinen Teller nehmen dürfte – nur eine Kartoffel oder ein Klöße oder einen einzigen Löffel voll Gemüse. Da ich an den ersten beiden Tagen gegen diese mir unbekannte Sitte sündigte, fragte mich der Meister auf dem Heimwege im Tone bittere Verachtung, ob ich denn bei meinem Lehrmeister keine Bildung gelernt hätte. Er müsse sich, fügte er hinzu, vor den Leuten schämen, solch einen ungeschliffenen Menschen zu tische mitzubringen. Sodann hielt er mir einen mit Schimpfworten und vorwürfen durchwirkten Vortrag über die guten Sitten bei Tisch. Ich fühlte mich so sehr beschämt, dass mich eine Art Schüttelfieber ergriff. Wieder sah ich ein, dass ich ein ganz ungebildeter Mensch war, obgleich ich ein ganzes Buch von Schiller gelesen hatte.
Als ich am nächsten Fleischtage wieder in den „Deutschen Kaiser“ ging, war mir ängstlich und verzagt zu Sinn. Hätte ich die Wahl gehabt, den ganzen Tag zu hungern, statt gemeinsam mit den zwei Schneidern zu essen. Würde ich mich freudig für das Hungern entschieden haben. Wusste ich doch, dass sie mich verachteten! Mit niedergeschlagenen Augen trat ich an den Tisch und wagte auch während des Essens nur manchmal scheu den Blick zu erheben. Als ich die erste Kartoffel gegessen und dann verstohlen nach der Schüssel hinsah, war sie leer. Der kleine Schneider hatte sie ausgeräumt. Bei dem Beginn des Essens lagen vier kleine Brotschnitten auf einem Teller – für jeden Gast eine. Ich wollte nach meiner Schnitte greifen; doch der Teller war leer. So war ich gezwungen, das Fleisch ohne Brot und ohne Kartoffeln zu verzehren… Meine Scheu vor den Schneidern verminderte sich im Laufe der Tage ein wenig; das Über aber, dass ich im Gasthause mich nicht satt essen konnte, blieb bestehen. Was ich auch anstellen mochte – nicht ein einziges Mal gelang es mir, satt zu werden.
Eine zweite Bildungsregel forderte, dass ich erst zulangen durfte, nachdem der Meister zugegriffen hatte. War aber der Meister mit der ersten kleinen Auflage fertig und streckt er seine Hand nach der Schüssel aus, dann fand er stets nur ärmliche Überreste gewesenen Reichtums. Der aus der Art geschlagene Schneider hatte bereits mit unverschämter Gier den übergrößten Teil der Masse vertilgt. Das geringe Überbleibsel teilte der Meister mit mir. Meine Hoffnung, dass er das Fressungeheuer zur Rede stellen und eine gleiche Teilung der Schätze verlangen werde, erfüllte sich nicht. Am liebsten aß er Fleisch; an den Zuspeisen schien ihm nicht viel gelegen; daher fiel ihm das schändliche Treiben des kleinen Schneides nicht auf. Mir aber war ein großer Appetit und leider nicht die Kraft verliehen worden, den kleinen Schneider durch ein Zauberwort an einem großen Bissen elend ersticken zu lassen.
Der Meister pflegte während des Essens ein Gläschen Bier zu trinken; ich bekam keins und empfand auch kein Verlangen danach. Nachspeise war jedes Mal vorhanden; ich eroberte nie welche. Das mir tödlich verhasste Ungeheuer lauerte voll Arglist und Heißhunger, bis sich mein Meister und der ältere Schneider bescheiden bedient hatten; dann bemächtigte er sich blitzgeschwind des Kompottschüsselchens und verschlang den ganzen Inhalt. War es Backobst, so entschuldigte er sich grinsend: „Backobst ess ich for mein Leben gern!“ Waren er Pfeffergurken, so lautete die Entschuldigung „Pfeffergurken ess ich for mein Leben gern!“ War es Apfelmus, so bat er um Vergebung mit den Worten: „Apfelmus ess ich for mein Leben gern!“ Mit der Zeit fand ich den Mut, nach der Brotschnitte zu greifen, bevor er sie rauben konnte; manchmal aber riss er sie mir aus der Hand und rief, sich entschuldigend: „Brot ess ich for mein Leben gern!“ Dass er auch alle Senfnäpfchen leerte und sich nicht scheute, mit dem Finger hinein zu tupfen, nahm ich ihm nicht übel; nur wunderte ich mich, dass sich die Wirtin dies gefallen ließ.
So wurden die Fleischtage mir zu Fasttagen.
Da ich mich in die Eigenheiten des Meisters fügte, kam ich leidlich gut mit ihm aus. Unser Verhältnis war aber beständig feindlicher Art. Er überwachte meinen Fleiß und war jeden Tag bestrebt, mich durch List beim Müßiggange zu ertappen; dabei fühlte er sich hoch erhaben über mich und gönnte mir selten ein gemütliches Wort. Er prahlte mit seinen Kenntnissen, seiner Klugheit, seiner Bildung und nannte mich dumm und ungebildet. Seine Launen las ich ihm vom Gesicht ab, und wenn ein Unwetter drohte, regte ich nach seinem Muster geschäftig lärmend die Hände. Dadurch erreichte ich, dass sich sein Zorn besänftigte. Brach das Unwetter aus, so ließ ich es ruhig austoben.
Er war nur ein Flicktischler, und meine Fachkenntnisse genügten für seine Werkstatt. Einfache Möbel, auch kleine Bauarbeiten wurden hin und wieder bei ihm bestellt; auf teure Aufträge ließ er sich nicht gern ein. Mit Vorliebe nahm er feine Möbel in Reparatur, und wenn sich ein kostbares Stück dieser Art in der Werkstatt befand, gebärdete er sich stolz, als wäre er der Schöpfer des Werkes. „So was haben Sie in Ihrer Lehrzeit nicht zu sehen gekriegt!“ sprach er dann würdevoll. „Ihrem Herrgott können Sie danken, dass Sie zu mir gekommen sind! Hier wird Ihnen erst klar, was Tischlerei ist!“ Selten fand er Ursache, meine Leistungen zu tadeln, und er schimpfte nur immer auf meine Arbeitsweise und auf die Handhabung einzelner Werkzeuge. Meine „angeborene Stinkfaulheit“ ärgerte ihn am meisten.