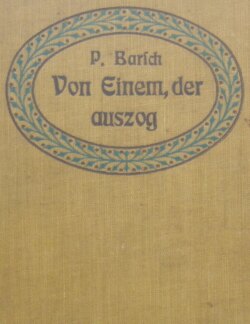Читать книгу Von Einem, der auszog. - Paul Barsch - Страница 7
Junge Gesellen.
ОглавлениеSechs oder sieben Tage hatte ich bei der Mutter gewohnt, als wir beide durch ein Schreiben des Meisters der bangen Sorge um meine Zukunft entrissen wurden. Der Meister schrieb kurz und schroff: er befehle mir, dass ich sofort auf meinen Posten zurückkehre, den ich ohne Grund und Erlaubnis verlassen habe.
Ohne Grund und Erlaubnis! Als hätte mich Fräulein Cäcilie nicht vertrieben! Was sollte die Mutter von mir denken! Sie musste mich ja für einen Lügner halten! Ich beteuerte, dass ich die Wahrheit geredet habe; sie aber legte dem Widerspruch, der zwischen dem Briefe und meinen Erzählungen bestand, keine Wichtigkeit bei, freute sich vielmehr, dass ich mich sogleich bereit zeigte, nach der Stadt zu marschieren. Schnell besorgte sie mir ein gutes Frühstück, ordnete mein Bündel und entließ mich mit frommen Wünschen.
Unterwegs fürchtete ich, dass ein böser Empfang und arge Tage meiner harrten. Hatte ich doch Cäcilie und deren Mutter gar zu schwer beleidigt! Dafür gab’s keine Verzeihung… Je näher ich der Stadt kam, desto mehr wuchsen Furcht und Beklommenheit, und als ich nach dreistündigem Marsche das Ziel erreicht hatte, getraute ich mich nicht, in die Wohnung des Meisters, auch nicht in die Werkstatt zu gehen. Eine lange Weile unentschlossen, und die Frage erwägend, was ich zu antworten hätte, wenn mich der Meiste wegen der frechen Beleidigung zu Rede stellen sollte.
Oben wurde eine Tür zugeschlagen; Schritte erschollen von der Treppe her… Der Meister!… Herzhaft trat ich ihm entgegen und grüßte.
„Da bist Du ja schon!“ sprach er. „Ihr seid eine feine Gesellschaft! Da hab’ ich mal gesehen, wie ich mich auf Euch verlassen kann! Grade von Dir hätte ich mehr Treue erwartet!“
Er ließ mich kein Wort der Entschuldigung sagen, sonder rief rasch und eindringlich: „Nichts hören will ich, nichts! Ich kenn’ Euch schon! Mach’ nur, dass Du an die Arbeit kommst!“ Dann folgte er mir in die Werkstatt. Dort traf ich Franz. Die Gesellen waren nicht zur Stelle; auch Johann nicht. Der Meister befahl mir, Franz behilflich zu sein, ermahnte uns zum Fleiß und ging hinaus.
Auch Franz hatte von ihm einen Brief erhalten; dank besserer Postverbindung einen Tag eher als ich. Daher war er einen Tag früher zurückgekehrt und wusste bereits allerlei fesselnde Neuigkeiten vom Meister zu erzählen. Am Abend nach seiner Heimkehr hatte er Kohlen aus dem Keller nach der Küche tragen müssen, und bei dieser Gelegenheit war ihm von Fräulein Cäcilie mitgeteilt worden, dass der Meister tatsächlich im Auftrage des Freimaurerordens verreist gewesen. Einen Verräter der Ordensgeheimnisse habe er verfolgen und unschädlich machen müssen. Das sei eine große Ehre für den Meister gewesen, da nicht jedes Mitglied der Loge mit einem so wichtigen Auftrage betraut werde. Franz glaubte aber nicht an diese Geschichte. Vormittags seien drei feine Herren mit dem Möbelhändler Silberstein da gewesen und hätten den Wert der Holzvorräte, Hobelbänke und Werkzeuge abgeschätzt. Während der Unterhaltung sei dem Silberstein das Wort entschlüpft: „Wenn alle Leute fortlaufen sollten, die Schulden haben, gäb’s zuletzt keine Einwohner mehr.“ Aus diesen Worten hatte Franz den Schluss gezogen, dass der Schneider recht gehabt mit seiner Behauptung, der Meister sei lediglich der Schulden wegen durchgebrannt. Er meinte, Cäcilie habe die schöne Geschichte vom verfolgten Verräter ersonnen und verbreitet, damit der Fleischer, der Bäcker und der Krämer nicht misstrauisch werden sollten. Sie brauche das Vertrauen dieser Leute, da sie die Einkäufe nicht immer bar bezahlte.
Franz war doch viel klüger als er aussah! Ich erstaunte über seine klare Einsicht und seine schaffe Beurteilung der Verhältnisse. Er sagte, der Meister sei bankrott und müsse die Tischlerei verkaufen. Der sicherste Beweis dafür wären die Kisten… Richtig, die Kisten! Franz hatte den Auftrag erhalten, eine Anzahl Packkisten verschiedener Größe anzufertigen, und ich sollte ihm dabei helfen. Er hatte seinen Ohren und Augen gar nicht getraut, als ihm befohlen worden, die noch vorhandenen Bretter zu den Kisten zu verwenden. Das waren gute, teure, auserlesene Fichtenbretter. Sie zu einem Zwecke zu verarbeiten, für den das gemeinste Tannenholz gut genug gewesen wäre, schien sündhaft und jammerschade. In solcher Verschwendung erblickten wir ein Zeichen der bevorstehenden Auflösung…
Die Stunden vergingen, und eine Minute kam, der ich mit Bangen entgegengesehen. Wir wurden zum Abendbrot gerufen. Das bedeutete für mich das Zusammentreffen mit Cäcilie. Ich fürchtete, dass sie mich angreifen werde, und hatte daher dem Freunde begreiflich zu machen gesucht, dass er in einem solchen Falle die Kameradenpflicht habe, mir beizuspringen. Mindestens war zu befürchten, dass sie mir den Abscheu, den sie doch wohl notwendig vor mir empfinden musste, durch Worte der Verachtung kundtun werde. Zaghaft trat ich also – dicht an Franz mich haltend – in die Stube. Cäcilie saß an ihrem gewohnten Platz neben dem Fenster und hielt eine Häkelarbeit in den Händen. Meinen Gruß erwiderte sie mit einem leichten Nicken. Das wirkte beruhigend auf mich. Dennoch war mir das Weilen in ihrer Nähe sehr peinlich, und glücklich pries ich mich, als die Butterbrote verzehrt waren und ich hinauseilen konnte.
Am andern Tage vormittags hatten wir die Freude, Johann wieder zu sehen. Nachdem wir ihn rasch über die wichtigsten Ereignisse unterrichtet hatten, ging er hinauf, sich beim Meister zu melden. Lange blieb er fort, so dass wir auf die Vermutung kamen, der Meister wolle ihn mit einer großen Arbeit betrauen. Als er endlich in die Werkstatt zurückkehrte, strahle sein Gesicht in Freude. Er begann zu tanzen, hüpfte und sprang umher, lacht, sang, pfiff und machte den Versuch, auf dem Kopfe zu stehen. Endlich erhielten wir Bescheid auf unser verwundertes Fragen. Ein Papier zog er aus der Tasche, schwang es über dem Kopfe und schaute so sieghaft und jubelselig drein, als sei er bereits Professor oder gar schon adelig geworden. An mich herantretend, sprach er halb ernst, halb komisch: „Von jetzt an musst Du „Sie“ zu mir sagen. Ich bin Geselle!“
„Du bist wohl nicht recht…?“
„Sie musst Du sagen! Hier ist meine Gesellenzeugnis!… Ein feines Zeugnis!… Als der Karl Geselle wurde, hab’ ich auch „Sie“ zu ihm sagen müssen, und wir hatten auch drei Jahre zusammen gelernt.“
Johann war Geselle geworden. Diese Überraschung machte mich auf Minuten fast sprachlos. Ich wusste nicht, ob ich mich freuen oder traurig sein – ob ich ihn beglückwünschen oder ihn von mir stoßen sollte. Seine Forderung war ernst gemeint; er verbat sich alsbald mit Entschiedenheit das kameradschaftliche „Du“. Der Hinweis auf seinen Vorgänger Karl, den ich als einen eitlen, dünkelhaften, groben und dummen Menschen kennen und verachten gelernt habe, empörte mich, und ich nahm mir vor, dem neu gebackenen Gesellen unter keiner Bedingung die Gesellenehre zu erweisen. Die trauten Bande, die uns verknüpft hatten, waren gelöst; meine heitere Hoffnung, dass er wieder mein guter Dichtergenosse sein werde, war zuschanden geworden… Unverstanden von der Mutter, zurückgestoßen vom Freunde!… Wieder beschlich mich eine grabesfinstere Bangigkeit.
Das Dienstmädchen kam und rief meinen Namen. Ich sollte zum Meister kommen. Schnell war ich oben. Er saß an seinem Schreibtisch und war sonntäglich gekleidet. Mit ernstem Tone begann er, dass er in einer wichtigen Angelegenheit mit mir zu sprechen habe. Er fand nicht bald die rechten Worte, redete in Verhältnissen, Familienrücksichten, schlechten Zeiten und Veränderungen, und fragte dann unvermittelt, ob ich Herrn Tischlermeister Thomas kenne.
„Ja!“
„Möchtest Du bei ihm arbeiten? Er ist ein kluger und guter Herr. Ich habe bereits Deines wegen mit ihm gesprochen.“
Mir war seine Rede so unfassbar, dass ich keine Antwort zu geben wusste. Ich blickte ihn fragend an. Er sprach weiter und kam nach mehrfachem Stocken in die rechte Bahn. Jetzt erfuhr ich, dass er die Tischlerei an einen Stellmacher verkauft habe und nach Amerika auswandern wolle. Sein Bruder sei drüben, und er wolle mit dem Bruder eine Fabrik gründen. Er könne nicht abreisen, ohne zuvor für uns Lehrlinge gesorgt zu haben. Johann sei ein tüchtiger Mensch, der ganz gut als Geselle fortkommen werde; daher habe er ihm den Freibrief gegeben. Ich hingegen und Franz seien noch nicht reif für den Freibrief; wir müssten jeder noch ein Jahr lernen, Franz vielleicht noch länger. Herr Thomas sei bereit, uns beide in die Lehre zu nehmen. In einem Jahre sei ich Geselle. Von Rechts wegen hätt’ ich noch sieben Vierteljahre zu lernen; aber drei Vierteljahre würden mit erlassen…
Tischlermeister Thomas galt bei den Gesellen und Lehrjungen der Stadt als sehr strenger Mann, und die Worte des Meisters flößten mir daher Angst ein. Nur nicht zu Herrn Thomas – nein, nein! Die Furcht vor diesem Manne brachte mich auf einen kühnen Gedanken.
„Herr Meister“, sprach ich bittend, „sind Sie doch so gut und geben Sie mir auch den Freibrief!“
Er lächelte schmerzlich und schüttelte den Kopf. „Was Du Dir einbildest! Ich kann Dir doch unmöglich einen Freibrief geben, wenn Du noch nicht einmal ein paar kirschbaumene Schränke allein machen kannst!“
„O ja, Herr Meister, ich kann kirschbaumene Schränke machen!“, entgegnete ich dreist. „Ich habe ja schon Kommoden und Tische ganz allein gemacht!“
„Aber Schränke – gute Schränke, das ist etwas anderes! In Bauarbeit bist Du noch sehr weit zurück, und nach Zeichnung kannst Du überhaupt nicht arbeiten.“
Mir wuchs der Mut, und ich versicherte, dass ich, wenn es sein müsste, jede Arbeit fertig brächte.
„Ich kann’s nicht verantworten!“ sprach er. „Wenn Du zu einem Meister kommst, und Du kannst nichts, so fällt die Schuld auf mich. Ich will aber ein gutes Andenken hinterlassen, und auch mit den Lehrlingen will ich mir keine Schande einlegen.“
Aber ich ließ nicht nach und gab ihm das Versprechen, dass ich alle Kraft zusammen nehmen würde, um als Gesell mein Fortkommen zu finden und ihm keine Schande zu bereiten. Auch gestand ich, dass ich bei Herrn Thomas nicht weiterlernen möge, weil er zu grob wäre. Jetzt sei dort der lange Lorenz in Arbeit getreten, und unter dessen Gewalt möchte ich nicht wieder kommen. Zu einem Dorftischler würde ich in Arbeit gehen, vielleicht zu meinem Onkel, der auch Tischler sei, und für das Dorf besäße ich genügende Kenntnisse… Der Meister wurde nachdenklich. Nach einigem Zögern begann er eine neue Rede. Er wolle mir ganz offen gestehen, dass er im allgemeinen mit mir zufrieden gewesen. Ich sei ehrlich und fleißig; aber gerade deshalb, weil er an mir manchmal seine Freude gehabt hat, hätte ihn manche recht hässliche Eigenschaft an mir gekrankt und erbittert. Mein Benehmen gegen Fräulein Cäcilie sei über alle Begriffe hinaus ordinär gewesen. Er habe sich die Frage vorgelegt, ob er mich dem Gericht übergeben oder auf andere Weise strafen solle, sei aber schließlich zu der Ansicht gelangt, dass ein solch schändliches Betragen einer Dame gegenüber nur ein verächtliches Pfui verdiene. Er hoffe, dass ich bei rechter Überlegung erkennen werde, wie gemein ich gewesen. Fräulein Cäcilie sei eine achtungswürdige Dame und seine Freundin… Doch heut zum Abschied wolle er sich nicht weiter aufregen… Seine Stimme bebte; er kämpfte sichtlich gegen den aufwallenden Zorn. Mir schnitten seine Worte ins Herz; stammelnd bat ich um Verzeihung. Ich hätte, sprach ich, mein Unrecht bereits eingesehen und bereut. Das Wort sei mir in der Erregung entfahren, weil Fräulein Cäcilie…
„Sprechen wir nicht weiter davon!“ unterbrach er mich. „Es genügt mir, dass Du um Verzeihung bittest, damit wir ohne Groll scheiden können… Du willst also nicht zu Herrn Thomas gehen?“
„Nein, ich möchte nicht!“ erwiderte ich bestimmt.
„Das ist unklug von Dir! Bei Herrn Thomas hättest Du Gelegenheit, Dich vollständig auszubilden. Dort werden nur gute Arbeiten hergestellt – seine Möbel, Kirchenarbeiten und große Bauarbeiten. Aber wenn Du Dein Glück nicht haben willst – zwingen kann ich Dich nicht“… Nach einer Pause des Schweigens fuhr er fort: „Wenn ich bestimmt wüsste, dass Du zu einem Dorftischler gehst… Ja, es ist halt so eine Sache…ich nehme eine große Verantwortung auf mich… Hier in der Stadt kommst Du als Geselle nicht fort!“
Ich gab ihm das Versprechen, nicht in der Stadt zu bleiben, und bat ihn nochmals herzlich um den Freibrief. Er öffnete ein Schubfach und nahm einen Bogen Papier heraus.
„Ich nehme keine Schuld auf mich!“ sprach er. „Hoffentlich hast Du keine Ursache, Deine heutige Kurzsichtigkeit zu bereuen.“ Er schrieb mir den Freibrief.
Bei dem heftigen Wirbel des Frohlockens, der jäh mein inneres Wesen erfasste, wäre meine äußere Ruhe verloren gegangen, wenn sie nicht einen festen Stützpunkt gefunden hätte in dem Angstgedanken, dass der Meister sich in der letzten Minute noch anders besinnen und das bereits geschriebene Papier vernichten könnte. Wenn ich in Stunden der Arbeitsqual, der Ermüdung, der Demütigung an die Zeit gedacht, die mich einst zum Gesellen und somit zum freien Mann machen würde, der sich kein Unrecht, keine Quälerei und keine Ohrfeigen mehr gefallen zu lassen braucht, war sie mir stets so fern liegend erschienen, als wäre es gar nicht möglich, dass ich sie jemals erleben könnte. Und nun auf einmal, ganz unvermutet, war ich an das sehnsüchtig erwartete herrliche Ende gelangt. Ich sollte Geselle sein – Geselle! Sollte Geld bekommen für meine Arbeit, im Range dem langen Lorenz gleichstehen und das Recht haben, jeden Stift an Ohren und Harren zu zerren und zu ohrfeigen… Im Herzen aber legte ich das heilige Gelöbnis ab, dass ich den Stiften ein milder Gebieter sein und sie nicht ohne zwingende Ursache schlagen werde… Der Meister schrieb und schrieb… Ich sollte Geselle sein… ein Herr sein! Ich ein Herr!… Herr Julius Kattner, gehen Sie Sonntag mit uns spazieren?… Herr Kattner, sind Sie ein guter Tänzer?… Herr Kattner, Sie müssen jetzt rauchen? Sie sind Geselle!… Eine Taschenuhr müssen Sie haben!“… Was Johann für Augen machen wird zu dem Freibrief! Ach – und die Mutter! Wie wird sie erstaunt sein! Wie wird sie sich freuen über ihren Jungen! Jetzt wird sie endlich einsehen, dass er ein tüchtiger Mensch ist!
Der Meister drückte sein Siegel auf das Blatt und schüttete blauen Sand darüber. „So!… Da es Dein dringender Wunsch ist, spreche ich Dich frei. Hier ist Dein Gesellenschein! Jetzt gib mir die Hand darauf, dass Du immer ehrlich und fleißig sein und Deinem Lehrmeister Ehre machen willst! Wenn Du in der Fremde gefragt wirst, wer Dein Lehrmeister war, so wirst Du antworten: „Er war ein guter Mann; er hat es gut gemeint mit mir, und er ist bemüht gewesen, einen tüchtigen Tischler aus mir zu machen. Wenn ich’s nicht geworden sein sollte, so ist mein Lehrmeister nicht schuld daran.“ So wirst Du sagen! Verspricht mir auch, recht oft an mich zu denken.“
Einer solchen Rede vermochte ich in meiner Weichmütigkeit nicht stand zu halten. Überwältigt von Rührung und unter Tränen suchte ich einige Worte des Dankes hervorzubringen. Auch bat ich um Verzeihung für allen Ärger, den ich ihm bereitete. Er wehrte sanft ab und sagte, dass er in zwei Tagen verreisen werde. Wenn ich wolle, könne ich bis dahin bei ihm bleiben; doch habe er nichts dagegen, wenn ich sogleich scheide.
„Nun geh’ und schick’ mir den Franz herauf!“ schloss er.
Der Weg führte durch das Wohnzimmer. Dort saß Cäcilie. Mein Herz war willig, sich durch eine Abbitte von drückender Schuld zu befreien; der Fuß stockte. Im entscheidenden Augenblick aber wendete sie das Gesicht von mir ab, und sogleich war die Stimmung des Herzen verwandelt. Ich verachtete die Person, die ich eine halbe Stunde lang glühend geliebt hatte, ging schweigen hinaus und flog auf Jubelschwingen in die Werkstatt.
„Geselle! Geselle!“ – und ich tanzte und sprang und trällerte und pfiff, wie es kurz vorher Johann getan hatte. Franz sah verblüfft drein; Johann zeige ein verdutztes Gesicht und fragte: „Wie kommst denn Du dazu?“ Johann vermochte seinen Ärger nicht zu verbergen. Er hatte sich erhaben geführt, und jetzt war ich mit ihm auf gleiche Stufe gestellt.
„Franz, Du sollst hinaufkommen – schnell!“
„Da werd’ ich gewiss auch Geselle!“ rief er und stürzte davon.
Johann betrachtete meinen Freibrief; ich den seinen. Der meine war inhaltlich viel schöner und lobender. In meinem standen die Worte: „Ein Mensch von erprobter Ehrlichkeit und Treue, der jedem Meister aufs beste empfohlen werden kann;“ in Johanns hieß es nur kurz: der Inhaber besitze die Kenntnisse, die von einem Tischler gefordert werden.
„Siehst Du!“ rief ich schadenfroh. „Mein Freibrief ist besser als der Deine! Dein Stolz hat sich schnell gelegt!“
„Dass ich Dir nicht eins aufs Maul gebe!“ rief er grob und ärgerlich. „Was da drin steht, ist mir piepe! Die Hauptsache ist, dass ich Geselle bin!“
Nachdem sich unsere Gemüter ein wenig beruhigt hatten, sprachen wir von der Zukunft. Ich sagte, dass ich bei einem Dorftischler Arbeit suchen werde; Johann erklärte, dass er sogleich in die Fremde gehe. In die Fremde! Das war ein großartiger, verlockender Gedanke… Zu zweien in die Fremde gehen – was das für eine Lust sein müsste!
„Nimmst Du mich mit?“
„Na los! Ziehn wir ab!“ entgegnete er.
Franz kam zurück vom Meister. Er war traurig und niedergeschlagen. „Das lass ich mir nicht gefallen!“ sprach er weinerlich. „Ich kriege keinen Freibrief; dabei lern’ ich schon länger, wie Julius… Zu Thomas soll ich gehen und auslernen! Da müsst ich doch Tinte gesoffen haben!“
Als Franz vernommen, dass Johann und ich beschlossen hatten, in die Fremde zu gehen, erklärte er, dass er mitgehe.
„Du bist doch nicht Geselle!“
„Das ist mir egal! Wo Ihr hingeht, geh ich auch hin!“
„Aber wenn Dich der Gendarm erwischt! Du musst doch Papiere haben!“
„Mag er mich erwischen! Zu Thomas geh ich nicht! Wenn Julius Geselle geworden ist, will ich auch werden!“
Mir gefiel sein Entschluss, mit uns in die Ferne zu gehen und ich stellte mir vor, dass es wunderschön sein müsste, wenn wir in weiten Welt und unter fremden Menschen treu zusammenhielten und die alten Freude blieben, die wir während der Lehrzeit waren. Ich pries das Wandern als die größte Lust und riet dem guten Kameraden, sich vom Gemeindevorsteher seines Heimatortes ein Zeugnis ausstellen zu lassen, durch das ihm gestattet werde, sich in der Fremde einen Meister zu suchen. Dieser Vorschlag gefiel ihm, und er sagte, dass es ihm kinderleicht sei, ein solches Zeugnis zu bekommen. Seine Mutter sei früher die Liebste des Gemeindevorstehers gewesen, und wenn die Mutter um das Papier bitte, so kriege sie es auf der Stelle.
Der Meister kam in die Werkstatt und fragte, ob wir geneigt seien, ihm beim Verpacken seiner Sachen zu helfen. Gewiss waren wir dazu geneigt! Mit Freuden! Bei der Einpackerei arbeitete ich Hand in Hand mit Cäcilie. Ich reichte ihr die Sachen zu, die sie in die Kisten legte und mit Stroh und Papier umwickelte. Anfänglich schien mir dieses Zusammenarbeiten äußerst peinlich; als ich jedoch merkte, dass sie nicht mehr böse war auf mich, verlor ich allmählich meine Befangenheit. Sie redete mit mir so heiter und freundlich, als hätte nie eine Feindschaft zwischen uns bestanden. Wie das merkwürdig war! Als wir am anderen Tage mit dem Verpacken fertig waren, gingen wir – Johann und ich – dem Rate des Meisters folgend, zur Polizeidirektion und ließen unsere Freibriefe beglaubigen. Nach dem Mittagessen verabschiedeten wir uns vom Meister und von Cäcilie und verließen das alte Gebäude, in dem wir jahrelang gehaust hatten. Ich empfand weder ein Trennungsweh noch ein Scheideglück. Die Vergangenheit war für mich versunken; ich dachte nur an die Zukunft – an das neuartige, verheißende Leben, das mir winkte. Wir sprachen auch nur vom Wandern und vom Fechten, von fernen Städten und Provinzen, vom treuen Zusammenhalten und vom Glück der Freiheit. Auf dem Markte reichten wir einander die Hände zum Abschied. Unsere Wege gingen nach verschiedenen Windrichtungen auseinander. Verabredet hatten wir, dass wir uns zwei Tage später, vormittags elf Uhr, auf dem Marktplatze treffen wollten. Von dort aus sollte der Abmarsch in die Fremde erfolgen.
Der Empfang bei der Mutter war anders, als ich ihn erwartet hatte. Sie zeigte sich zwar überrascht, doch nicht erfreut, als sie meinen Freibrief sah. Offen sagte sie mir, dass sie kein rechtes Vertrauen zu meinem Können und meiner Tatkraft habe. Ich sei noch zu jung und körperlich noch zu schwach; als Geselle könne ich mich noch nicht behaupten. Der Wunsch des Meisters, dass ich noch ein Jahr lang bei Herrn Thomas lernen solle, sei gut gewesen; wenn ich ein kluger Junge sein wolle, müsse ich zu Herrn Thomas gehen und ihn bitten, mich in die Lehre zu nehmen. Da ich mich gegen diesen Vorschlag sträubte, ließ sie ihn fallen und meinte, dass ich mich bis Sonntag ausruhen könne; dann wolle sie mit mir zum Onkel gehen. Könne mich der Onkel nicht beschäftigen, so wird sie mit andern Tischlermeistern reden. Der Zambrichtischler – der Tischler meines Heimatdorfes – werde mich sicher nehmen. Jetzt erst wagte ich mich heraus mit dem Geständnis, dass ich über meine Zukunft bereits entschieden habe und in die Ferne gehen möchte.
„Ei de Fremde sollst Du giehn; aber erst übers Joahr!“ entgegnete die Mutter. „Erst musst Du stärker werden; derno furt mit Dir!“
„Nein, Mutter, ich muss schon übermorgen fort!“
Sie sah mich mit einem Blick an, als zweifle sie an meinem Verstande. „Übermurne…?“
„Ja, Mutter! Übermorgen früh um elf treffen wir in der Stadt zusammen – Johann, Franz und ich. Wir gehen in die Fremde.“
Sie schüttelte den Kopf. „Du bist a tummer Junge! Sulche Hasenfüße können si nich brauchen ei der Welt. Bleib Du do, bis Du wirst gescheiter sein! Derno loose meintswegen bis uf Paris!“
„Nein, Mutter, ich gehe! Wir haben’s verabredet, und ich muss mein Versprechen halten. Zum Onkel mag ich nich und zu Zambrich auch nich!“
Sie wurde ärgerlich und verlangte, dass ich mir den einfältigen Gedanken aus dem Kopfe schlage. Sie könnte, sprach sie, die Sünde, einen so dummen Backpilz in die Fremde gehen zu lassen, vor Gott und den Menschen nicht verantworten. Ich sei noch ein Kind. Wenn ich gesund und kräftig wäre, würde sie vielleicht einwilligen. So aber müsse sie befürchten, dass ich unterwegs liegen bleibe, dass ich ins Spritzenhaus oder in einen leeren Schweinestall gesperrt werde und darin umkomme, wie ein Stromer. Sie sitze dann zu Hause, flenne sich die Augen blutig und könne mir nicht helfen. Solche Fälle seien schon oft vorgekommen… Ihre Augen wurden feucht. Sie weinte still vor sich hin. Da ward auch mir weich ums Herz. Ich umarmte die Mutter und streichelte ihr die Wangen.
„Mutter, Ihr sollt Freude haben an mir! Ich will mich zusammennehmen – und passt auf, es wird mir ganz gut gehn!“
Ihre Tränen flossen reichlicher, und auch ich weinte. Lange Zeit sprachen wir kein Wort. Die Mutter kämpfte, das empfand ich, einen schweren Kampf mit sich. Zuweilen blickte sie zum Bilde der schmerzhaften Mutter Gottes hin. Auch ich betete im Stillen zur Mutter Gottes und flehte sie inständig an, dass sie das Herz meiner Mutter geneigt machen möge meinem unabänderlichen Vorsatz. Ganz still war es im Stübel, und mir kam es vor, als bewege die Jungfrau mit dem dornenbekränzten blutigen Herzen ihre Hände und ihre Augen, um mir liebreich anzuzeigen, dass sie mein Gebet erhört habe. So fest auch und sicher mein aufgeklärter Geist behauptete, dass das Bild an der Wand nicht fähig sei, Hände und Augen zu bewegen, so fest und sicher war meine Überzeugung, dass die heilige Maria auf meiner Seite stehe und mir ihre Hilfe soeben durch ein Zeichen kundgetan habe. Die beiden Überzeugungen widersprachen zwar einander, vertrugen sich jedoch friedlich.
Dem Gesicht der Mutter sah ich an, dass ich wandern durfte. Sie hatte sich mit der Jungfrau Maria verständigt. Meine Erwartung, dass sie mir ein Wort der Einwilligung sagen werde, erfüllte sich zwar nicht; doch ich entnahm ihre Zustimmung aus der Äußerung, dass sie bis zum zweinächsten Tage nicht alle diese Sachen ordnen könne, die zu einer großen Reise nötig seien. Meine Kleider müssten geflickt werden, die Stiefel zum Schuhmacher kommen; anstatt der Mütze müsse ich, wenn ich durchaus geselle sein wolle, einen Hut haben, und ohne einen guten Sonntagsanzug könne ich doch nicht unter fremde Leute gehen. Alle diese Bedenken waren leicht zu bekämpfen, da ja die Mutter gewillt war, mich ziehen zu lassen. Zum Wandern, sprach ich, sei mein Anzug gut genug; zum Ausbessern der Stiefel habe der Schuhmacher noch genügend Zeit; Hüte seien überall zu haben und Anzüge ebenfalls.
So waren wir also einig. Die Mutter opferte mir noch einen ganzen Tag, obwohl sie von mehreren Bauern dringend begehrt wurde. Sie flickte meine Kleider und bereitete mir ein Bündel, wie es Handwerksburschen zu tragen pflegten. In eine blaue Arbeitsschürze wickelte sie drei oder vier Hemden und einen alten Arbeitsanzug. Die Bürste und ein paar Holzpantoffeln wurden außerhalb des Bündels festgeschnallt, gewissermaßen als Wahrzeichen. Die Bürste war, wie die Mutter sagte, ein Zeichen für die Sauberkeit und den Ordnungssinn ihres Trägers; die Pantoffeln sollten verhütten, dass das Bündel als ein Bettelsack angesehen werde. Zwei Leidgürtel meines verstorbenen Vaters leisteten bei der Herstellung des Bündels gute Dienste.
Die Mutter bedauerte, dass sie nun nicht mehr Zeit fände, mir eine Unterhose zu nähen. Ich hatte bis dahin nie eine Unterhose getragen, auch im strengsten Winter nicht. Sie sagte, zum Schutz der Beine genüge zwar eine einzige Hose; ein Junge dürfte sich nicht verweichlichen, er müsse sich an Kälte gewöhnen. Aber als Gesell sei ich verpflichtet, ein wenig auf Figur zu halten, sonst würde ich von den Mädeln ausgelacht und bekäme keine Liebste. Die Oberhose dürfe nicht zu sehr an den Beinen herum schlottern; deshalb sei eine Unterhose nötig für mich. Sie schenkte mir mehrere große bunte Taschentücher und ermahnte mich dringend, sie fleißig und in gehöriger Weise zu benutzen. Als Lehrjunge hätte ich keine gebraucht; da hätten die Finger die Geschäfte des Taschentuches besorgt; als Gesell müsse ich mir gute Manieren angewöhnen.
Der Vormund, dem ich einen Besuch abstattete, freute sich über das schöne Gesellenzeugnis. Er gab mir die Erlaubnis zum Wandern und stellte nur die Bedingung, dass ich kein Lump werde und nicht etwa auf dem Schub nach Hause komme. Wenn ich mich nicht ordentlich betrage und ihm Ärger zufüge, lasse er mich durch die Polizei nach Hause bringen, und ich bekäme dann ganz verdammte Hiebe von ihm. – Wie ein gedemütigter Sünder verließ ich sein Haus. Ich war Gesell und somit ein freier Mensch; er aber drohte mir mit Hieben. Er tat es, obgleich ich ihm während der ganzen Lehrzeit kein Ärgernis bereitet hatte. Statt mit einem Glückwunsch war ich mit einer rohen Drohung entlassen worden. Die Versicherung der Mutter, dass er im Grunde des Herzens ein guter Mann sei, vermochte nicht aufzukommen gegen die Bitterkeit und Beklommenheit, die seine Abschiedsworte in mich gelegt hatten…