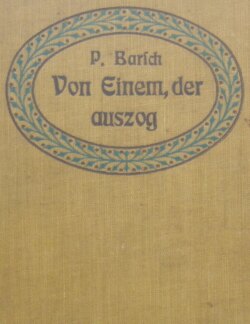Читать книгу Von Einem, der auszog. - Paul Barsch - Страница 8
Der Aufbruch.
ОглавлениеDer Tag des Scheidens war gekommen. Gegen fünf Uhr morgens weckte mich die Mutter. Sie war trauriger als am Abend vorher. Vor sechs Uhr musste sie in die Arbeit gehen. Zwei Tage schon hatte sie versäumt; einen dritten durfte sie nicht versäumen. Mir zu Ehren hatte sie Kaffee gekocht. Sonst kochte sie des Morgens nur Wassersuppe. Nach dem Frühstück zählte sie mir zwei Mark und fünfzig Pfennige auf den Tisch. Das sei, sagte sie, ihr ganzes Besitztum. Sie habe noch viel Geld von den Bauersleuten zu bekommen; aber die Zeiten seien schlecht, und sie könne die Leute nicht mahnen. Wenn mir’s schlecht ergehen sollte, dürfte ich getrost schreiben; sie wird mir schon helfen. Ich sollt nie vergessen, dass ich eine liebe Mutter habe, die ihr Kind nicht im Stich lasse. Gute Lehren wolle sie mir nicht auf den Weg geben; ich müsse von jetzt ab selber wissen, was gut und was schlecht sei. Ich solle nur immer daran denken, dass mein Vater ein sehr geachtete Mann gewesen, und dass auch sie, die Mutter, von allen Menschen geehrt werde. Als Sohn sei ich verpflichtet, ebenfalls ehrenvoll zu leben. Auch den lieben Gott solle ich nicht vergessen, und wenn ich etwa jeden Sonntag einmal in die Kirche ginge, würde ich keinen Schaden davon haben. Sie küsste mich, trocknete die nassen Wangen, nahm mich bei der Hand und führte mich in den Garten. Dort legte sie ihre Rechte auf meinen Kopf und sprach mit fester Stimme:
„Unter Gottes Himmel segne ich mein Kind im Namen des Vaters, das Sohnes und des Heiligen Geistes und empfehle es dem Schutze der heiligen Jungfrau Maria! Geh mit dem lieben Gott!“
Noch eine rasche Umarmung, noch ein lange Kuss – und sie ging schnell fort und sah sich nicht mehr um. Jetzt erst ergriff mich das schneidende Weh des Abschieds, und die Tränen flossen mir über das Gesicht. Meine Natur sträubte sich kräftig gegen alles Rührfällige. Während die Mutter ihre Segensworte gesprochen hatte, war mir recht unheilig zumute gewesen; ich hatte nichts weiter empfunden, als das Verlangen, dass sie rasch fertig sein und mich loslassen möge; solches Getue – wie bei mir zu Hause die Leute sagen – war mir peinlich. Erst als ich allein war, beschlich mich eine Ahnung von der Süßigkeit und Heiligkeit eines solchen Muttersegens. Mein Herz begann zu glühen in reiner Kinderliebe, und jetzt verstand ich auf einmal wieder das ganze Wesen der Mutter. Mir wurde klar, dass sie sicher das Vertauschte Kind gelesen, verstanden und sich herzlich darüber gefreut hätte, wenn ich nicht aus beleidigter Eitelkeit und aus Starrsinn so unklug gewesen wäre, ihr den Schlüssel zum Verständnis vorzuenthalten. Sie wusste ja nichts von Schiller und seinen Räubern, von seinem Leben und Streben und seiner Weltberühmtheit, nichts vom Theater und von Theaterstücken! Ich hatte ja das meiste davon auch erst kurz vorher erfahren! Wenn ich ihr erzählt hätte, wie schwer es sei, ein großartiges Stück zu schreiben, welche Freude das Dichten bereite und wie man dabei berühmt werden könne – sie würde mich schon verstanden haben. Ich aber war dem Hasse gegen sie zugänglich gewesen, weil sie das Heft nicht sogleich gelesen hatte; ich hatte mir in meiner Unvernunft den Tod gewünscht.
Das vertauschte Kind holte ich jetzt vom Boden herab, schnallte das Bündel auf und legte die zerrissenen Blätter sorgfältig zwischen die Hemden. Auf der Wanderschaft sollte das Stück vollendet werden. Gegen sieben Uhr machte ich mich auf den Weg. Ich stieg über den Gartenzaun, schlug mich ins Feld und lief auf einem Ackerraine weiter, weil ich keinem Menschen begegnen wollte. Des Bündels wegen schämte ich mich vor den Dorfleuten. Ein Stück hinter dem Orte ging ich auf den Fußweg.
Die Morgensonne leuchtete so kräftig, als wollte der Frühling schon kommen, und der Schnee begann zu schmelzen. Um volle zwei Stunden kam ich zu zeitig in der Stadt an. Ich packte die Brotschnitten aus, die mir die Mutter in die Tasche gesteckt hatte, setzte mich auf eine Haustürschwelle und wartete. Die Zeit verging langsam. So oft ich zu der Turmuhr hinaufblickte, war der große Zeiger nur ein Stückchen vorgerückt. Während des Wartens geriet ich in Angst, dass weder Johann noch Franz ihr Versprechen halten würden. Auf Johann war ja nie rechter Verlass gewesen.
Wenn sie nicht kämen? Was sollte ich dann beginnen? Mir wurde bange. Allein in die Fremde gehen… Dieser Gedanke schreckte mich so sehr, dass ich mich in das Reich eines anderen Gedankens flüchtete, der mich noch kurz vorher mit Grauen erfüllt hatte, mir jetzt aber wie ein Erretter vorkam: ich wollte, wenn ich von Johann und Franz im Stich gelassen würde, zu Herrn Thomas gehen und noch ein Jahr lernen. Wenigstens hatte ich dann einen Ort, wo ich des Nachts schlafen konnte. Trübfällig irrte ich in der Stadt umher, setzte mich dann wieder auf die Haustürwelle, sah nach der Uhr und grübelte nach über mein armes, unglückliches Leben. Ich fürchtete mich vor den Menschen…
Da – mit einem Husch war alles in mir verändert. Drüben an einer Straße, die in den Markt mündete, stand Johann. Ich lief hinzu, und mein Gemüt war voller Freude, Weltvertrauen und Kühnheit. Johann trug ein Bündel, wie ich. Aus Dankbarkeit, weil er Wort gehalten, und mit einem Herzen voll übersprudelnder Lust umarmte ich ihn und – merkte zu spät, dass er ein glimmendes Stückchen Zigarre zwischen den Zähnen hielt. So war der Kuss, der seinem Munde galt, in Wahrheit feurig; meine Lippen und ein Teil des Kinns erlitten Brandschaden. Aber im Glück des Wiedersehens und der Befreiung von meiner Seelenangst ertrug ich gern den argen Schmerz und war auch nicht böse, dass Johann mich schadenfroh auslachte.
„Du rauchst schon Zigarren?“ fragte ich mit aufrichtiger Bewunderung.
„Selbstverständlich!“ gab er zur Antwort.
Ich hatte das Rauchen noch nicht erlernt und war auch fest überzeugt, dass ich es nicht erlernen würde. Um dem Freunde zu zeigen, dass ich mich während meiner Gesellenzeit auch schon zu einer höheren Lebensart aufgeschwungen hatte, zog ich eines meiner Taschentücher hervor und betupfte damit die Brandwunden. Sie taten schrecklich weh. Johann wollte sogleich abmarschieren, ohne auf Franz zu warten. Er schäme sich, sprach er, mit einem Stifte in die Fremde zu gehen. Auch sei Franz ein einfältiges Schaf. Ich forderte, dass wir bis zu der verabredeten Stunde warteten, und nahm die Partei des geschmähten Kameraden. Hierbei gerieten wir in Streit, und Johann sprach die schändlichen Worte: ich sollte nur Warten, er werde den Weg in die Fremde schon allein finden. Trotz meiner Entrüstung schlug ich den Ton des gütlichen Zuredens und Bittens an, und nur dadurch gelang es mir, ihn zurückzuhalten. Unter der Bedingung, dass ich für jeden von uns einen Kornschnaps kaufe, erklärte er sich bereit, noch fünfzehn Minuten zu warten.
In einer Destille tranken wir jeder für fünf Pfennige Korn auf meine Kosten. Johann leerte das Glas auf einen Zug und verlangte von mir, dass ich sein Beispiel befolge. Während der letzten beiden Tage habe er sich zu Hause fleißig im Korntrinken geübt, damit er in der Fremde als zünftiger Gesell anerkannt und nicht ausgelacht werde. Mit beherztem Entschluss goss ich den Schnaps in den Mund, verschluckte ihn jedoch nicht, da mir das scharfe Zeug widerstrebte, und spie es draußen auf der Straße aus, ohne dass Johann etwas davon merkte. Auf Franz brauchten wir nicht länger zu warten; er kam bereits anmarschiert.
„Ich hab’s gekriegt vom Gemeindevorsteher!“ rief er uns freudig zu und brachte das Papier zum Vorschein. Auf dem Papier stand geschrieben, dass Franz nahezu drei Jahre Tischler gelernt habe, aber nicht freigesprochen werden konnte, da sein Lehrmeister bankrott geworden und nach Amerika ausgewandert sei. Dem Inhaber des Scheins werde gestattet, sich einen anderen Meister zu suchen. Auch Franzens Mutter hatte ihren Namen auf das Papier gezeichnet.
„Jetzt bin ich so gut wie Geselle!“ meinte Franz.
Johann widersprach dieser Auffassung; ich aber war der Ansicht, dass Franz auf Grund dieses Scheines tatsächlich als Gesell angesehen werden müsse. Jedenfalls habe er die Erlaubnis, in die Fremde zu gehen. Lehrjungen wird solche Erlaubnis nicht erteilt. Die Streitfrage blieb unentschieden; Johann aber ließ sich’s gefallen, dass Franz ihn duzte. So verließen wir in halbwegs friedlicher Stimmung die Stadt.
Der Frühling wollte wirklich kommen. Das weiße Gewand der Fluren war bereits zerrissen und voller Schmutzflecke; die Sonne zeigte sich willens, den Plunder vollends zu beseitigen und der Erde das grüne Lenzkleid anzulegen. Am Wege, in den Gräben und Gerinnen rieselten und plapperten, gleich waldfrohen Quellen, die Wasser des schmelzenden Eises. Das rinnende Spiel ergötzte mich und nahm meine Aufmerksamkeit mehr in Anspruch als die Gegend, durch die wir marschierten und von der meine Begleiter sprachen. Ich dachte daran, wie hübsch es sein müsste, wenn wir Zeit hätten, Papierschiffchen zu machen und sie auf der klaren Flut der kleinen Ströme treiben zu lassen. Manchmal erhob sich aus Schnee und Feuchte ein trockenes Inselchen, auf dem die Frühlingsarbeit schon weiter gediehen war als in der Nachbarschaft. Die Gräser waren dort schon ausgebildet und leuchteten in einem zarten, Herz berückenden Grün, wie es im Spätfrühling und im Sommer nirgends mehr zu schauen ist. Zwischen welken Gräsern und verdorrten Blütenstengeln des Vorjahres zeigen sich bereits mancherlei neu gewordene Blätter, zwar noch unvollkommen an Größe, doch vollendet in der Form und von wunderbarer Feinheit. An manchen Stellen fand ich schon die mir gut bekannten Spitzen des Sauerampfers. Mir war so lenzfröhlich zu Gemüt, dass ich unwillkürlich in der Luft nach Schmetterlinge suchte. Seitwärts in der Ferne stachen die Berge der Sudeten und das Glatzer Landes in reinen Linien und dunkelblauer Färbung vom lichtflimmernden Himmel ab. Zuweilen war mir so, als könnten meine Blicke die Berge und die Wälder am Horizonte durchdringen und fremde, bunte Provinzen sehen, in denen Menschen mit anderen Sitten, Gewohnheiten und anderer Sprache wohnten.
O, wie viele Städte mit hochragenden Wunderwerken mag die Erde tragen! O Wandern! O Freiheit! O du liebe, strahlende Sonne!
Die Mütze flog empor. Sie fiel in den Graben, und meine beiden Freunde lachten. Schadet nichts! Vorwärts – vorwärts! Die Welt ist weit und wonnevoll und die Menschen sind lieb – und, passt auf, uns geht es rasend gut in der Fremde!… Die Sonne leuchtete so warm, als sei Ostern schon gekommen… Sie lachte so freudenvoll, als tönten in den Kirchen bereits die Kesselpauken.
Die Kesselpauken! In der Kirche meines Heimatdorfes standen sie während der Fastenzeit in der Bälgekammer. Wenn man eine davon umkippte, so dass das Licht auf den kupfernen Rand fiel, konnte man die Jahreszahl 1647 finden. Wie viele Menschen mochten schon gestorben sein seit jener Zeit, in der die Pauken gemacht wurden?… Wir aber lebten noch, und wir waren freie Menschen; wir hielten als treue Kameraden zusammen und wollten reich und glücklich und berühmt werden. O, die große, die herrliche Welt!
Am Palmsonntage gehr der Schulmeister mit der Schulmagd und einem großen Jungen in die Kirche, und die Kesselpauken werden aus der Bälgekammer neben die Orgel getragen. Dort bedeckt er sie mit schwarzen Tüchern. Wenn das geschehen ist, dürften die Kinder im Dorfe nicht mehr lachen. In der Schule nicht und daheim nicht. Meine Schulgefährtin Maria verklatschte mich einmal bei meiner Mutter, als ich am Karsonnabend gelacht hatte. Sie wollte sich rächen, weil ich gesagt hatte, sie besäße schon einen Liebsten. Die Mutter tadelte mich.
„Die Kesselpauken sind zugedeckt, die Glocken läuten nicht und die Engel weinen, weil der heilige Christ leiden muss. Da lachen nur garstige Kinder.“
Wenn das Halleluja ertönt, werden die Kesselpauken geschlagen; die Glocken läuten und die Kinder dürfen lachen und lustig sein. Dann sind Feiertage, und die Leute essen Kuchen und zu Mittag gibt es gekochte Pflaumen. Alle Menschen sind freudig und ziehen die schönsten Kleider an. Der Wald wird grün und die Vögel bauen Nester. Bald kam dann die Zeit, in der wir auf die Bäume kletterten, Krähennester ausnahmen und junge Eichhörnchen suchten. Die Gräben auf der Wiese sind zu Ostern ganz mit Wasser angefüllt, und das Wasser ist so klar, dass man jeden Fisch auf dem Grunde sieht. Ich ging als Kind auf die Wiese und belauschte die Fische, und wenn ich an den Teich im Walde kam, spähte ich nach den Feenixen, die sich dort im Gebüsch und im Schilf aufhielten. Ein Junge, der zu Ostern eine Feenixe sieht, hat Glück im Leben; er kann es weit bringen und vielleicht gar Graf oder König werden. So sagen die Leute. Einmal, am Nachmittag des ersten Ostertages, hatte ich etwas Weißes durch das Gebüsch dem Teiche entschweben gesehen. Ich glaubte fest, dass es eine Feenixe gewesen sei. Jetzt war ich nicht mehr abergläubisch; doch musste ich fortwährend an jenes weiße Wesen denken, und der Glaube an ein großes, unerhörtes Glück verließ mich nicht.
Meine Begleiter stimmten das Lied von guten Kameraden an. Ich sang mit, rief zuweilen ein kräftiges „Bum!“ dazwischen und dachte dabei an die Kesselpauken. So osterselig war mir noch nie zumute gewesen.
Die Grenze des heimatlichen Kreises war überschritten. So weit war vorher noch keiner von uns gekommen. Franz meinte, jetzt fange die Fremde schon an; Johann erklärte jedoch, die richtige Fremde beginne erst in Breslau… Die Sonne neigte sich zum Untergange. Wir sangen nicht mehr. Franz war müde geworden; er klagte weinerlich, dass er nicht mehr laufen könne. Auch ich war des Wanderns überdrüssig; doch durfte ich nichts sagen, musste vielmehr so tun, als sei ich stark und stramm, weil ich sonst bei Johann im Ansehen gesunken wäre. Wo werden wir schlafen? Die stolze Zuversicht war dahin. Wir sprachen von daheim.
„Was sie jetzt zu Hause machen werden?“
Meine Gedanken waren bei der Mutter, und mir war so heimwehbang, dass ich am liebsten laut geschrien hätte.
Im Abenddunkel saßen wir auf dem Stamm eines gefällten Baumes im Straßengraben und suchten einander die bangen Gefühle durch Scherz und Spott zu vertreiben. Auch hielten wir Rat. Johann schlug vor, unser Geld zusammenzulegen und gemeinsame Kriegskasse zu führen. Obgleich Johann ein gutes Geschäft dabei machte, willigten wir gern ein. Mit meinem Besitztum von zwei Mark und vierzig Pfennigen war ich am reichsten von uns dreien. Franz fühlte sich in seiner weichen, wehen Stimmung zu einem reuevollen Geständnis bewogen. Er erzählte, zu Hause wüssten sie nichts davon, dass er in die Fremde gegangen; sie seien der Meinung, dass er sich mit dem Attest einen neuen Meister in der Stadt suchen wolle. Die Mutter habe ihm eine Mark auf den Weg gegeben; den übrigen Teil seines Geldbesitzes habe er ihr aus dem Nähkasten stibitzt. Er besaß eine Mark und fünfundsiebzig Pfennige. Johann, dessen Eltern schon lange gestorben waren, hatte von seinem Onkel einen Taler bekommen. Davon waren nur noch dreißig oder vierzig Pfennige übrig geblieben; das andere hatte er auf dem Wege nach der Stadt und zum Teil auch zu Hause schon in den Wirtshäusern vertan. Er meinte, man dürfe nicht zu viel Geld haben, sonst lerne man nicht fechten.
Wir gingen weiter. In einem Dorfe, dem wir uns näherten, hatten die Leute bereits Licht in den Stuben angezündet. Doch der Lichtschein der Fenster war für uns kein Gruß des Willkommens. Mir erschein er wie ein Warnungszeichen, das uns riet, nicht in das Dorf zu gehen, weil wir in der Dunkelheit leicht für Bettler oder Zigeuner gehalten werden könnten. Ich erinnerte mich, dass in meiner Heimat oft zur Nachtzeit fremde Bettler und auch Zigeuner angehalten und ins Spritzenhaus gesperrt worden waren, und diese Erinnerung erfüllte mich mit grauen. Wer weiß, ob nicht der Gemeindebote und der Nachtwächter auf der Straße standen und wache hielten! Wehe uns, wenn wir in ihre Hände fielen!… In solcher zitternden Furcht riet ich den Freunden, die Straße zu verlassen, auf den Feldern im Bogen um das Dorf herumzugehen und dabei einen Ziegelofen zu suchen. Die Ziegelöfen seien warm. Wenn wir eine fänden, könnten wir uns in seiner Wärme hinsetzen und warten, bis der Tag beginne. Johann widersprach mir und schritt keck und mutig auf das Dorf zu. Er behauptete, die Gastwirte seien verpflichtet, jedem fremden Handwerksburschen Quartier zu geben. Mein furchtsamer Einwand, dass wir mit dem Gelde sparen müssten, da leicht noch viel kältere Nächte kommen könnten, fand kein Gehör bei ihm, und so ging ich denn zagend hinter ihm her – hinein in das Dorf.
Wir kamen an ein Gasthaus. Vor einer Stalltür des großen Gebäudes stand eine dicke Frau und schalt die im Stall befindlichen Mägde aus. Johann ging dreist auf die Frau zu; Franz folgte nach; ich aber hielt mich vorsichtig zurück, da ich eine kränkende Abweichung befürchtete. Auf Johanns Frage, ob wir Nachtquartier bekommen könnten, gab die Frau keine Antwort. Sie betrachtete uns, wie mir schien, mit Blicken, die wenig verheißungsvoll waren. Dann ging sie näher zur Stahltür und redete wieder mit den Mägden. Ich ärgerte mich über meine Freunde, weil sie zwecklos und zu unserer Schande stehen blieben, statt weiter zu marschieren; bald aber fand ich freudige Ursache, mich meiner Feigheit zu schämen. Die dicke Frau betrachtete uns abermals und rief und zu:
„Meinetwegen! Uf der Streue kinnt ihr schlofen! An Viehm kost’s!“
Zehn Pfennige für einen jeden! Das war billig. Mit frohem, erleichtertem Gemüt folgte ich den Kameraden in die Gaststube nach, und bald saßen wir seelenvergnügt an einem Tische. Behaglich streckten wir die müden Beine aus, und jeder von uns dreien versicherte, er habe gar nicht geglaubt, dass es so hübsch sei in der Fremde.
O, wie müde war ich, - wie müde! Die Füße brannten in den Stiefeln, die Beine waren so steif geworden, dass ich sie kaum zu bewegen vermochte. Trotzdem war mir wundersam wohlig zu Sinn, und mit wahrer Begeisterung half ich eine Schüssel Brotsuppe und eine Schüssel Pellkartoffeln leeren. Eine besondere Würze empfing das gute Abendessen durch eine Unterhaltung, die am Nebentische laut und lebhaft geführt wurde. Dort saßen mehrere Fuhrleute oder Knechte, die über eine unheimliche Begebenheit sprachen. Wir erfuhren aus den Reden, dass in einem benachbarten Dorf eine reiche und angesehene Bauernfamilie durch ein Gespenst an den Bettelstab gebracht worden sei. Jede Nacht habe der Geist im Hause rumort; die Töpfe seien vom Spinde, die Bilder von den Wänden gefallen, und fast in jeder Woche habe ein Stück Vieh daran glauben müssen, bald ein Schwein, bald ein Rind, bald gar ein Pferd.
Einer von der Tischgesellschaft sagte, er wisse genau, wo das Gespenst herkomme. In den sechziger Jahren sei einmal etwas passiert. Er wolle darüber nicht reden, da es gefährlich sei. Aber wenn eine Frau in einem Tümpel ertrinke und der Mann schon drei Vierteljahre später ein reiches Weibsbild heirate, mit dem er bereits zu Lebzeiten der Frau gekramt habe, so könne man sich allerlei denken. Das Gespenst sei bald nach dem Tode des Mannes gekommen, der die reiche Frau geheiratet habe, und wer nicht ganz vernagelt im Kopfe sei, werde das Richtige erraten. Jemand habe der Frau geholfen, in den Tümpel zu fallen, und dieser Jemand müsse dafür als Gespenst herum poltern.
Ein alter Mann, der abseits allein saß, dem Aussehen nach der Dorfschmied, mischte sich mit grobem und rechthaberischem Gebaren in das Gespräch. Er erklärte, dass in seinen Augen jeder, der noch an Gespenster glaubte, ein ausgemachte Dummkopf und Pinkel sei. Man sollte nur den Knecht fragen, der jetzt mit seinem liederlichen Weibsbilde im Hause wohne; der werde Bescheid wissen. Man brauche nur manchmal ein wenig Petroleum in das Viehfutter zu gießen, so könne man das ganze Vieh zugrunde richten. Der Knecht habe sich eine billige Wohnung verschaffen wollen; das sei ihm gelungen… Früher – das sei sicher – habe sich allerdings verschiedenes Gespensterzeug auf der Welt herumgetrieben. Noch zu seines Großvaters Zeiten sei oft um Mitternacht von Strehlen herüber ein Feuermann gekommen; seitdem aber der Papst Gregor das Gesindel in den Bann getan, lasse sich kein Unding, kein graues Männel, kein dreibeiniger Hase, kein Hund mit feurigen Augen, kein Feuermann und kein Drache mehr blicken.
Die Unterhaltung wurde fesselnder, und ich hätte gern noch lange zugehört; doch ein junger, blau geschürzter Mensch kam und gebot uns knurrend, ihm zu folgen. Wir erhoben uns sogleich, waren ihm jedoch nicht schnell genug. Von der Tür aus rief er uns unwirsch zu: seinetwegen könnten wir noch sitzen bleiben und nachher im Straßengraben schlafen. Wir folgten ihm in den Pferdestall.
Gruselige Geschichten hatte ich von jeher gern erzählen gehört, und wenn auch mein Gespensterglaube schon von allerlei Zweifeln und Erwägungen zernagt war, besaß er doch in seinem Kerne noch immer die alte Zaubergewalt. Er ängstigte mich manchmal in finsteren Nachstunden, so dass ich im Bette nicht zu atmen, mich nicht zu rühren wagte; er lähmte mir oft den Fuß, wenn ich nachts auf Wegen gehen musste, die mir nicht geheuer erschienen; er zwang mich manchmal auch am lichten Tage, scheu umher zu blicken und die Schritte zu beschleunigen, wenn ich über gewisse, von Buschwerk umwucherte Grenzgräben schreiten musste, die das Feldgebiet des Dorfes von den Feldern eines andern Dorfes schieden. Einige Male wollte es meinem Erkenntnisdrange beinah gelingen, die Herrschaft zu gewinnen über die beklemmende Furcht, über das seelenlähmende Grauen vor einem unfassbar Unbekannten. Mit Gebetbuch und Rosenkranz bewehrt, forderte ich dann die Grenzgespenster gebieterisch und tapfer zum Kampfe heraus. Um sie zur Rache aufzureizen und ihr Erscheinen gewaltsam zu erzwingen, verfluchte und verspottete ich sie und beschwor sie gar zuletzt in Gottes und Beelzebubs Namen; dabei zitterten mir aber jedes Mal die Glieder in Todesangst – und sicher wäre ich vor Schrecken umgekommen, wenn sich mir wirklich eines der Gespenster zum Kampfe gestellt hätte. Hinterher war ich mir dann nie im Klaren, ob es in Wahrheit keine Gespenster gebe, oder ob am Ende nur der Rosenkranz und das Gebetsbuch ihr Erscheinen gehindert. So ist mein Wissensdurst ungestillt geblieben.
Die Geschichte von dem verhexten Hause, die wir in der Gaststube vernommen, beschäftigte nun stark meinen Geist, und hauptsächlich aus dem Grunde, weil sich in meinem Heimatsdorfe auch ein verlassenes Haus befand, dessen Bewohner einst durch ein Gespenst vertrieben worden. Ich erzählte diese Begebenheit, als wir im Stahl auf der Streu lagen, kam jedoch nicht weit, da meine Kameraden schon nach wenigen Minuten schnarchten. Mein Ärger über diese grobe Missachtung einer spannenden Gespenstergeschichte war nur von kurze Dauer; auch meine Seele kam bald durch Schlaf zum Schweigen. Traumlos, wunschlos verharrte ich, wie tot, bis zum andern Morgen.