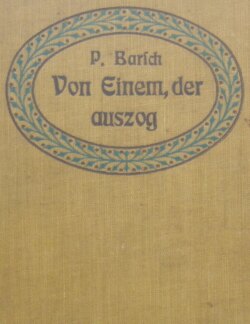Читать книгу Von Einem, der auszog. - Paul Barsch - Страница 13
Das schöne Tal.
ОглавлениеDie böse Not zwang uns zu der Probe, ob wir durch den Schulmeister einige Kenntnisse in der Fechtkunst erlangt hätten. Ich bildete mir ein, ein gelehriger Schüler gewesen zu sein, und wenn ich meinem Begleiter auseinandersetze, wie man es anfangen müsse, um recht mit Erfolg zu dalfen, erfüllte mich dabei das hohe Bewusstsein, dass ich ein tafter Kunde sei.
„Nur immer recht forsch und herzhaft! Das ist die erste Hauptsache!“
Wohl drangen wir herzhaft in die Bauernhöfe ein; wenn wir aber vor den Leuten standen und unsere Bitte vortrugen, machten wir dabei keine herzhaften Gesichter. Wir begingen den Fehler, dass wir Mitleid und Erbarmen zu wecken suchten. Der Lackierer hatte nicht gebettelt, er hatte gefordert und so getan, als seien die Menschen verpflichtet, reisende Handwerksburschen zu unterstützen. An vielen Orten wurden wir abgewiesen, oft mit Worten, die so weh taten, dass wir dem Weinen nahe waren. Andere Gaben als trockenes Brot und hier und dort einen Pfennig oder ein Zweipfennigstück bekamen wir nicht. Ich wusste ganz gut, dass es unklug von uns war, klägliche Elendsmienen aufzusetzen, statt lustig und keck aufzutreten; doch gelang es mir nicht, dem Beispiel des Lackierers zu folgen.
Fünf oder sechs Tage zogen wir in Niederschlesien umher und dachten dabei nicht an die Möglichkeit, Arbeit zu finden; auch erörterten wir nicht die Frage, welchen Zweck unser Wandern habe und wohin es führen sollt. Die einzige Aufgabe, die wir uns an jedem Morgen stellten, war der Vorsatz: mit dem Dalfen nicht eher Feierabend zu machen, bis eine Mark beisammen wäre. Da wir immer frühzeitig aufstanden und bereits vor Sonnenaufgang marschierten, hielten wir den vor uns liegenden Tag für unendlich lang, und so glaubten wir, dass es eine Kleinigkeit sei, während der vielen Stunden hundert Pfennige zusammen zu fechten. Wir mühten uns fleißig; und dennoch, wenn der Abend dunkelte, betrug unser Schatz gewöhnlich nur vierzig bis fünfzig Pfennige. So schnell waren uns die Tage noch nie vorübergegangen. Als wir noch in der Werkstatt arbeiteten, wollten sie manchmal gar kein Ende nehmen.
Nachtquartier fanden wir in Dorfwirtshäusern, wo wir keine willkommenen Gäste waren. Gewöhnlich murrten die Wirtsleute und meinten, es wäre besser gewesen, wenn wir in ein anderes Gasthaus gegangen wären. Behielten sie uns, so durften wir im Pferdestall oder auf dem Strohboden oder auf Streu in der Schenkstube schlafen. An Schlafgeld bezahlten wir gewöhnlich zwanzig bis dreißig Pfennige. Reichte das Geld aus, dann ließen wir uns am Abend eine Suppe oder einige Kartoffeln kochen.
Einmal gingen wir in der Abenddämmerung durch einen stillen Wald. Der Tag war sonnenklar und warm gewesen; sein lachendes Leuchten hatte verklärend eingewirkt auf unsere Gemüter. Das Glück war uns beim Dalfen ungewöhnlich günstig gewesen; auch hatten uns zwei Tischlermeister, bei denen wir vorgesprochen, angenehm beschenkt. Dazu kam, dass wir bei einem Schmiedemeister ein gutes Mittagessen und in einem Hochzeithause jeder ein Stück Kuchen erhielten. Beruhig konnten wir der Nacht entgegensehen; unsere Kasse gab uns guten Trost… Feierlich still war der Wald. Kein Luftzug bewegt die Wipfel und Zweige. Fern in den Bäumen flötete ein Vogel. Ein Wandervogel vielleicht, der heimgekehrt war von der Reise. Franz bückte sich und pflückte ein Kräutlein. „Das ist heuer schon gewachsen“, versicherte er. Er war den Frühling gewahr worden, - er, dessen Empfindungswelt sonst nur Gedanken an seine Müdigkeit, an seine wunden Füße, an Hunger, Heimweh und Reue aufkommen ließ.
„Wie alles schon wächst!“ sprach er, „Hier muss es im Sommer viele Heidelbeeren geben… Weißt Du noch, wie wir voriges Jahr bei mit zu Haus in den Heidelbeeren waren?“
„Ja ich weiß! Deine Schwestern waren dabei.“
„Und die Berta war so lustig. Die hat fortwähren Unsinn mit Dir getrieben.“
„Die Berta ist meine Braut. Sie hat gesagt, wenn ich erst ein reiche Meister bin, soll ich zu ihr kommen und sie heiraten.“
„Du irrst Dich! Das hat die Marie gesagt… Was mögen sie jetzt machen?“
„Vielleicht die Kühe füttern und melken.“
„Sie denken gewiss an mich… Wenn ich doch jetzt hinfliegen könnte!“
Eine urmächtige Sehnsucht ergriff ihn, und er weinte. Er weinte lauter, immer lauter, und ließ sich nicht beruhigen. Ich bat ihn, kein einfältiges Kind zu sein und kein Narr; zürnend macht ich ihn darauf aufmerksam, dass er sich schämen müsste, wenn jemand zufällig des Weges käme. Da erklärte er in Jammerlauten, dass er nicht weiter mitgehen, sondern umdrehen wolle. Ärgerlich ging ich voraus, und langsam, widerstrebend, kam er hinterdrein. Er weinte noch immer und machte mir den Vorwurf, dass ich schuld sei an seinem Unglück. Er sei nicht willens gewesen, so weit in die Welt zu gehen; ich aber hätte ihn immer weiter und weiter gelockt. Zum ersten Male seit unserem Aufbruch sprach er in solch’ herber Weise zu mir. Ich empfand seine Worte als kränkendes Unrecht und verteidigte mich.
Der Wald war zu Ende und der Weg machte eine Biegung. Überrascht blieben wir stehen. Ein wundersames Naturbild bot sich unseren Blicken dar. Wir sahen ein buntes Tal, das von dunklen, hohen Wäldern eingeschlossen war, und erkannten, dass wir uns auf einer beträchtlichen Höhe befanden. Zur Rechten des Weges stürzte sich ein felsiger Abhang schräg hinunter in eine Tiefe, deren Anblick mich so schwindelig machte, dass ich zaghaft auf die andere Seite des Weges trat. Unten am Abhang, Turmtief unter uns, standen einige kleine Häuser. Sie erinnerten mich an hölzerne Schäferhäuschen, wie sie die Kinder aus Spielzeugschachteln nehmen und auf den Tisch stellen; so niedlich und gering sahen sie aus auf der weiten grünen Fläche. Inmitten des Tals wohnten viele Menschen. Aus einem Gewirr von ziegelroten Dächern ragten zwei Kirchtürme schlank empor.
„Wie das alles aussieht!“ sprach ich zu Franz. „Sieh nur die Dächer und die Türme! Als ob sie mit weißer oder roter Tusche auf dunkles Papier gemalt wären!“
„Das ist eine Stadt!“ sagte Franz.
„Meinst Du? Ich glaube eher, dass es zwei oder drei Dörfer sind, die nah beisammen liegen.“
Auf allen den vielen Meilen, die wir gewandert, hatten wir keine Landschaft gesehen, die viel anders gewesen wäre, als die Gegen bei uns daheim. Die Welt, die sich jetzt vor uns aufgetan, war überraschend für uns. Nie vorher war mir klar geworden, dass eine schöne Gegend den Menschen entzücken könne. Jetzt auf einmal begriff ich die Menschen, von denen ich schwärmerische Lobreden auf die Herrlichkeit der Natur vernommen hatte. Natur war eben nur Natur für mich gewesen – etwas Selbstverständliches, das wir immerzu vor Augen haben und worüber zu reden sich nach meiner Ansicht nicht lohnte. Gemalte Bäume, gemalte Häuser, Flüsse, Teiche, Gärten, Felder und Wälder – ja, das war schön! Besonders, wenn die Bäume in Blüte standen, oder wenn Rosen und andere Blumen auf den Bildern prangten! Solche Bilder anzuschauen, ward ich nicht müde. Ein gemalter Schmetterling war für mich ein berückendes Wunder; dem Gaukelspiele des lebenden Schmetterlings sah ich gleichgültig zu.
Ein Bild hatte eins einen unvertilgbaren Eindruck in meiner Seele erzeugt. Das war ein Prämienbild, das in der guten Stube der Gastwirtin in meinem Heimatdorfe hing. Diese Frau hatte einen Räuberroman in Lieferungen mit anderen Abnehmern gehalten und das Bild als Beigebe bekommen. Von meinem Vater war es eingerahmt worden. Das Bild hieß „Die Insel der Glückseligkeit“. Ich weiß nicht, waren es die bunten Farben, oder war es die märchenhafte Unterschrift, oder beides zusammen, was in der Knabenbrust so seltsam-phantastisch süße Regungen, so unendliche Sehnsucht wachgerufen. Oft in Stunden der Einsamkeit dachte ich an das buntprächtige Gemälde; im Geiste sah ich den von der Sonne beleuchteten Rasen der Gärten, die dunkelgrünen Schatten, die hohen, breit ästigen Bäume, die rot und blau und gelb und weiß blühenden Gebüsche, die Blumen auf den Beeten, die stillen, blauen Wasser und die weißen Häuschen, die gastlich aus der Tiefe der Gärten schimmerten – –, und ich bevölkerte diese Insel dann mit starken, klugen Männern und schönen Frauen, denen alle Erbärmlichkeiten der sonstigen Welt und insbesondere meiner Dorfheimat fremd waren.
Nein, das war ein anderes Bild, das ich jetzt mit sehnsuchtsfeuchten, staunenden Augen sah! Andere Dinge und andere Farben; ein anderes Licht, ein anderer Ton, ein anderer Rahmen; und dennoch wirkte es so lockend und vertraulich, so frieden- und wonneverheißend auf mein verlangendes Gemüt, wie jene gemalte Insel der Glückseligkeit aus meinen Knabenjahren… Ich glaubte die Sonne schon lange versunken; doch war sie nur verhüllt gewesen vom Abendgewölk. Jetzt zerriss sie die dichten Schleier, trat in rot flammender Herrlichkeit hervor und wollte noch einmal das schöne Tal beschauen. Da ergoss sich über die finsteren Höhen ein breiter Lichtstreif und verklärte auch die Türme und höchsten Dächer. Das war wunderherrlich zu schauen, währte jedoch nur kurze Zeit, da die Sonne müde in ihr goldenes Bett versank. Die Waldhöhen traten jetzt finster, wie schwarzer Gewitterhimmel, hervor, und auch das Tal hatte den bunten Glanz verloren; mir im Gemüt aber lebte lieb und licht die Gewissheit, dass dort unten gute Menschen wohnen.
Das erste Gebäude, an dem wir vorbeigingen, war ein großes Gasthaus mit dem Namen „Deutscher Kaiser“. Dann führte die Straße über einen geräumigen, sandigen und von Häuser umgebenen Platz, auf dem vielleicht die Märkte abgehalten wurden; sie geleitet uns in eine lange, gekrümmte Gasse. Auf einem schmalen Bürgersteige gingen wir an niederen Häusern entlang. Die Schilder an den Türen waren unscheinbar und altmodisch, die Türen niedrig und die Fenster klein. Die Bewohner hatten bereits Feierabend gemacht; in schlichter Arbeitstracht standen sie mit verschränkten Armen an den Häusern oder in den Haustüren und plauderten. Unsere Grüße erwiderten sie mit lauter Stimme. Einige Male vernahm ich, dass sie sich lustig über uns machten, und zwar spotteten sie über unsere krumm gelaufenen Stiefel. Ich ging nun mitten auf der Straße und grüßte nicht mehr, denn ich glaubte, das Erwidern meiner Grüße sei nur Hohn. Ich senkte die Augen nieder und wollte nichts mehr sehen von der Stadt und den Menschen. In mein Gemüt war Finsternis gekommen; das heitere Vertrauen zu den Menschen im stillen Tale war dahin; ich hielt mich für überzeugt, dass sie noch rauer, herzloser und kälter seien, als die Menschen draußen in der Ebene. O, dass ich so arm war – so arm und unwissend und unbeholfen! Wenn doch der Tod käme! Ich konnte nicht bestehen in der Fremde! Ich wusste nicht, wie ich den Kampf um mein Leben führen sollte!
Wir gelangten in eine enge Gasse; dort stand an einem kleinen Hause in großen Buchstaben zu lesen: „Herberge zur Heimat“. Franz fühlt sich freudig berührt; er wollte, dass wir in der Herberge übernachten, weil wir da wieder einmal Gelegenheit hätten, in einem Federbett zu schlafen. Unser Geld reiche ja aus. Ich sträubte mich gegen den Vorschlag und hätte es vorgezogen, noch bis in das nächste Dorf zu marschieren; so groß war mein Widerwille gegen die Stadt und ihre Bewohner. Franz aber besiegte mich durch Tränen. Weinend beteuerte er, dass er gar zu müde sei und nicht weiter laufen könne. So willigte ich zögern ein, dass er hineingehe und sich nach den Preisen der Betten erkundige.
Während Franz in der Herberge weilte, kam des Weges ein Mann, der eine Säge, einen Hobel, einen Hammer und einen Stechbeutel trug. Auch ohne diese Kennzeichen hätte ich einen Tischler in ihm erkannt; seine schiefen Beine, seine ungleichen Schultern und die mit Leim und Holzstaub geblümte Schürze verrieten ihn. Ehrfurchtsvoll zog ich die Mütze zum Gruß, da er offenbar ein Meister war. Er blieb stehen, musterte mich und fragte:
„Tischler?“
„Ja!“
„Papiere?“
„Ja!“
Ich zog mein Gesellenzeugnis aus der Tasche und überreichte es ihm. Ohne es zu entfalten, fragte e weiter:
„Haben Sie Lust, zu arbeiten?“
„Ja – wenn Sie so freundlich sein wollten…„
„Da kommen Sie mit! Vielleicht werden wir fertig miteinander.“
Ich begleitete ihn in seine Werkstatt. Sie befand sich in der engen Gasse, der Herberge gegenüber. Der Meister zündete eine Lampe an und las das Zeugnis.
„Wie gesagt: wenn Sie wollen, so bleiben Sie da!“
Ich war so überrascht und beglückt, dass ich kein Wort hervorbrachte.
„Sie wollen wohl nicht?“ fragte er schroff. „Mir ist’s egal! Leute gibt’s jetzt massenweise.“
„O ja, ich will!“ sprach ich erschrocken.
„Das ist was anderes!... Da ist Ihre Hobelbank! Wenn Sie nicht in der Herberge schlafen wollen, können Sie bald dableiben. Sie haben doch kein Ungeziefer?“
„Nein!“
„Das bitt ich mir auch aus! Das Bett will ich mir nicht versauen lassen. Es steht auf dem Boden.“
Wohl verletzte mich die Grobheit des Mannes und flößte mir Furcht vor ihm ein; doch über alle meine düsteren Gefühle und über mein Bangen siegte die jubelvolle Tatsache, dass ich Arbeitsgeselle geworden. Nun war ich nicht mehr ohne Obdach, ohne Heimat, brauchte nicht mehr mein Brot zu erbetteln und mich schmachvoll beschimpfen zu lassen, konnte jetzt Nacht für Nacht in einem Bette schlafen. Im Herzen tat ich den heiligen Schwur, alle Kraft aufzubieten, um das Vertrauen zu rechtfertigen, das der Meister in mich gesetzt. Aber Franz – der arme Franz! Was wird er sagen?... Ich teilte dem Meister mit, dass auf der Straße mein Reisegefährte auf mich warte, und bat um eine halbe Stunde Urlaub.
„Machen Sie, was Sie Lust haben!“ erwiderte er mürrisch. „Für heut haben wir Feierabend. Aber wenn Sie hier schlafen wollen: um neun Uhr wird die Klappe zugemacht.“
Mit dem Versprechen, rechtzeitig zurückzukehren, eilte ich hinaus. Franz stand auf der Straße und sucht mich mit ängstlichen Blicken. Er kam mir entgegen uns sagte, dass die Preise in der Herberge gar nicht hoch seien. Ich unterbrach ihn mit der Mitteilung, dass ich nicht in der Herberge, sondern im Hause meines Meisters schlafen werde. „Ich habe Arbeit gekriegt.“ Er hielt meine Worte für Scherz; doch als ich ihm mein Erlebnis erzählte, prägte sich Schrecken in seinem Gesicht aus, und als ich sagte, er müsse nun allein wandern, begannen wieder Tränen über seine Wangen zu rinnen… Franz war trostlos. Alles gute Zureden war unnütz; alle Versprechungen blieben wirkungslos. Er weinte so laut, dass Menschen herbeikamen und bei uns stehen blieben. Eine Frau sah mich giftig und drohend an und richtete an Franz die Frage, ob ich ihm etwas weggenommen hätte. Er erklärte heulend, seine Füße täten ihm weh, worauf die Frau verlegen zurückwich. Mit stockender Stimme bat er mich, ihm die Arbeitsstelle zu überlassen. Ich hätte gesunde Beine und könnte laufen; er aber komme nicht mit seinen kranken Füßen weiter.
Um den neugierigen Menschen zu entrinnen, zog ich mich in das Haus des Meisters zurück. Franz folgte mir, und auf der düsteren Treppe wiederholte er dringend seine Bitte. Ich fühlte, dass ich ihm helfen müsse, und forderte ihn auf, mit mir zum Meister zu gehen. Er trocknete die Augen; mir aber wurde bitter weh zu Sinn. Alle die Himmel, die sich mir nach langer Leidenszeit nun erschließen wollten, sah ich wie Traumgebilde zerrinnen. Den Meister trafen wir noch in der Werkstatt. Mit unsicherer, bebender Stimme bat ich ihn, meinen Kollegen als Gesellen anzunehmen und mir den Abschied zu geben.
„Sie sind wohl zu faul zur Arbeit?“ fragte er.
„Nein, Herr Meister! Aber mein Kollege…“
„Sie brauchen ’s bloß zu sagen, dann kriegen Sie Ihren Zettel gleich zurück! Ich habe Ihnen angenommen und nicht den andern! Entweder Sie bleiben oder Sie gehen! Mir kann’s egal sein!“
Er drehte uns den Rücken zu, und Franz benützte diese Gelegenheit zur Flucht. Ich ging ihm nach und holte ihn erst auf der Straße ein. Die Lust zur Arbeit war ihm vergangen. Er verlangte, dass ich weiter mit ihm wandere, und fühlt sich sogar stark genug, mit mir das nächste Dorf zu erreichen. Mein Entschluss aber war, bei dem Meister zu bleiben. Ich führte also den Freund in die Herberge, bestellte Suppe, Butterbrot, Käse, zwei Schnäpse und erklärte ihm währen des Abendessens, dass das Scheiden einen Notwendigkeit geworden sei. Anfänglich war kein vernünftiges Wort mit ihm zu reden; er hielt es für unmöglich, dass ich ihn verlassen könnte. Erst als er die warme Suppe genossen und den Schnaps getrunken hatte, gewann er ein wenig frische Lebenskraft… Seit dem Tage unseres Ausmarsches hatte ich keinen Schnaps getrunken. Als Arbeitsgeselle glaubte ich ein wenig nobel auftreten zu müssen; daher trieb ich solche Verschwendung.
„Morgen früh“, sprach ich, „bitt ich den Meister um eine Vorschuss und gebe ihn Dir als Reisegeld. Da wirst Du tagelang damit auskommen. Und die Leute an jenem Tische sind Kunden; vielleicht findest Du einen andern Reisegefährten.“
Da er noch immer nicht beruhigt war, schenkt ich ihm die Schuhe aus meinem Bündel, damit er ein leichteres Gehen habe, und auch noch das Vorhemd dazu. Nach dem Abendbrot riss ich mich von ihm los und forderte ihn auf, am anderen Morgen in die Werkstatt zu kommen.
Der Meister führte mich in die Bodenkammer, in der mein Bett stand, und übergab mir das Lager mit der Ermahnung, kein solcher Sauigel zu sein, wie der vorige Geselle… Ich lag in einem Federbett. Die Federn waren weich und wärmten mich, und wenn der liebe Gott so dachte, wie ich, dann sollte das Bett eine lange Zeit mir angehören; im Sommer und im Winter wollte ich darin schlafen… Wenn nur der Meister nicht so grimmig wäre! Ich fürchtete mich vor ihm. Doch er war ja mein Erretter. O, wie ich fleißig sein und alle meine Gedanken zusammennehmen wollte, um seine Zufriedenheit zu erwerben! Das Wandern war manchmal eine Lust, wenn die Sonne schien, wenn wir uns satt gegessen hatten, und wenn die Pfennige in der Tasche nahezu ausreichten für das Nachtquartier. Erzählte unterwegs einer eine schöne Geschichte, oder plauderten wir von der Schulzeit, oder erinnerten wir einander an die lustigsten Erlebnisse aus der Lehrzeit – – was war das für ein Vergnügen! Hätte ich aber wegen der großen Überproduktion keine Arbeit bekommen und weiter wandern müssen – wer weiß, wie lange! – – was wäre da wohl geschehen? Schon jetzt waren die Stiefel schief und die Kleider schlecht, und mit der Zeit wäre ich vielleicht gar ein Stromer geworden. Und wenn ich an das Fechten dachte, an die groben Worte, die man da zu hören bekam, an die schändlichen Ausdrücke, mit denen man abgewiesen wurde – – o, da wollt ich doch lieber bei dem grimmigsten und schlimmsten Meister arbeiten und mich von ihm stoßen und ausschimpfen lassen, als noch länger betteln gehen!... Was die Mutter sagen – wie sie staunen und sich freuen wird, wenn sie aus meinem ersten Briefe erfährt, dass ich Arbeitsgeselle bin – Arbeitsgeselle in einer Stadt, die weit, weit entfernt liegt von ihrem Dorfe? Im Geiste sah ich, wie die mit dem Briefe zu ihren Hauswirt ging, dem Schuster, der auch auf der Wanderschaft gewesen war und einige Landkarten besaß; ich sah, wie er die Karten entfaltete und gemeinsam mit der Mutter die Stadt suchte, in der ich weilte. In Gedanken entwarf ich den Brief, den ich der Mutter schreiben wollte, und bei dieser Gelegenheit zogen die Wandererlebnisse der jüngsten Tage an meiner schauenden Seele vorüber. Ich wunderte mich fast, dass ich der Held aller der seltsamen Begebenheiten und Abenteuer war, und kam mir als ein tüchtiger Gesell vor, der in die Welt passe. Dann fasste ich wieder die schönsten Entschlüsse für die kommende Zeit und für alle Zukunft, betete dazwischen viel andächtiger, als ich es an den vorhergegangenen Abenden getan hatte und glitt unmerklich hinüber ins Traumland…