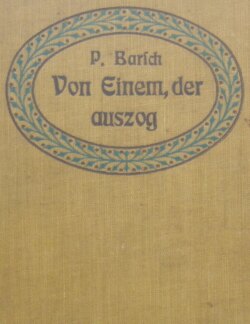Читать книгу Von Einem, der auszog. - Paul Barsch - Страница 5
Der Ausmarsch
ОглавлениеWir hatten Glück. Wenige Tage, nachdem Schillers Werke für uns zum großen Ereignis geworden, verschwand der Meister.
Langsam vollendeten wir unsere Arbeiten. Als wir fertig waren und die Gesellen ihre Tätigkeit eingestellt hatten, konnten wir dichten von morgens bis abends. Mein Vertauschtes Kind nahm an Umfang und Schönheit zu. Ich schuf es nach dem Vorbilde, das mir die Räuber geliefert hatten. Das Beste daran schienen mir die schändlichen Selbstgespräche zu sein, die ein Ritter hielt, der aus teuflischer Bosheit ein Grafenkind geraubt und dafür das Kind eines Scharfrichters in die Wiege gelegt hatte. Für wohl gelungen hielt ich auch die Reden der Gräfin und der Amme an der Wiege des Kindes. Sie wunderten sich über die Veränderung, die sie an dem Kleinen Geschöpf wahrzunehmen glaubten. Die Gräfin hörte zuweilen in ihrem liebenden Mutterherzen eine grauenvolle Stimme, die ihr sagte, dass sie ein fremdes Kind liebkose. Vergeblich forschte sie nach dem Muttermal an der linken Brust, das sie bald nach der Geburt gesehen hatte. Die Amme, die mit dem schuftigen Ritter in Bunde stand, suchte ihr einzureden, dass das mal am siebenten Tage nach der Geburt langsam verschwunden sei. Zuletzt sollten Gerechtigkeit und fromme Unschuld siegen; auf welche Weise – das war mir noch zweifelhaft… Das Stück war für das Stadttheater bestimmt. Wenn ich mir im Geiste das Erstaunen des Theaterdirektors vorstellte, in das ihn mein Vertauschtes Kind versetzen sollte, geriet ich in wilde Freude und unbändigen Stolz. Ich sah ihn begeistert meine Blätter lesen und hörte ihn verwundert fragen, wie es möglich sei, dass in einer kleinen Stadt ein so großer Dichter erstehen könne. Ich malte mir aus, wie er zu mir kam, sich verneigte und mir sagte, dass das Vertauschte Kind an Großartigkeit den Räuber gleichkomme. Die Aufführung des Stückes sollte mir solchen Ruhm bringen, wie ihn nur ein König besitzen konnte. Meine Mutter, mein Vormund, Johann, Franz und Cäcilie sollten in der ersten Reihe auf den besten Plätzen sitzen, - - Ich wäre rascher mit dem Dichten vorwärts gekommen, hätten mich nicht meine Mitdichter alle Augenblicke in schwierigen Fällen zu Hilfe gerufen. Sie litten zwar keinen Mangel an Gedanken, fanden jedoch oft keine passenden Reime.
Eines Nachmittags nahm das Dichten ein trauriges Ende. Johann war mit seinem Gedicht „Leim“ nahezu fertig; es fehlte ihm nur noch ein geeigneter Reim auf „Schranktürfüllung“, und ich war bestrebt, ihm über das Hindernis hinwegzuhelfen, - da stecket der lange Lorenz seinen Kopf in den Ofenwinkel und schrie uns an:
„Hundsfötter, was treibt Ihr hier für verdammte Faxen? Heiz ein, dass wir nicht erfrieren in der verfluchten Bude!“
„Wir haben kein Holz mehr, Herr Lorenz!“ erwiderte Johann, der in solchen Fällen als ältester Stift die Pflicht zu reden hatte.
„Unsinn, verdammter! Draußen liegen Bretter und Bohlen; auf dem Boden liegen Stollen und Furniere; in allen Winkel hat’s Holz! Zerhackt die Hobelbänke! Schmeißt das Werkzeug ins Feuer! Zerschlag die Schränke und verbrennt sie!“
Sein Blick fiel auf den Bogen Papier, auf dem das Leimgedicht stand. Er ergriff es und sagte: „Das kann ich zum Einwickeln brauchen. Ich will mir die Pantoffeln mit nach Hause nehmen.“
Johann wollte das Blatt retten. Dabei entschlüpften ihm halblaute Worte der Entrüstung. Für diese Unbotmäßigkeit erhielt er eine so kräftige Maulschelle, dass er hin taumelte. Schnell raufte er sich auf und schrie in maßlosem Zorne: „Sie lange Esel! Sie Grobian! Jetzt lass ich mich von Ihnen nicht mehr hauen!“ Mit einem kräftigen Stoß warf er den trunkenen Altgesellen nieder und flüchtete zur Tür hinaus. Das kostbare Blatt ließ er leider in den Händen des Langen Lorenz zurück. Der polnische Lukas lachte über den Spaß; wir aber – Franz und ich – machen uns sprungfertig, aus Angst, Lorenz könnte sich für die erduldete Schmach an uns beiden rächen. Er aber kroch zu seiner Hobelbank, richtete sich dort auf, schimpfte und fluchte und trank auf ein Ansetzen seine Flasche leer.
„Besorgt zu saufen!“ grölte er befehlend und richtete seine finsteren Augen auf uns.
Wir hatten für unsere letzten Pfennige Papier zum Dichten gekauft, konnten ihm also nicht dienlich sein. Früher pumpte der Gastwirt; seit der Meister fort war, borgte er nichts mehr, forderte sogar Bezahlung der alten Schulden. Trotzdem verlangte Lorenz von uns Schnaps. Widerspruch litt er nicht, und er wäre grob geworden, wenn nicht der polnische Lukas das Unglück von uns abgewendet hätte. Lukas verfiel auf den Politurspiritus und holte ihn aus der Kammer.
Johann und ich hatten geahnt, dass es so kommen werde, und um den Politurspiritus zu retten und die Gesellen vor einem schweren Rausche zu schützen, hatten wir ein wenig Schellack in die Flasche getan. Schellack schmeckt abscheulich.
Der polnische Lukas nahm einen starken Schluck und schüttelte sich voll Abscheu und Zorn. „Brrr - is sich Schellack drin!“
„Schellack?“ fragte der lange Lorenz. „Wer hat den Schelllack hineingetan?“
„Meister, verfluchtiges! Wer sunst!“ entgegnete Lukas.
Lorenz kostete. Den Probeschluck spie er prustend aus. Nachdem er kräftig geflucht hatte, erklärte er in feierlichem Tone, dass ihm sein Ehrgefühl verbiete, in einer Bude zu bleiben, in der aus Misstrauen gegen die Gesellen der Politurspiritus mit Schellack vermischt werde. Fortwährend schimpfend, suchte er seine Sachen zusammen. Meine Aufmerksamkeit war beständig auf Johanns Leimgedicht gerichtet. Ich wartete auf eine Gelegenheit, es heimlich zurückzuerobern; sie fand sich aber nicht. Lorenz wickelte seine Filzpantoffeln in das Blatt – und ich musste schaudernd und empört zusehen, wie das Gedicht auf schandhafte Weise vernichtet wurde.
Ohne sich zu verabschieden, zog der lange Lorenz ab.
Immer noch beschäftigte sich der polnische Lukas mit der Spiritusflasche. Dem Meister zum Trotz müsse, meinte er, der Politurspiritus gesoffen werden. Und wirklich: im Laufe zweier Stunden leerte er die mit neunzig gradigen Kartoffelspiritus gefüllte Literflasche bis auf den Rest. Der Schellack schien ihm den Genuss nicht zu verleiden. Als die Flasche leer war, legte er sich in die Hobelspäne und schlief ein.
Im Hofe stand Johann und winkte uns zu. Wir eilten hinaus und berichteten ihm, dass der lange Lorenz fort sei. Die Nachricht war ihm gleichgültig. Er erzählte, dass er auf dem Getreidemarkt einen Bauer aus seinem Heimatdorfe getroffen und ihn gebeten habe, mit ihm nach Hause fahren zu dürfen. Er wäre bei uns geblieben, wenn er gewusst hätte, dass Lorenz auf dem Sprunge sei; nun müsse er sein Versprechen halten und mit dem Bauer fahren.
Als Johann seine Habe zusammenpackte, kam auch über Franz die Sehnsucht nach der Heimat. Er rannte gleichfalls nach dem Getreidemarkt, um eine Fahrgelegenheit zu suchen. Eine Stunde später kam es zu einem herzlichen Abschied. Johann lachte und zeigte sich gleichmütig; mir aber war das Herz recht schwer. Denn ich fürchtete, dass es ein Scheiden fürs ganze Leben sei, und Bangigkeit und Trauer brachten mich zum Weinen. Durch meine Tränen verleitet, weint auch Franz; als er aber auf den lachenden Johann blickte, heiterte sich sein kleines Gesicht schell auf. Ich bat sie beide, das Dichten nicht zu vergessen und mir ihre Gedichte zu senden. Sie versprachen es leichthin und gingen.
Nun stand ich allein. Ich suchte und fand Trost bei meinem Vertauschten Kinde. Leider war alles vorhandene Schreibpapier so voll gedichtet, dass sich nirgends mehr ein Vers unterbringen ließ. Geld für neues Papier besaß ich nicht; daher war ich gezwungen, auf glatt gehobelte Brettstücke zu dichten.
Am andern Morgen erwachte der polnische Lukas aus seinem langen Schlafe. Er rieb sich die Augen und redete närrische Worte. An mich wandte er sich mit der Frage, ob seine Frau da gewesen sei. Ich wusste nicht, dass er eine Frau besaß. Er wohnte „auf Schlafstelle“ bei einer Witwe. Seine Augen waren verstört und glanzlos; sein Gesicht hatte ein leichenfahles Aussehen bekommen. Mich befiel bei seinem Anblick eine Angstbeklemmung, wie ich sie zuweilen empfand, wenn wir Lehrjungen einander des Nachts vor dem Einschlafen Gespenstergeschichten erzählten. Schreckhaft waren seine Augen, unheimlich, hohl. Er schwankte zur Tür hinaus in den kalten Wintertag, barhäuptig, in seinem leichten Arbeitsrock, Pantoffeln an den Füßen. Langsam, den Kopf gesenkt, zog er wie ein Träumender an den Fenstern vorüber, dem Hintertore zu. Unter der Hobelbank standen seine Stiefel, an der Wand hingen sein Rock und sein Hut, auf dem Fensterbrett lag sein Taschenspiegel.
Als ich mich kaum wieder über mein Vertauschtes Kind hergemacht hatte, trat Cäcilie geräuschlos in die Werkstatt. Ein seltener Gast! Schnell warf ich das Brettstück, auf das ich einen neuen Jammerausbruch der um ihr Kind betrogene Gräfin niederschreiben wollte, hinter den Ofen, sprang empor und trat dem Fräulein zaghaft und mit klopfendem Herzen entgegen. Doch meine Befürchtung, Cäcilie werde schimpfen, weil ich faulenzend in den Hobelspänen gelegen, war grundlos. Scheu blickte sie umher und fragte, ob ich allein sei.
„Ja!“
„Ich sah den Johann und den Franz aus dem Hofe gehen; den einen mit einem Koffer, den andern mit einem Bündel. Wo sind die hingegangen?“
„Nach Hause! Sie haben Fahrgelegenheit gefunden. Mit ihrer Arbeit sind sie fertig, und da…“
„Wie können sie ohne meine Erlaubnis nach Hause fahren?“ schrie Cäcilie in jähem Zorn. „Das sein ja erzfreche Lümmel! Und Du lässt sie gehen und rufst mich nicht?“
Ich kam zu keiner Erwiderung. Cäcilie begann zu weinen und bedeckte das Gesicht mit der Schürze. Sie schluchze so laut, dass ein tiefes Mitgefühl auch mir die Tränen in die Augen trieb.
„Nicht einmal ’raufgekommen sein sie und haben adje gesagt!“ klagte sie weinend. „Bin ich denn das nicht wert?… Bin ich denn eine schlechte Person?… Alle sein schlecht zu mir, und ich hab’ es immer so gut gemeint…“
Ihr Weinen und Schluchzen steigerte sich bis zum heulen; plötzlich aber brach sie ab und rief: „Das lasse ich mir nicht bieten!“ Hastig trocknete sie die Augen. Darauf sah sie mir offenen Blickes ins Gesicht und fragte: „Verachtest Du mich auch?“
Die Frage, von einer hoch stehenden, gefürchteten Herrin an den gehorsamen Diener gerichtet, entflammte mich zu ritterlicher Ergebenheit, und aus übervollem Herzen antwortete ich mit einem festen „Nein!“
Sie ergriff meine Rechte und presste sie mit beiden Händen. „Du bist besser wie die andern“, sagte sie lieb und gütig. „Dich hab’ ich immer für eine treue Seele gehalten.“
Ich glaubte, ich wäre ihr glückstrunken und in übermächtiger Rührung zu Füßen gesunken und hätte ihre Knie umklammert, wenn nicht zufällig ihre Mutter zum Besuch gekommen wäre. Die alte Frau stand im Hofe und redete mit dem Wagenbauer. Cäcilie drückte mit noch einmal herzhaft die Hand, bat mich, sie ja nicht zu verlassen, und eilte hinaus.
Berauscht von Glück und stolz sah ich ihr durch Fenster nach, und als sie verschwunden war, lugte ich verstohlen hinauf zu den Fenstern des Wohnzimmers, in der sehnsüchtigen Erwartung, sie dort noch zu sehen. Ich schmachtete nach ihrem Anblick; mir war, als sei nun zwischen ihr und mir ein unlösbares Bündnis für das ganze Leben geschlossen, als gehörte ich fortan in ihre Nähe, als müsse ich nun bei Tag und bei Nacht ihr getreuer Diener, Ritter und Held sein und jeden erschlagen, der es wagen sollte sie zu verachten. Sie war für mich plötzlich ein edles Wesen geworden, ein verkannter Unschuldsengel, eine anbetungswürdige heilige Erscheinung. Sogleich entwarf ich allerlei wunderreiche, poesievolle Zukunftsbilder. Am längsten verweilte ich bei dem Wunschtraum, der mir erzählte, wie ich die unschuldige und von schlechten Menschen verachtete, von mir jedoch treu geliebte Cäcilie nach einer stillen, fruchtbaren Gegend führte, dort aus Holz und Reisig eine Hütte für uns baute, die süße Dame darin auf Land bettete und allda sie pflegte, bis sie in Frieden eines Knäbleins genas. Ich war ihr Gebieter, ihr Erretter, ihr Arzt, ihr Priester, ihr Ernährer, ihr Beschützer und Verteidiger, ihr Geliebter. Auch ihr Dichter wollt ich sein, und so berühmt sollte sie werden durch mich, wie Laura durch Schiller! Schon schwirrten mir die ersten Werke zu ihrem Ruhme durch den Kopf. Ich wollte sie im Leibe vergleichen mit der tugendhaften Genoveva; das Söhnlein aber, das sie in der verborgenen Waldhütte zur Welt gebracht, sollte nicht Schmerzensreich, sondern Wonnereich heißen; denn wir wollten ein wonniges Familienleben führen und das Knäblein mit Zärtlichkeit betreuen. Auf Cäcilie fand ich die schönen Reime Familie und Lilie, die vortrefflich zu dem Inhalt des Gedichtes passten.
Ich liebte Cäcilie. Wie eine huldreiche, sanfte Märchenprinzessin war sie aus ihrer Höhe zu mir herabgestiegen, hatte mir die Hand gereicht und weinend gesagt, ich sei eine treue Seele! Das war eine so merkwürdige, so rührend poetische Begebenheit, wie sie sonst nur in Märchen und Geschichten vorkam, und darum bildete ich mir ein, dass ich zu Helden eines beginnenden Liebesromans erkoren sei. In meinem Jubelrausche gewann ich die Überzeugung, dass noch kein irdisches Herz so glühend, so unwandelbar treu geliebt habe, wie das meine.
Das war eine tiefe, große, keusche Liebe. Doch sie währte nur eine halbe Stunde.
Als diese gnadenreiche Zeit verronnen war, kam die Königin meines Herzens abermals in die Werkstatt. Freudig trat ich ihr entgegen und erhob die Hand zum Empfange; doch ließ ich schnell die Hand sinken, da meine heiße Freude einen jähen Tod fand. Cäcilie blieb in der offenen Tür stehen und rief kurz und grob: „Hier wird itze geschlossen!“
Sie war wieder die kalte, herrliche Person, die uns Lehrjungen das Lebe sauer gemacht hatte. Der plötzliche Stimmungsschlag in meiner Seele brachte mich in Zorn und ich fragte gereizt und gekränkt: „Halten Sie mich für einen Spitzbuben?“
„Sei nicht so frech Lausigel!“ schrie sie. „Wenn die andern fort sein, brauchen wir Dich erst recht nicht!“
„Ich bin hier in der Lehre, und ich habe noch nicht ausgelernt!“ entgegnete ich keck. „Vorhin erst haben Sie mich gebeten, dass ich hier bleiben soll!“
„Ich verreise itze!“ sagte sie schroff. „In zehn Minuten wird alles abgeschlossen, und wenn Du noch drin bist, lass ich Dich rausschmeißen!“
Sie schlug die Tür heftig zu und ging nach ihrer Wohnung. In rasender Wut riss ich die Tür auf und schrie Cäcilie ein gemeines Schimpfwort nach. Die Wagenbauer wunderten sich über meine Kühnheit und lachten. Zu ihnen gewendet, erklärte ich laut und noch immer von Wut geschüttet, dass Cäcilie das ordinärste Frauenzimmer und die schlechteste Person sei. Ich sprang auf den Boden, packte geschwind meine kleine Habe zusammen, mit Ausnahme der Betten, die meiner Mutter gehörten, und verließ mit Bündel und Stock das Werkstattgebäude. Im Hofe schoss Cäciliens Mutter auf mich los, schlug mich mit der Faust auf den Kopf und in den Nacken, so dass mir die Mütze in den Schnee fiel, und schalt mich unter gröblichen Schimpfreden wegen der Beleidigung ihrer Tochter. Als ich zur Abwehr den Stock erhob, spie sie mich an und entfloh.
Nach wenigen Minuten lag das Stadttor hinter mir, und ich wanderte dem fernen Tale meiner Heimat zu… Meine große Liebe war erloschen. Für Cäcilie blieb mir nur Verachtung. Dennoch übermannte mich die Scham, wenn ich mir die bösen Auftritte vergegenwärtigte, die sich beim Abschied ereignet hatten. Ich hätte das schändliche Wort nicht sprechen sollen. Eine Stimme in mir belehrte mich immerzu, dass nur gemeine Menschen sich solcher gemeinen Worte bedienen. Als ich mir dann noch den bitteren Vorwurf machte, dass ich Cäcilie in Gegenwart ihrer Mutter auf das ärgste in der Ehre gekränkt hatte, schlug ich mich in Reue und Selbstverachtung an die Stirn.
Spät abends trat ich in das Stübchen meiner Mutter. Sie kniete am Bett und betete den Rosenkranz. Erschrocken stand sie auf.
„Junge, wu kimmst Du den har?“
„Aus der Stadt.“
„Du bist doch nich ernt ’m Meister ausgerückt?“
„Nee, Mutter! Der Meister ist uns ausgerückt.“