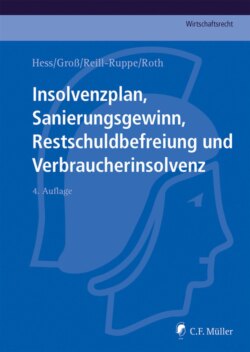Читать книгу Insolvenzplan, Sanierungsgewinn, Restschuldbefreiung und Verbraucherinsolvenz - Paul Groß - Страница 22
III. Konkrete Ziele des Insolvenzverfahrens
Оглавление38
Als Ziel des Insolvenzverfahrens wird in § 1 InsO neben der Gläubigerbefriedigung die Erhaltung von Unternehmen durch einen Insolvenzplan hervorgehoben. Wörtlich heißt es:
„Das Insolvenzverfahren dient dazu, die Gläubiger eines Schuldners gemeinschaftlich zu befriedigen, indem das Vermögen des Schuldners verwertet und der Erlös verteilt oder in einem Insolvenzplan eine abweichende Regelung insbesondere zum Erhalt des Unternehmens getroffen wird. Dem redlichen Schuldner wird Gelegenheit gegeben, sich von seinen restlichen Verbindlichkeiten zu befreien.“
39
Das Insolvenzverfahren fasst wesentliche Elemente des früheren Vergleichs- und Konkursverfahrens zusammen. Es enthält damit unterschiedliche Gestaltungsmöglichkeiten für die Rechtsbeziehungen zwischen Schuldner und Gläubigern. Insbesondere kann im Verfahren die Fortführung der unternehmerischen Tätigkeit des Schuldners, aber auch die Liquidation des Vermögens des Schuldners angestrebt werden. Das Verfahren kann nach den gesetzlichen Vorschriften über die Verwaltung, Verwertung und Verteilung der Insolvenzmasse abgewickelt werden; es kann aber auch durch eine Übereinkunft der Beteiligten (,,Insolvenzplan“) abweichend von den gesetzlichen Vorschriften beendet werden. Dennoch liegt dem Verfahren ein einheitliches Hauptziel zugrunde: die bestmögliche Befriedigung der Gläubiger. Dieses Ziel ist in erster Linie maßgeblich für die Entscheidungen, die innerhalb des Verfahrens zu treffen sind. Das Insolvenzrecht dient der Verwirklichung der Vermögenshaftung in Fällen, in denen der Schuldner zur vollen Befriedigung aller Gläubiger nicht mehr in der Lage ist. Insofern ergänzt es das Recht der Einzelvollstreckung, das im Achten Buch der ZPO geregelt ist.
40
Das Ziel der gemeinschaftlichen Befriedigung der Gläubiger wird zu Beginn des Gesetzes in § 1 InsO hervorgehoben, da es das gesamte Insolvenzverfahren prägt. Aus ihm folgt insbesondere der starke Einfluss, der den Gläubigern auf den Beginn, den Ablauf und die Beendigung des Verfahrens eingeräumt wird. Aber auch die Tätigkeit des Insolvenzverwalters und die Aufsichts- und Eingriffsbefugnisse des Gerichts sind in erster Linie an diesem Ziel auszurichten. Zusätzlich wird in § 1 InsO zum Ausdruck gebracht, dass die Befriedigung der Gläubiger regelmäßig im Wege der Verwertung dieses Vermögens und der Verteilung des Erlöses erfolgt.
41
In§ 1 InsO wird zunächst betont, dass trotz der Ausrichtung des Insolvenzverfahrens an der bestmöglichen Befriedigung der Gläubiger die Interessen des Schuldners, der eine natürliche Person ist, und seiner Familie nicht vernachlässigt werden. Im Grundsatz wird nur das pfändbare Vermögen des Schuldners vom Insolvenzverfahren erfasst. Ein Schuldner, der keine pfändungsfreien Einkünfte hat, erhält für sich und seine Familie Unterhalt aus der Insolvenzmasse. Auch die Interessen der Arbeitnehmer des Schuldners werden umfassend berücksichtigt: Die Arbeitnehmer behalten im Insolvenzverfahren grundsätzlich ihre Rechte nach dem KSchG, nach § 613a BGB und nach dem BetrVG; insbesondere über den Betriebsrat können sie ihr Interesse an der Erhaltung der Arbeitsplätze zur Geltung bringen. Die genannten Rechte der Arbeitnehmer werden allerdings verfahrensmäßigen Beschränkungen unterworfen, damit das Insolvenzverfahren zügig und wirtschaftlich effektiv durchgeführt werden kann.
42
Das Verfahren bietet weiter dem Schuldner, der eine natürliche Person ist, die Möglichkeit, sich von der Haftung auch für solche Verbindlichkeiten zu befreien, die aus seinem vorhandenen Vermögen nicht erfüllt werden können (§ 1 InsO).
43
Diese Schuldbefreiung kann durch einen von den Beteiligten gebilligten Plan erfolgen. Unter besonderen Voraussetzungen kann ein redlicher Schuldner auch ohne eine solche Übereinkunft Restschuldbefreiung erlangen.
44
Bei Gesellschaften und juristischen Personen dient das Verfahren auch der gesellschafts- oder organisationsrechtlichen Abwicklung, wobei ggf. ein Restvermögen unter den am Schuldner beteiligten Personen verteilt wird (§ 1 InsO).
45
In § 1 InsO wird die Gestaltungsfreiheit der Beteiligten hervorgehoben. Die Gläubiger, der Schuldner und, wenn dieser keine natürliche Person ist, die als Kapitalgeber am Schuldner beteiligten Personen können die Vermögensrechte, die Gegenstand des Insolvenzverfahrens sind, in einem „Insolvenzplan“ abweichend von den Gesetzesvorschriften regeln; dabei sind allerdings die zwingenden Verfahrensvorschriften zu beachten. Insbesondere ist es möglich, auf eine Verwertung des Schuldnervermögens zu verzichten und die Befriedigung der Gläubiger in anderer Weise zu regeln oder die Befreiung des Schuldners von seinen Verbindlichkeiten an abweichende Voraussetzungen zu knüpfen; auch können die vermögensrechtlichen Verhältnisse des Schuldners und der an ihm beteiligten Personen neu geordnet werden. Für einen solchen Plan gelten die Vorschriften des Sechsten Teils der InsO, die Mehrheitsentscheidungen zulassen, ohne einen angemessenen Minderheitenschutz zu vernachlässigen.
46
Die Erhaltung von Unternehmen oder Betrieben ist kein eigenständiges Ziel des Insolvenzverfahrens. Das Verfahren bietet den Beteiligten aber einen rechtlichen Rahmen, in dem die Verhandlungen über die Fortführung oder die Stilllegung eines insolventen Unternehmens nach marktwirtschaftlichen Grundsätzen stattfinden können. Mit der Eröffnung des Verfahrens ist noch keine Vorentscheidung in Richtung auf eine Liquidation des Unternehmens getroffen. Ist die Fortführung des Unternehmens durch den Schuldner die für die Gläubiger günstigste Lösung, so werden sie bereit sein, einem entsprechenden Fortführungsplan zuzustimmen (vgl. § 1 InsO).