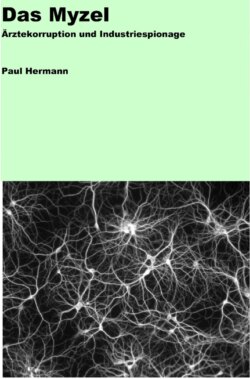Читать книгу Das Myzel - Paul Hartmann Hermann - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
13. Neue Arbeit, Autostadt im Herbst/Winter 2006
ОглавлениеDer Anwalt hatte Vorankündigungen gemacht. Er habe das Literaturarchiv des ermordeten Professor Grosser besichtigt. „Mehrmals 360 Grad“, hatte er gesagt und das mehrfach wiederholt. K. war zunächst nicht klar gewesen, was das zu bedeuten hatte. Als er dann von ca. 100 Metern Aktenordnern sprach, dämmerte es K. Er hatte die Rundumaufstellung von Regalen, voll mit Aktenordnern, in mehreren großen Räumen an allen vier Wänden gemeint. Diesen Fundus hatte der Anwalt den Erben des toten Wissenschaftlers für eine stattliche sechsstellige Eurosumme abgekauft.
Sie fuhren mit dem Kübelwagen des Anwalts direkt zum etwas abseits gelegenen Archiv. Es befand sich in einer schmucklosen mehrstöckigen Halle, weit weg von aller Geschäftigkeit des Industriekomplexes, der tagtäglich tausende von Autos ausspuckte. Vor dem Eingang zu dem schmucklosen Gebäude hielt der Anwalt. Sie stiegen aus und mussten eine schwere Eisentüre öffnen, um hinein zu kommen. Eine weitere Türe führte in das düstere und speckige Büro des Archivars. Die Einrichtung war herunter gekommen und reif für die Entrümpelung. Der Mann musterte K. neugierig und gleichzeitig misstrauisch. Hierher verirrten sich nur ganz gelegentlich Besucher.
Bockhold stellte K. vor. Bevor er ging, zog er den Archivar zur Seite. K. bekam mit, wie er ihm zuraunte, dass er ein Auge auf K. haben solle. Aus dem Literaturfundus dürfe kein einziges Blatt mit nach draußen genommen werden.
Das hätte er mir auch direkt sagen können, dachte sich K.
Der Archivar war ein sportlicher Endfünfziger. Er schenkte miesen Kaffee in eine abgeschlagene Besuchertasse ein. K. schaute sich um. Der Raum, in dem sie saßen war durch verdreckte Glasscheiben von der Lagerhalle abgetrennt.
Auf dem Weg zum Fundus liefen sie minutenlang durch die engen Gänge zwischen den Regalen, die kein Ende fanden. Hunderttausende von Papierdokumenten sogen die Luftfeuchtigkeit auf und produzierten eine staubtrockene Atmosphäre. Hier war die Zeit angehalten worden, ganz anders als in den Präsentationsräumen der Autofirma nur ein paar Ecken weiter, in denen die automobile Zukunft zu besichtigen war.
Sie erklommen den ersten Stock der Archivhalle über eine Stahlleiter. Während der ebenerdige Boden aus einem Betonestrich bestand, war das obere Geschoss eine Metallkonstruktion, deren Lauffläche aus Gitterrosten zusammengesetzt war. Klack, klack, hörte man die Schritte. Die metallischen Schwingungen wurden durch das tonnenweise angehäufte Papier nur teilweise gedämpft und waren deshalb weit zu hören.
Inzwischen hatten sie den Ort erreicht, wo die Literatursammlung Grossers eingelagert worden war. Der Umfang der Sammlung erschloss sich erst dann vollständig, wenn man sich zwischen die vollen Stahlregale begab. Die Enge des Ganges mit hunderten von Aktenordnern zu beiden Seiten erzeugte Beklemmung. K. beschlich ein eigenartiges Gefühl, eine Mischung aus Ehrfurcht und Neugier. Was musste das für eine Mühe gemacht haben, das alles eigenhändig zusammenzutragen? Allein der Zeitaufwand für das Lochen der hunderttausenden von Seiten!
Doch was hatte der Privatgelehrte Grosser denn da so exzessiv gesammelt? Bei einer ersten groben Durchsicht stellte K. fest, dass es offensichtlich ein Großteil der Weltliteratur zur Fasertoxikologie war. Zwei Jahrzehnte zurückliegend war rund um den Globus eine hitzige Diskussion um die Krebsgefährdung künstlicher mineralischer Fasern entbrannt. Den Gesundheitspolitikern, den Präventivmedizinern und den Inhalationstoxikologen steckte noch immer das Desaster der asbestbedingten Lungenfibrosen und Krebserkrankungen in den Gliedern. So etwas durfte sich auf keinen Fall wiederholen. Besonders in Deutschland wurde heftig und intensiv über die Gesundheitsgefährdungen durch sogenannte Man Made Fibers debattiert, weil hier große Produzenten für Isoliermaterialien und andere Faserprodukte ansässig waren. Grosser war damals als Consultant für die Faserindustrie tätig gewesen. Er war einer der wenigen Spezialisten, der die gesamte Pathologie und Toxikologie zu diesem Thema überblickte.
Grosser hatte binnen kurzer Zeit überdurchschnittlich viele wissenschaftliche Papers zur Fasertoxikologie veröffentlicht. Diese Beiträge waren geprägt durch formale Korrektheit. So konnte man sich mit absoluter Sicherheit darauf verlassen, dass die Literaturzitate in seinen Publikationen auch genau das reflektierten, was in der zitierten Originalarbeit stand. Dieses Qualitätsmerkmal wird in vielen wissenschaftlichen Elaboraten nicht erfüllt. Viele Autoren interpretieren die publizierten Ergebnissen ihrer Kollegen recht großzügig. Im Vordergrund steht eine positive oder negative Erwünschtheit, die man natürlich gerne von außen bestätigt haben möchte. Besonders gerne werden große Namen als Kronzeugen genannt. Bei genauerem Hinsehen haben die dann aber etwas ganz anderes herausgefunden und behauptet, als es der zitierende Autor vorgegeben hatte. Nicht so bei Grosser. In seinem Streben nach inhaltlicher Korrektheit und allumfassender Abhandlung des Themas gerieten ihm die Texte allerdings meist etwas dröge und sperrig. Es war so, als wenn er Worte in Formeln überführte und nicht umgekehrt. Hier machten sich wohl die mechanistischen Denkreflexe aus der jahrzehntelangen Ingenieursausbildung bemerkbar.
Zu dieser Zeit – man lebte in den 1980-er Jahren - führte Grosser einen militanten Dialog mit einem Inhalationstoxikologen namens Professor Ott. Beide fochten mit verschiedenen Waffen. Grosser setzte vor dem Hintergrund seines immensen Literaturfundus seinen brillanten analytischen Verstand ein. Der Toxikologe hingegen arbeitete mit einer Vielzahl von Tierversuchen, verbrauchte dabei Unmengen weißer Ratten und stellte dem literaturbasierten Wissen Grossers seine beträchtliche empirische tierexperimentelle Erfahrung entgegen. So konnten die beiden natürlich nicht auf eine gemeinsame Linie kommen.
Der Toxikologe favorisierte einen speziellen Test, bei dem den Tieren eine Faseremulsion direkt in die Bauchhöhle gespritzt wurde. Dann beobachtete man, welche und wie viele Tumore sich bei den Tieren entwickelten. Hier nun setzte die Hauptkritik Grossers an. Erstens sei die Bauchhöhle nicht der Ort, an welchem eingeatmete Fasern wirksam werden könnten, zweitens würden die applizierten Fasermengen nicht den natürlicherweise einwirkenden Fasermengen entsprechen und schließlich, drittens, würden die beobachteten Tumorraten bei den Ratten durch die auch ohne Schadstoffeinwirkung auftretenden Spontantumoren, für welche die eingesetzte Rattenart besonders empfänglich war, überschätzt werden.
Das Dilemma der Inhalationstoxikologen war bei diesem Thema immanent. Normale Inhalationsversuche mit Ratten funktionierten nicht, weil damit nicht genügend Fasermengen in die Tierlungen gelangten, um ausreichend viele Tumoren zu induzieren. Außerdem handelte es sich bei den vermuteten Faserwirkungen an den Lungen um Langzeiteffekte. Um in kurzer Zeit möglichst viele Lungentumoren zu erhalten, mussten hohe Faserkonzentrationen verabreicht werden, weil die Tiere eine kurze Lebenszeit hatten.
Diese Auseinandersetzung zog sich in der wissenschaftlichen Literatur und auf zahlreichen Kongressen und Symposien jahrelang hin. Alle waren von der Angst getrieben, mit den künstlichen mineralischen Fasern nicht wieder ein solches Desaster, wie mit dem Asbest zu erleben. Außerdem ging es für die Dämmstoffindustrie, den größten Produzenten künstlicher mineralischer Fasern, um die schiere Existenz. Dabei wurde nicht nur mit Sachargumenten, sondern auch mit handfesten Diffamierungen gearbeitet.
Grosser war ein bestimmtes Stigma eigen, welches in der sozial- und umweltbewegten späteren deutschen Nachkriegslandschaft ein Killerargument darstellte: Er galt als Industrieberater. Deswegen wurden ihm seine Publikationen als Verharmlosung einer vermeintlichen drohenden Apokalypse ausgelegt. Ein anderer wäre an diesen Anfeindungen zerbrochen oder hätte sich resigniert zurückgezogen. Nicht so Grosser. Er ließ sich nicht unterkriegen, ja er wurde durch die verbalen Attacken sogar noch stimuliert. Das war wohl für den Major der Reserve ein gewisser Ersatz für in Friedenszeiten fehlende Kampfhandlungen.
Und dann kam jedoch eine Verquickung zutage, welche den Nimbus des Gegenspielers und Gutmenschen Ott und all seiner Epigonen arg in Mitleidenschaft zog. Es hatte sich immer deutlicher gezeigt, dass das übergeordnete Krebs erzeugende Prinzip aller Fasern deren Haltbarkeit im biologischen Material darstellte. Somit machte es Sinn, künstliche mineralische Fasern seitens ihrer kristallinen Eigenschaften zu komponieren, dass sie sich möglichst schnell bei der Einwirkung von Körperflüssigkeiten auflösten. Nun fiel auf, dass eine bestimmte Faser in den Ott`schen Tierversuchen immer wieder als die harmloseste identifiziert wurde. Tatsächlich wies diese Faserart eines großen deutschen Chemieunternehmens auch immer die vergleichsweise niedrigste Biobeständigkeit auf. Beim genaueren Blick in die Unterlagen des Patentamtes zeigte sich, dass der berühmte Inhalationstoxikologe Professor Ott ein Patent zur Herstellung dieser Faserart hielt. Seine Versuchsergebnisse waren also Teil einer weltweiten Marketingstrategie für die von ihm kreierte Faser, was sich in Form von Lizenzgebühren äußerst wohltuend auf seinem privaten Konto niederschlug.
Als diese Verquickungen ruchbar wurden, wurde es merklich ruhiger an der Faserfront. Es wurde der Rückzug der Faserskeptiker eingeläutet. Es waren Myriaden von Tieren verbraucht worden, zig Millionen von Forschungsgeldern hatte das gekostet. Ganze Institute hatten prächtig davon gelebt, zahlreiche Doktoranden hatten Dissertationsthemen gefunden und mannigfaltige Kongresse waren zu diesem Thema ausgerichtet worden. Und was blieb? Bis Anfang der 1990er hatten sich die Wogen in der wissenschaftlichen Diskussion um die künstlichen mineralischen Fasern geglättet. Es stellte sich heraus, dass nur wenigen speziellen künstlichen Faserarten ein mildes Krebspotential zugeschrieben werden konnte. Die meisten anderen Faserspezialitäten waren weitgehend harmlos. Die schnell auflösenden Fasern begannen ihren Siegeszug, und wir ärgern uns nach wie vor, wenn es uns nach Kontakt mit den Fasern an den unbedeckten Hautstellen juckt.
Einmal in das komplexe Thema der Fasertoxikologie eingearbeitet, dauerte es nicht lange, bis auf Grosser neue Beratungsaufgaben zukamen. K. erkannte in den zahlreichen Konzeptpapieren aus der Hand Grossers eine große Begabung. Diese bestand darin, dass er es trefflich verstand, durch geringfügige Perspektivwechsel, alten bereits abgearbeiteten Themen einen neuen Anstrich zu verpassen, was das Interesse der neuen Auftraggeber auf sich zog. Dieses erneute Anfixen gelang ihm auch deshalb so gut, weil er es Kraft seiner Ausbildung immer wieder erreichte, die technische und die medizinische Sichtweise zusammenführen und damit neue Aspekte zur Fasertoxikologie gewann. Wer sich mit Fasern technisch und medizinisch auseinandersetzte, kam natürlich an den Asbestfasern nicht vorbei. Und so enthielt der Fundus Grossers auch eine umfangreiche Literatursammlung zum Thema Asbest. Auf die war Bockhold besonders scharf. In den Prozessen wegen asbestbedingter Erkrankungen in den USA machte es sich immer gut, wenn man als Anwalt einen hohen Literaturstapel neben sich liegen hatte. Pflichtbewusste Rechtsvertreter hatten die Publikationen auch gelesen, doch sie waren nicht immer auch die besseren Anwälte. Andere taten nur so, als wenn sie wüssten, was da so geschrieben stand und überspielten ihr lückenhaftes Wissen mit Showelementen. Das waren dann meist die Staranwälte auf der Klägerseite.
Die beste Sammlung ist jedoch wenig wert, wenn man nicht weiß, was wo steht. Deshalb war es nun die Aufgabe K.s, zunächst einmal die Asbestliteratur zu extrahieren. Danach war geplant, dass er jede einzelne Publikation durchmustern und die darin vorkommenden Stichworte in das System einer IT-gestützten Literaturdatensammlung einbringen sollte. Weiterhin würde es dann seine Aufgabe sein – und das konnte nur einer wie er mit einer umfassenden Erfahrung in der Auswertung und Beurteilung wissenschaftlicher Studien – die Arbeiten zu klassifizieren und die Studienergebnisse dahingehend zu überprüfen, ob vorher formulierte Kernhypothesen zu bestätigen oder zu widerlegen waren.
Die nun vor ihm liegende Kärrnerarbeit war wahrlich nicht die geradlinige Fortsetzung seiner bisherigen beruflichen Karriere, aber sein Selbstmitleid wich allmählich einem anschwellenden Jagdfieber. Was hatte Grosser da so alles zusammen getragen und ausgewertet? Was für zusätzliche Informationen würden in diesem Mammut-Thesaurus stecken? Welche neuen Argumentationen könnte er in die Verteidigungsstrategien der Anwälte einbauen? Ähnliche Neugier dürfte Archäologen auf der Suche nach den ägyptischen Königsgräbern befallen haben.
K. erinnerte sich an seine früheren Forschungs- und Publikationstätigkeiten im Institut von Professor Litwin und später auch in eigener Regie. „Drei Tage in der Bibliothek ersparen ihnen drei Monate Forschen“, war einer der Leitsprüche Litwins gewesen. Damals war die Literaturbeschaffung noch mühselig. Man musste viele wissenschaftliche Journale lesen, kopierte dann die wichtigen Artikel oder schrieb die Autoren an und bat um die Übersendung von Sonderdrucken. Internet und elektronische Literaturdatenbanken gab es damals noch nicht. Die wissenschaftliche Information wurde postalisch übermittelt. Zwischen Anforderung und Lieferung konnten Monate liegen. Es wurden studentische Hilfskräfte losgeschickt, um das Sammeln und Auswerten der wissenschaftlichen Ergebnisse zu erledigen. Nicht die voll gefütterte Festplatte, sondern der mit Publikationen bestückte Leitz-Ordner und der Zettelkasten waren die Herrschaftsinstrumente.
Der Lohn für die mühsame Arbeit war immateriell. Häufig war es der Doktortitel. K. tat jetzt nichts anderes, als das, was viele Jahre zurück seine Doktoranden gemacht hatten. Der kleine, aber wesentliche Unterschied bestand darin, dass er zu den Tagessätzen eines wissenschaftlichen Beraters und nicht wie die Studenten umsonst arbeitete. Das respektable Salär sah K. überwiegend als Schmerzensgeld an. Sicherlich war es ein Almosen im Vergleich zu den Beträgen, die der Anwalt kassierte. Für K. war es aber nach seinem beruflichen Crash gutes Geld. Und er konnte hier unbeobachtet arbeiten. Keiner wusste, wo er war - meinte er.
Da war er nun also gelandet, jenseits einer applaudierenden Öffentlichkeit, befasst mit einer mühsamen kleinteiligen Kopfarbeit, deren Erfolg nicht er, sondern andere ernten würden. Er kam sich vor wie der Bergwerksdirektor, der sich auf einmal ohnmächtig allein unter Tage wieder findet und den Flözen nur mit Hammer und Pickel bewaffnet an den Leib zu gehen hat.
Bei der ersten groben Durchsicht der Akten erkannte K. recht schnell, dass Grosser chaotisch gesammelt hatte. Die Themen wechselten in der Reihenfolge der Ordner, aber auch innerhalb der Ordner. Viele Schriftstücke erschienen doppelt. Es hatte den Anschein, als wenn der Sammler teilweise den Überblick über seinen eigenen Bestand verloren hatte, was bei diesem Umfang nicht verwunderlich war.
K. empfand von Tag zu Tag immer etwas mehr heimelige Gefühle in der kargen Umgebung. Es traten nostalgische Stimmungen auf, wenn die Sonnenstrahlen über die trüben Oberlichter in unterschiedlichen Winkeln zwischen die Regale hereinbrachen und im Papierstaub wandernde Lichttrapeze formten. Das hatte etwas Museales. Das alte Institut, die früheren Kollegen und der Übervater Litwin lebten in K.s Erinnerungen wieder auf.
Während er ein dickes Lehrbuch über Mineralogie durchblätterte, fiel ein Bild heraus, welches offensichtlich als Lesezeichen fungiert hatte. Er bückte sich und hob es auf. Es zeigte vier Personen vor dem Eingang eines dunklen Holzhauses. Hinter dem Haus lag dichter Wald. Über der Türe sah man ein großes Hirschgeweih. Es musste Grossers Jagdhaus in der Oberpfalz sein. In die Kamera lächelten rechts außen das stolze Familienoberhaupt und links außen seine indonesische Frau. Aus Java stammte sie, so erinnerte sich K. Zwischen Vater und Mutter standen die beiden Buben, der eine war einen halben Kopf größer als der andere. Beide hatten Lederhosen an.
Er drehte das Bild um, er wollte nachschauen, ob ein Herstellungsdatum auf der Rückseite vorhanden war. 13.08.2003 las er. Aber es stand noch etwas anderes da. Dabei handelte es sich um eine Internetadresse der Firma Delphi mit einem ewig langen Suffix, einer Identifikationsnummer und mehrere Buchstaben-Zahlen-Kombinationen, welche offensichtlich Codes darstellten.
K. hielt den Schlüssel zum größten Geheimnis der westlichen Welt in den Händen und wusste nichts davon.
Er steckte das Bild in seine Jackentasche, als Erinnerung an den verstorbenen Kollegen.
So wie die Familie sich auf dem Bild präsentierte, so waren tausende Familien auf Bildern verewigt worden. Die Abgründe hinter dem Familienglück blieben unsichtbar. Beide Söhne lachten. Der kleinere hatte sich eng an seine Mutter gedrückt. Was musste da passiert sein, dass so einer zur Waffe greift und die Eltern mir nichts dir nichts abknallt? Okay, Grosser taugte nicht als Vater zum lieb haben, sondern eher als Vorbild für einen zielgerichteten, schnörkellosen, und relativ freudlosen Lebensentwurf. Er war Reserveoffizier gewesen, einer der furchtlos stets voran marschiert war. Seine Schultern hatte er immer zurückgezogen, so dass sich sein Brustkorb kräftig nach vorne wölbte. Hindernisse gab es für so einen nicht. Selbst wenn sich vor ihm eine Betonwand aufgebaut hätte, dann wäre er mit seiner eisenhart angespannten Brustmuskulatur durch die Mauer hindurch marschiert. Diese Spannung übertrug sich auch auf seinen Arbeitsstil und die Gestaltung des Privaten, welches bei ihm fließend ins Geschäftliche überging.