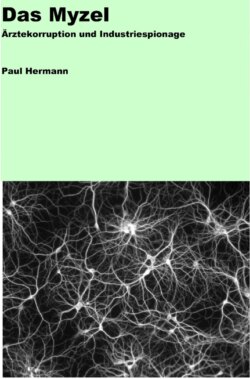Читать книгу Das Myzel - Paul Hartmann Hermann - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
7. Rückkehr
ОглавлениеEs waren jetzt über vier Monate vergangen. Die Versuchung war groß, alles hinter sich zu lassen und irgendwo anders neu anzufangen. Nicht, dass er ein großes Verlangen nach der Heimat verspürt hätte, aber da waren sicherlich einige Dinge aufgelaufen, die bearbeitet werden mussten. Wahrscheinlich lag da auch ein großer Haufen Rechnungen. Es war an der Zeit, sich nach neuen Erwerbsquellen umzuschauen. Hier im Süden Spaniens hatte allerdings keiner auf so einen wie K. gewartet. Seine Ängste hinsichtlich einer Wiederholung eines Anschlags auf ihn waren durch den unbeschwerten Alltag der letzten Monate verdrängt worden. Das erleichterte den Entschluss zur Rückkehr.
Zu Hause angekommen, sah es aus, wie erwartet. Hinter der Wohnungstür unter dem Briefkastenschlitz befand sich ein riesiger ungefähr einen halben Meter hoher Haufen Papier, bestehend aus Werbung, Briefen und Tageszeitungen. Er hatte es vor seiner überstürzten Abreise versäumt, die FAZ abzubestellen. Der Blick in den Kühlschrank war grauenvoll. Sein Inneres war von einem grüngrauen Pilzrasen überwuchert. Das Gerät war nicht mehr zu retten.
Um etwas Struktur in die Wildnis zu bekommen, mistete er zunächst die Post aus. Dazu bildete er drei Unterhaufen: sofort wegschmeißen, muss bearbeitet werden, aber kann warten und dringend zu erledigen. Der Haufen dringend zu erledigen war klein aber mit überwiegend schmerzlichem Inhalt. Die zu begleichenden Rechnungen und Mahnungen addierten sich zu einem fünfstelligen Eurobetrag. Das würde eine weitere tiefe Lücke in sein schmelzendes Budget reißen.
Einen Tag später ging er an den mittleren Haufen heran. Er öffnete einen Brief, welcher vom Studiendekan gekommen war. Er sei als assoziiertes Mitglied der Medizinischen Fakultät verpflichtet, regelmäßig Vorlesungen zu halten. So sehe das die Habilitationsordnung vor. Andernfalls könne ihm der Titel außerplanmäßiger Professor aberkannt werden. Wegen der angespannten Haushaltslage wäre man nicht in der Lage, Vorlesungsgeld wie bisher zu bezahlen und die Fahrtkosten zu übernehmen.
Fuck you, dachte er sich, hier sollte sein geistiges Eigentum zum Nulltarif angezapft werden. Und außerdem: Während er die Hauptvorlesung hielt, konnte sein lieber Kollege, welcher unkündbar verbeamtet auf einem Lehrstuhl saß, in aller Ruhe seiner Gutachtertätigkeit nachgehen, welche ihm neben seiner üppigen C 4-Besoldung auch noch schöne Nebeneinkünfte einbrachte. Ein krankes System.
Die Zeiten, in denen er den Professorentitel zur Aufpolsterung seines Egos gebraucht hatte, waren schon lange vorbei. Unter dem Strich hatte der Titel mehr Nachteile als Vorteile gebracht. Während seiner Zeit als aufstrebender Manager war er häufig als Exot betrachtet worden. Etliche Vorgesetzte hatten Probleme mit dem jungen Professor als Mitarbeiter. Das ganz bewusste Weglassen jeglicher Titel bei seiner Anrede war entlarvend für Neid und Missgunst. Umgekehrt tat er dann so, als wenn der Titel nicht vorhanden wäre. Aber gerade dieses Understatement führte bei den beißenden Vorgesetzten nicht zur wohlmeinenden Entlastungsreaktion. Im Gegenteil, jetzt hat er so früh den Titel bekommen und steht noch nicht einmal dazu, der Mann ist überheblich und arrogant, war dann die Einschätzung.
Doch das alles war Vergangenheit. Trotzdem war er noch nicht so weit, dass er völlig auf den Titel hätte pfeifen können. Er hatte keine Ahnung, was noch kommen würde. Jedenfalls war er meilenweit davon entfernt, die Beine hochlegen zu können. Er musste noch mindestens zehn Jahre Geld verdienen. Also würde er wieder Vorlesungen halten. Allerdings würde er ein Thema für seine Vorlesung ankündigen, was außerhalb des Stoffkatalogs für die Ärztliche Prüfung lag. Das würde auf absolutes Desinteresse bei den Studenten stoßen, so dass keiner käme und er die Veranstaltung absetzen könnte.
Und außerdem war da auch noch das Manuskript. K. hielt es aber erst einmal unter Verschluss. Immer, wenn er gelegentlich mal wieder in die Seiten hineingeschaut hatte, fand er nicht nur Rechtschreibfehler, sondern auch nicht hinnehmbare Unzulänglichkeiten und Patzer. Ganze Kapitel kamen ihm stümperhaft oder pomadig geschrieben vor. Für den unbedarften Leser fehlten mehrfach die verbindenden Sentenzen. Das was er vor ein paar Wochen noch als ganz witzig empfunden hatte, war ihm jetzt nur noch peinlich. Das war nicht publikumstauglich, es war ein dilettantischer Erstling. Das war das Niveau von Seidenmalerei und Makrameebasteln in der Volkshochschule.
Auf Drängen eines guten und neugierigen Freundes, der hinsichtlich der neueren deutschen Literatur äußerst belesen war, überließ er diesem das Manuskript. Der hatte es innerhalb von zwei Tagen durchgelesen und fand es exzellent, was Plot, Dramaturgie und Sprache anbelangte. K. schwebte und bat kühn einen weiteren Freund, einen Verleger, um Durchsicht und konstruktive Kritik. Bereits in dem Moment, als die Postsendung seine Finger verlassen hatte und in den Schlitz des Briefkastens geglitten war, wünschte er sich, dass dies nicht geschehen sein möge. Sein Freund war der Prototyp eines so genannten wertkonservativen Großbürgers, dessen Welt in K.s Erstlingswerk permanent angepisst wurde.
Tatsächlich rief ihn dieser Freund noch am Tag des Manuskripteingangs an. Er sagte, dass er es nach drei Seiten Lesen zur Seite gelegt habe. Dieses präpotente Geschreibsel wolle er sich nicht weiter antun. Außerdem würden in dem Machwerk mindestens fünf Beleidigungsklagen stecken. Im Falle einer Veröffentlichung fürchte er um K.s bürgerliche Existenz. Anzuerkennen sei, dass sich K. selber nicht als unbefleckten Held dargestellt habe, wenngleich die Art, wie er sein Licht unter den Scheffel stelle, gleichwohl auch einer Anbiederung gleich käme. Die autobiographischen Schilderungen würden deutlich machen, dass er sich selber in einige dumme, nicht unbedingt nötige Sachen reingeritten habe. Hoffentlich schaufele er sich mit diesem Roman jetzt nicht noch ein zweites Grab.
K. entgegnete, dass er nur vom Leben abgeschrieben habe. Alles was man zu Papier bringe sei autobiographisch, selbst Fantasiegebilde, denn auch die Fantasie speise sich aus dem Erlebten und Gelesenen. Außerdem seien die Figuren und Handlungen im Roman von ihm derartig verfremdet oder neu erfunden worden, dass eine Identifizierung kaum möglich sei.
K. verwies dann auf einen im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung erschienenen Artikel mit dem Titel „Am Tellerrand gescheitert – Warum die Gegenwartsliteratur die Gegenwart meidet“. Autor war ein Richard Kämmerlings. Aufhänger war die Finanzaffäre von Jérôme Kerviel, welcher seinem Arbeitgeber, der französischen Großbank Société Générale, ein Rekorddefizit von annähernd fünf Milliarden Euro einfach so herbeispekuliert hatte. Der Mann wurde gefeuert und die ehemals so stolze Bank wurde zum Übernahmekandidaten und jeder rätselte, wie so etwas passieren konnte. Das sei Stoff für einen Epochenroman, so meinte Kämmerlings und stellte gleichzeitig die Frage, warum sich solche Figuren so wenig in der deutschen Gegenwartsliteratur fänden. Die Ursache sei, so sein Resümee, dass sich die Autoren in der Retrospektive tummeln würden. Der historische Familien- oder Generationenroman, gern als episches Jahrhundertpanorama definiert, beherrsche die Szene. Es mangele an dem, was unser Leben jenseits des Privaten formt und bestimmt: die Wirtschaft, die Technik, die Medizin, das Militär, ja selbst die Medien.
„Und ich will mit meinem Opus diese Lücke füllen“, sagte er seinem Freund, dem Verleger, der sich aber auch durch diese Argumentation nicht überzeugen lassen wollte und ab diesem Zeitpunkt Kontakte mit K. mied. Zu groß erschien ihm die Gefahr, als Figur in einem anderen Roman des entfesselt schreibenden K. aufzutauchen.
Danach machte K. die üblichen Erfahrungen, die fast alle Erstautoren machen. Im Briefkasten steckte ein dicker Umschlag, der Rückumschlag, den man dem an den Verlag eingesendeten Text beigelegt hatte. Dieser hatte leider den Weg zurück gefunden. Man mochte gar nicht reinschauen.
Es stand immer dasselbe drin:
Passt nicht ins Verlagsprogramm.
Das von ihnen aufgegriffene Genre ist derzeit out.
Könnten sie zu diesem Thema nicht vielleicht einen Sachroman schreiben?
Am besten sie definieren uns die Zielgruppe.
Wir wünschen ihnen viel Glück bei anderen Verlagen.
K. fragte sich, wer da überhaupt etwas gelesen hatte. Der Lektor? Lektor kommt von „lesen, vorlesen“. Man müsste meinen, dass die mit der Muttersprache Deutsch ganz gut zurechtkommen. Die Ablehnungsschreiben waren aber überwiegend in grauenhaftem Deutsch abgefasst. Kein Text war ohne Rechtschreibfehler. Das können keine Lektoren sein, das sind überforderte oder aber hypertrophe Wesen, geifernd auf der ständigen Suche nach dem Blockbuster, der ihren Verlag und damit ihren Arsch rettet. Alle hatten Angst, Entscheidungen zu treffen. Zu viele falsche Entscheidungen, zu viele Flops und der Verlag würde wirtschaftlich Schlagseite bekommen.
Dass es dann so schnell gehen würde, damit hatte er jedoch nicht gerechnet. Ungefähr der dreißigste Verlag, dem er das Manuskript angeboten hatte, schlug zu. Die Lektorin fand das Thema aktuell. Momentan flogen die Manager reihenweise aus ihren Jobs raus. K. berichtete in seinem Roman, wie sich so eine traumatische Trennung allmählich anbahnt und gab gute Ratschläge zur Bewältigung solcher Krisen. Im Untertitel stand „ein Roman und Ratgeber“. Er hatte also einen Sachroman kreiert. Die Schreibe war flott, und der Hauptklientel des Buchhandels, die viel lesenden Frauen, konnten auch auf ihre Kosten kommen. K. hatte etliche erotische Fantasien aus dem Berufsleben mit eingebaut.
Die einzige bittere Pille, die K. schlucken musste, war die Haftungsübernahme. Wenn berechtigte Einwände wegen Verletzungen der Privatsphäre eingehen würden und das Werk nach Auslieferung an den Buchhandel zurückzuziehen oder zu überarbeiten wäre, dann würde das zu seinen Lasten gehen. Als er zaghaft fragte, ob man darüber noch einmal reden könne, erhielt er eine schnippische Antwort. Der Autor selber, denn nur der würde die genaueren Zusammenhänge kennen, müsse entscheiden, ob sich da irgendjemand auf den Schlips getreten fühlen könnte. Für fehlgeschlagene psychotherapeutische Behandlungen des Autors sei man nicht zuständig. In seiner Anfangseuphorie verdrängte K. dann einfach dieses Risiko und legte damit den Grundstock für eine weitere Umdrehung in seiner Abwärtsspirale.
Von Anfang an sollte der Titel „Die Kündigung“ lauten. Bezüglich des Untertitels kristallisierte sich dann „- ausgebrannt und gefeuert - “ heraus, um noch eine reißerische Komponente hinzuzufügen. Zunächst verkaufte sich die erste Auflage von 3.000 Stück schleppend. Ca. 700 Exemplare gingen zwar bereits im ersten Monat über den Ladentisch. Käufer waren wahrscheinlich überwiegend die Personen, die davon ausgingen, dass sie im Buch Erwähnung gefunden hatten, also vorrangig K.s Bekannte und Personen aus seinem weiteren privaten und beruflichen Dunstkreis. Das hatte die Lektorin so bereits vorausgesagt, obwohl das Buch unter einem Pseudonym erschienen war.
Dann aber wurde der Verkauf schleppender. Kurz bevor das Buch aus der zweiten Reihe auf den Präsentiertischen in den Buchhandlungen verschwand, erschien ein Artikel in einem Wirtschaftsmagazin, welcher die Hintergründe des Rauswurfs einiger Führungskräfte aus der jüngsten Vergangenheit thematisierte. In diesem Magazinbeitrag wurde auch das Buch K.s erwähnt. Das war der Durchbruch. Das Buch wurde in den Feuilletons der großen Tageszeitungen besprochen und im unteren Drittel der Spiegel-Bestsellerliste für Sachbücher geführt. Insgesamt erschienen drei Auflagen. Genauso hatte sich K. das vorgestellt. Die monatlichen verkaufsabhängigen Honorarausschüttungen kletterten beständig.
Dann formierte sich allmählich die Gegenbewegung. Als aller erstes beschwerte sich der regionale Governor der Rotarier in einem Brief. Es sei eine absolute Geschmacklosigkeit, dass der Autor die rotarischen Clubs mit Kaninchenzüchtervereinen vergleiche. Der Verlag reagierte prompt. Nicht der Autor sei das gewesen, sondern die Romanfigur „K.“ habe das so formuliert. Am Ende seines Antwortschreibens konnte sich die Redakteurin des Verlags die Bemerkung nicht verkneifen, dass es allerdings eine außerordentliche intellektuelle Herausforderung darstelle, zwischen dem Autor und dem Protagonisten zu differenzieren.
Die nächste Beschwerde erreichte K. postalisch. Der Brief kam von seiner ehemaligen Sekretärin. Sein Rausschmiss habe sie erheblich betroffen gemacht. Sie habe tagelang weinen müssen. Am schlimmsten sei gewesen, dass K. in seinem Buch behauptet habe, dass sie miteinander Sex gehabt hätten.
K. antwortete.
Liebe Frau Sperling, nur weil sie einen Vogelnamen haben und die Romanfigur Frau Vogler heißt, dürfen sie davon nicht ableiten, dass sie Frau Vogler sein sollen, genauso wenig, wie der Herr K. im Roman meine Person repräsentiert. Selbstverständlich waren wir nicht intim, weder in der Realität, noch im Roman. Wenn sie die Stelle auf Seite 135 des Buches noch einmal genau lesen, dann wird von Geschlechtsverkehr im Büro gesprochen, welchen die Romanfigur K. mit der Romanfigur Vogler gehabt haben soll, der aber so gar nicht stattfand. Frau Vogler war zu einer solchen Aussage durch den bösen Manager Bosse gezwungen worden, um K. moralisch in die Knie zu zwingen, was im Übrigen in Wirklichkeit so auch nie statt gefunden hat. Es handelt sich bei meinem Buch um eine Ausgeburt meiner Fantasie. Das ist keine Reportage, das sollen auch keine Memoiren sein, das ist eine fiktive Novelle. Mit freundlichen Grüßen K.“
K. war jetzt ganz oben auf. Offensichtlich wurde die Geschichte gelesen, und die Leser setzten sich mit den Personen und Handlungen im Roman auseinander. Die Figuren, bei deren Beschreibung er keine Destruktoren eingebaut, deren Sauereien er eins zu eins beschrieben hatte, die meldeten sich nicht. K. grinste grimmig in sich hinein. Klar, wenn sie sich in ihren Lügen und Betrügereien wieder erkennen, dann werden sie den Teufel tun, ihre Persönlichkeitsrechte zu reklamieren. Das sähe ja wie ein Schuldeingeständnis aus.
Die Verkaufszahlen stiegen weiter. Die dritte Auflage war schon zur Hälfte verkauft, da erhielt K. von seiner Lektorin einen Anruf. Ein gewisser Furtwanger habe sich über seinen Anwalt gemeldet. Er erkenne sich in der Figur des Krusewitz wieder und fühle sich diffamiert.
„Sie erwarten, dass wir die bereits ausgelieferten Bücher aus dem Handel zurückziehen. Ferner bestehen sie darauf, dass das Kapitel, in dem Krusewitz, der in Wirklichkeit Furtwanger hieß, als korrupter Mitarbeitervertreter beschrieben wird, aus künftigen Auflagen verschwindet“, sagte die Lektorin in ruhigem Ton am Telefon. K. musste erst im Glossar des Buches blättern um sich zu erinnern, wen er denn bei der Beschreibung dieses vermaledeiten Krusewitz vor seinem Dichterauge gehabt hatte.
„Aber das ist doch alles nur romanhaft. Klar, auch da habe ich ein paar Anleihen bei der Realität genommen. Es passte halt so gut“, erwiderte K. kleinlaut.
„Der Anwalt von Furtwanger ist ein Wadenbeißer. Ich kenne ihn von anderen Verfahren, in denen er einstweilige Anordnungen in ähnlich gelagerten Fällen erreicht hat“, sagte die Lektorin und jetzt nahm ihr Ton an Schärfe zu. „Herr K., ich schätze sie sehr, ich will sie nicht beschädigt sehen, wir wollen ja noch weitere Buchprojekte realisieren. Deswegen sagen sie mir eins: Haben sie hier zu eng von der Wirklichkeit abgekupfert? Können die uns in die Pfanne hauen?“
K. zögerte mit der Antwort, bis er sich zu einer Erwiderung durchringen konnte: „Es ist völlig albern, diese Figur spielt eine absolute Randrolle. Aber da ist ein nicht beherrschbares Restrisiko“, quetsche er, „schon damals war mir klar, dass ich es mit einem Riesenarschloch zu tun habe. Der hat schon immer anders getickt.“
„Das bedeutet also Rückruf?“
„Ich fürchte ja. Wenn ich mir die Zwischentöne in ihrer Rede so anhöre, dann haben sie ja bereits entschieden“, sagte K.
„Wir ziehen gleich den ganzen Schwanz ein. Das spart Anwalts- und Gerichtskosten. Die Rechtsprechung hat sich in solchen Fällen immer mehr auf die Seite der Verfechter der Persönlichkeitsrechte geschlagen. Die künstlerische Freiheit ist in den letzten Jahren immer mehr ins Hintertreffen geraten. Das ist aber kein Hals- und Beinbruch. Vielleicht kriegen wir über die Rückrufaktion noch mehr Publicity. Grämen sie sich nicht. Wir werden das Beste draus machen.“
Nachdem die Lektorin aufgelegt hatte, erinnerte sich K. schemenhaft an eine Klausel in seinem Autorenvertrag. Wie war das noch mal? Sollte er nicht persönlich für die Kosten einer solchen Rückrufaktion haften? Er verdrängte diesen unangenehmen Punkt.
K. befand sich in der Defensive. Wieso aber hatte ausgerechnet dieser Furtwanger Protest eingelegt? Zumal K. den Vorgang so beschrieben hatte, wie er abgelaufen war und ihm Furtwanger in keiner Weise als Mimöschen in Erinnerung geblieben war. Er konnte zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, dass die Hyphen des Myzels hinter ihm herrankten, dass alle seine Schritte, alle seine Spuren beobachtet und verfolgt wurden. Die Organisation hatte entschieden, dass er für sie arbeiten sollte. Dem konnte man sich nicht entziehen. Nur durch den Tod hätte man entkommen können.
8. Die Wende
Er nahm den nächsten Briefumschlag in die Hand. Darauf stand ein Absender, den er zuvor noch nie gelesen hatte. Bob W. Bockhold, Attorney at Law stand da und als Ort eine Norddeutsche Kleinstadt. Er riss den Umschlag auf und las den Brief:
Sehr geehrter Herr Professor K.,
von einem gemeinsamen Bekannten, Herrn Dr. Udo Schütz, erhielt ich Ihre Adresse. Vorher hatte ich mehrere Wochen lang vergeblich versucht, sie telefonisch zu erreichen. Durch einen tragischen Unfall ist unser medizinischer Berater, Herr Prof. Dr. Dr. Grosser ums Leben gekommen. Er koordinierte für uns einige Forschungsvorhaben und bearbeitete toxikologische und epidemiologische Fragen, deren Beantwortung für uns überaus wichtig ist. Wir suchen nun Ersatz für Herrn Professor Grosser. Ich würde mich außerordentlich freuen, wenn ich hierzu Ihr Interesse wecken könnte. Bitte rufen sie mich an.
Mit freundlichen Grüßen Bob W. Bockhold.
Klingt ganz interessant, dachte sich K., insbesondere vor dem Hintergrund meiner angespannten Haushaltslage und in Anbetracht eines für mich weitgehend verschlossenen Arbeitsmarktes.
Am selben Tag klingelte bei ihm das Telefon. Sein Kollege Udo Schütz war am Apparat. Ob er von dem Doppelmord in Hannover vor einigen Monaten gehört hätte.
Ja, habe er, antwortete K. Er wäre einige Monate im Ausland gewesen und hätte nur wenig in die Zeitungen geschaut. Eine Bekannte hätte ihn darauf angesprochen. Zunächst sei ihm Grosser nicht in den Sinn gekommen, weil die Tat so ungeheuerlich gewesen sei. Als er dann etwas in der BILD-Zeitung darüber gelesen hatte, hätte er realisiert, dass es sich um seinen alten Bekannten Hans-Günter Grosser gehandelt habe.
Richtig, Grosser sei es gewesen, sagte Schütz. Der sei zuletzt als Consultant für eine Anwaltskanzlei tätig gewesen. Da wäre es um die krankmachende Wirkung von Fasern in Bremsbelägen gegangen. Die Juristen bräuchten Unterstützung von medizinischer Seite, um in Gerichtsverfahren in den USA stichhaltige Argumente zur Hand zu haben. Die Anwaltskanzlei suche dringend nach einem Ersatz für den ausgefallenen Grosser, weil die ganze Aktion schon ins Laufen gekommen sei. Ob das was für K. wäre?
„Das klingt ja ganz interessant“, sagte K., ohne dass er kapiert hatte, worum es hier genau ging.
Zwei Tage später – nur nicht zu voreilig - rief er Bockhold an und vereinbarte den Termin für ein Treffen.