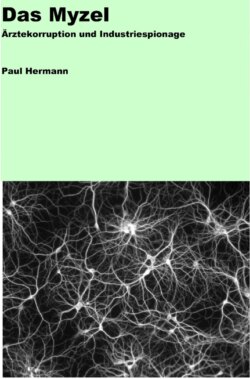Читать книгу Das Myzel - Paul Hartmann Hermann - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Herr Professor K.
ОглавлениеMan hatte ihm gekündigt, oder exakter formuliert, man hatte ihn gefeuert und das war paradox. Sein Management war tadellos gewesen. Seine Leistungsbilanz für die Firma konnte sich sehen lassen: Über zehn Jahre hinweg organisches Wachstum und stetig steigende Gewinnmargen, kein Fremdkapital im Unternehmen, beeindruckender Cash flow, stabiler Mitarbeiterstamm, alle Erfolgsfaktoren hatten sich im positiven Bereich befunden. Deswegen war sein Vorstandsvertrag erst vor ein paar Monaten um weitere fünf Jahre verlängert worden.
So einen schmeißt man nicht einfach raus. Erstens sei er kaum ersetzbar und zweitens würde die Trennung teuer werden, so dachte er. Aber in beidem hatte er sich gründlich verspekuliert. Es war denen egal, ob er nun wirklich so einzigartig war oder nicht. Sein Abgang war für das Unternehmen nicht ganz billig, fiel aber in den Büchern auch nicht so richtig auf. Schließlich konnte man die Abfindungssumme Steuer mindernd absetzen. Teuer für die Firma würden über kurz oder lang die korrupten Saubermänner im Aufsichtsrat werden. Die hatten ihn geschasst, weil er deren immer dreister gewordene Selbstbedienungsmentalität unterbinden wollte und weil er denen einfach zu mächtig geworden war.
Zugegeben, er war auch nicht gerade zimperlich im Umgang mit den Mitgliedern des Aufsichtsorgans der Stiftung gewesen. Er gab nicht klein bei, als man sich gegenseitig die Daumenschrauben anzog. Dazu war seine Position in der Stiftungssatzung zu gut abgesichert. Aber genau das war der Stein des Anstoßes, hier hakte die Gegenseite ein und verfolgte mit krimineller Energie und Lügen ihr Ziel der Machtausweitung.
Es ging schlicht und ergreifend darum, wer in Zukunft das Sagen in der Stiftung haben würde und sich an den angehäuften Finanzmitteln laben könnte. Diese Stiftung war nämlich eine Stiftung des bürgerlichen Rechts, also durchaus nicht gemeinnützig, sondern mit Gewinnerzielungsabsicht. Der Webfehler, den K. in seiner vollen Tragweite ursprünglich nicht richtig erkannt hatte war, dass das Unternehmen sich selbst gehörte, also kein Eigentümer im landläufigen Sinne existierte. Das jedoch machte etliche Leute sinnlich.
Hier geriet K. letztendlich unweigerlich ins Hintertreffen. Papier, auf dem Vereinbarungen stehen, ist das Eine ist. Das Andere sind gewachsene persönliche Beziehungen und diskrete Absprachen. Da war der Feind besser. K. lief immer mit offenem Visier herum. Sein Minenspiel zeigte seismographisch seine Stimmung an. Die Gegenseite hatte konstant eine Maske der freundlichsten Unverbindlichkeit auf. Die einzige Möglichkeit, den Rausschmiss zu vermeiden, wäre ein Kotau gewesen. Aber nicht mit ihm: Einmal Neger, immer Neger.
Bei dieser von K. so nicht geplanten beruflichen Zäsur hatte aber wahrscheinlich noch ein anderer Grund eine Rolle gespielt. Es war nichts Konkretes, sondern mehr eine Stimmung, die sich bei ihm schleichend breit gemacht hatte und die sein berufliches Selbstverständnis gehörig erodierte. Er musste erkennen, dass die Dienstleistungen, die durch die Health Care Foundation verkauft wurden, kein tieferer Sinn steckte. Bei Kunden, auf Veranstaltungen und in seinen Artikeln pries er etwas an, was nutzlos war. Nachdem in der Republik über die Jahre mittlerweile rund 100 Millionen sogenannte Vorsorgeuntersuchungen nach berufsgenossenschaftlichen Grundsätzen durchgeführt worden waren, hatte bislang kein einziger Arbeitsmediziner oder Epidemiologe nachweisen können, dass dieser Untersuchungsoverkill zu einer Reduzierung der arbeitsbedingten Gesundheitsstörungen geführt hatte. Die Untersuchungen, die in Wirklichkeit allenfalls Früherkennungsmaßnahmen waren, mussten größtenteils aufgrund gesetzlicher Auflagen durchgeführt werden. Freiwillig hätte diese Untersuchungen kaum ein Unternehmen machen lassen. Denn sie kosteten nur Geld und zwar nicht nur für die medizinische Dienstleistung, sondern auch für den Arbeitsausfall des zu untersuchenden Mitarbeiters.
Auch die medizinischen Check-ups bei high Potentials waren Bullshit. Okay, gelegentlich wurde mal ein vorher unbekannter Nebennierentumor entdeckt. Dafür aber zeigten die sonographischen und kernspintomographischen Bilder häufig Artefakte, die zu weiteren unsinnigen Abklärungen Anlass gaben oder vielleicht sogar in eine überflüssige Operation mündeten. Der Großteil der untersuchten Probanden war aber weitgehend gesund.
Überproportional vertreten bei den Check-up-Kandidaten waren die Gesundheitsfanatiker, also die Personen, die eine Durchuntersuchung am wenigsten nötig hatten. Bei den regelmäßigen Nachuntersuchungen der anderen Auserwählten war es dann immer wieder dasselbe. Die niedrigen HDL-Werte bestanden nach wie vor, die Glucosetoleranz hatte sich weiter vermindert, die Blutdruckwerte waren angestiegen und die Leberenzymaktivtäten hatten sich eher verschlechtert.
Hatten wir nicht vereinbart, dass sie weniger fressen und saufen und dafür mehr laufen?
Ja schon, Herr Doktor, aber sie kennen das doch, die sozialen Zwänge, die Reisen, die Geschäftsessen.
Jetzt nur nicht zu streng sein, sagte sich dann der auch auf seine Jahresgratifikation schauende Arzt, sonst kommt diese wichtige Person das nächste Mal nicht wieder.
Es ging also K.s Identifikation mit dem was er beruflich machte, den Bach runter. Er verdiente zwar nicht schlecht, sah das aber weniger als Anerkennung, sondern mehr als Schmerzensgeld. Und man merkte K. an, dass er nicht hinter dem stand, was er sagte und tat und er merkte, dass man es merkte. So machte sich ein ungutes Karma breit, eine Strömung, die nur schwerlich zu beeinflussen war und die schließlich dazu führte, dass er stank. Er stank nach Bockigkeit, Unzufriedenheit, Missmut und Revolution. Am liebsten hätte er das ganze System der Pseudoprävention in die Luft gesprengt. Damit hätte er aber gleichzeitig alles das, was er vorher gemacht hatte, in Frage stellen müssen. Er wäre unglaubwürdig geworden.
Für die ärztlichen Mitarbeiter, die Dienst nach Vorschrift machten und den ganzen Tag überwiegend diese saublöden Vorsorgeuntersuchungen durchführten, die laufend maulten und Extras haben wollten, empfand er nichts als Verachtung. Dabei führte er eine Firma, die solche Drückeberger und Duckmäuser magisch anzog.
Das alles brachte ihn zunehmend aus dem Lot und führte zu unüberlegten und durch Frust getragene Handlungen. Die Gegenseite spürte seine nachlassende Motivation und seine zunehmende Aggressivität. Sein Standing schmolz dahin.
In der letzten Zeit hatte er sich zunehmend ausgebrannt gefühlt, war dünnhäutiger geworden. Vielleicht hatte er zu viel erreichen wollen. Zur Bekämpfung seiner Identifikationskrise hatte er seine Anstrengungen im Beruf weiter verstärkt. Er hatte Wissenschaft betrieben und gleichzeitig Management gemacht. Dadurch hatte er in keinem Lager einen richtigen Stallgeruch entwickeln können, ein Fehler, der ihn zusätzlich in die Defensive brachte. Denn als er eine neue Beschäftigung suchte, da fehlten ihm die intakten Netzwerke.
Durchschnittlich jeden zweiten Tag war er auf Geschäftsreise. Seine immense Reisetätigkeit mutete wie eine Flucht an. Und was natürlich die ganze Misere noch perpetuierte, das war sein Alter. Er war vor kurzem 55 Jahre alt geworden. Zu alt und dann auch noch überqualifiziert, der passt nicht in unsere Firmenlandschaft, hieß es in den Unternehmen, bei denen er wegen eines neuen Jobs vorgefühlt hatte.
Wenn sich die berufliche Karriere dem Ende zuneigt, dann wünscht man sich keinen Hindernislauf, sondern eine freie Bahn mit einer klaren Ziellinie. Das alles hatte er geplant und gut vorbereitet, doch nun war nicht nur der berufliche Crash passiert, sondern in seiner engsten Umgebung hatte sich auch noch ein Mord ereignet, und er wurde das ungute Gefühl nicht los, dass die Kugel eigentlich ihm gegolten hatte. Er hatte nicht den geringsten Schimmer, wer der Täter gewesen sein könnte, welche Motive ihn und die Hintermänner bewegten. Er wusste nur eins, wenn er das eigentliche Opfer hätte sein sollen, wofür viel sprach, dann befand er sich jetzt in Lebensgefahr. Er hatte das unbestimmte Gefühl, observiert zu werden. Jedes schwarze Auto mit abgedunkelten Scheiben im Fond, jedes Klingeln des Handys ohne Gesprächsvermittlung und jede Gestalt im Trenchcoat, welche Auslagen im Schaufenster betrachtete, waren für ihn diffuse Indizien. Seine ehemals geordnete Existenz war aus heiterem Himmel an mehreren Fronten auf einmal ins Ungewisse, ins Chaos geraten.
Er schnitt sich die Fingernägel mit einem Nagelknipser. All die kleinen Halbmonde im Waschbecken waren ein Teil von ihm. Es tat nicht weh, sich von ihnen zu trennen, ähnlich wie beim Leprakranken, dessen Nerven abgestorben sind und bei dem die verstopften Gefäße zu einem Abfallen der Akren führen. Er hatte das Gefühl, dass er über die Jahre größere Stücke seiner selbst verloren hatte. Die Hülle stand zwar noch, doch sein Inneres war morsch geworden. All das was ihm früher Halt und Orientierung gegeben hatten, war nicht mehr da. Er meinte, dass ihm das Schicksal das alles genommen hätte, doch die Wahrheit war, dass er es nicht geschafft hatte, die Dinge zu halten. Immer wieder hatte er sich in einem Anflug von Großmut und gleichzeitigem Schwachsein von Sachen getrennt, die ihm früher lieb und teuer gewesen waren. Seine alten Armbanduhren hatte er an Freunde verschenkt, nachdem er festgestellt hatte, dass er nur eine Uhr tragen musste, um die Zeit ablesen zu können. Seine Sammlung von Eames-Chairs, einst nicht gerade preiswert zusammengekauft, hatte er viel zu billig verscherbelte, als er dringend Geld brauchte. Nach seinem beruflichen Crash gab es auch keine Verwendung mehr für seine zahlreichen edlen Hemden, Anzüge und Jacketts. Zehn Jahre hatte er sich als weltgewandter Manager verkleidet und bei jeder passenden Gelegenheit Krawatten gekauft. Dann hatte er den ganzen Textilkrempel in mehrere Umzugskartons gestopft und zu einem Second-Hand-Laden geschleppt. Er erhielt einen Bruchteil des ursprünglichen Preises.
Schließlich trennte sich seine Frau von ihm. Sein beruflicher Crash hatte zu einer sozialen Ächtung geführt, die auch nicht spurlos an ihr vorübergegangen war. Beim Metzger und beim Bäcker war Frau K. nicht mehr die Frau Doktor. Außerdem war sie mit seiner depressiven Grundstimmung nicht mehr klar gekommen. Er hatte keine größeren Anstrengungen unternommen, sie zu halten. Die Beziehung war nach 25 Jahren einfach ausgeleiert und Ersatzteile waren keine auf Lager.
Die Trennung machte den Verkauf der gemeinsamen Wohnung erforderlich. Wie hatte er diese Wohnung geliebt. Über vier Meter hohe Räume, alte Holzdecken und Stuck überall, dann das honigfarbene Eichholzparkett und die Kastenfenster mit den alten Fensterflügeln und Scheiben, die nach alter Machart gegossen worden waren und durch die hindurch sich die Außenwelt leicht verzerrt darstellte. Alles noch im Originalzustand, 130 Jahre alt. Ein außergewöhnliches Schmuckstück, was an einen schnöseligen Neureich ging, der sogleich Mauern versetzen und Durchbrüche schaffen wollte.
Er starrte auf die Nagelschnipsel im Becken. Er empfand nichts als innere Leere. So wie er nicht in der Lage gewesen war die materiellen Dinge zusammenzuhalten, ging es ihm auch mit den Menschen. Seine beiden Kinder hatte er schon seit Monaten nicht mehr gesehen. Wenn sie ihn gelegentlich anriefen, zum Geburtstag oder zu Weihnachten, wusste er nicht, was er erzählen sollte. Das was er erlebte, wollte er nicht berichten und alles andere hielt er für zu belanglos, um mitgeteilt zu werden. Und da er keine Ahnung hatte, was seine Kinder so machten, fielen ihm auch keine Fragen zu deren Leben ein. Dementsprechend kurz und hohl gestalteten sich die Telefongespräche.
Ähnlich ging es ihm mit seinen wenigen Freunden, alles erfolgreiche Typen in leidlich intakten Partnerbeziehungen. Was sollte er bloß mit denen bereden? Gegen deren pralles bürgerliches Leben, war sein privates Dasein derartig uninteressant, dass er Angst vor jedem Anruf aus dieser Richtung hatte. Sollte er erzählen, dass er gestern Abend schon wieder eine Wagner-Pizza in den Ofen geschoben hatte, dass er seit acht Jahren dasselbe Auto fuhr oder dass er schon lange keinen richtigen Urlaub mehr gemacht hatte?
Er nahm die Bürste und schob damit unter laufendem Wasser die abgeschnittenen Nägel in den Abfluss. Er hatte das Gefühl, als wenn er ausliefe, als wenn auch noch der letzte Rest seiner selbst in die Kanalisation hinunter gezogen würde.
Gedankenverloren blieb sein Blick an einem silbern glänzenden Metallkasten hängen. Er hatte die Größe einer halben Zigarettenschachtel. Er nahm den kleinen Kasten in die Hand. Der Kasten wog schwer, nicht nur wegen seines Gewichts, sondern auch, weil es sich um den alten Herzschrittmacher seines Großvaters handelte. Es war ein Schrittmacher der ersten Generation. Deswegen war er etwas sperrig. Dieser Talisman begleitete K. überall hin. Sein Großvater war bis ins hohe Alter ein gesunder, ein zäher Mann gewesen. Dessen nachlassende Kraft und Zuversicht waren durch dieses Metallkästchen noch einmal beflügelt worden. Wenn K. den Schrittmacher nur fest genug umfasste, dann spürte er wie die positiven Energien des Großvaters auf ihn übergingen. Mit diesem Schrittmacher in der Hand würde er immer überleben.