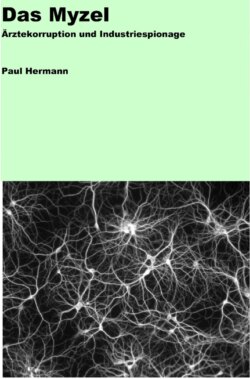Читать книгу Das Myzel - Paul Hartmann Hermann - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
15. Das Spiel beginnt, New York im März/April 2007
ОглавлениеK. hatte sich durch mehrere Hallen und ein Gewirr von Verbindungsgängen auf dem Flughafen Charles De Gaule durchgekämpft. Der Flughafen war einfach desolat organisiert. Überall bildeten sich Menschenstaus. Mit Müh und Not erreichte er die Anschlussmaschine nach New York.
Die von der Anwaltskanzlei hatten ihm einen Platz in der Business Class gebucht. Bockhold saß schon sehr entspannt da. Er kannte die Schleichwege auf dem Terminal, da er die Strecke monatlich einmal flog. K. ließ sich erschöpft in den breiten Ledersessel fallen. Ganz angenehm dachte er sich, während die überaus freundliche Stewardess, die sich als Cindy vorgestellt hatte, ein Glas Champagner servierte. Zum Dinner gab es Gänseleberpastete mit einer ausgezeichneten weißen Spätlese aus dem Burgund.
Bockhold hatte einen Stapel Magazine vor sich liegen. Darunter befand sich ein Fachjournal, in dem es um Handfeuerwaffen ging. K. sah auch eine Zeitschrift mit dem Titel Neuro-Sciences. Mit was der sich alles beschäftigt, wunderte sich K. Bald darauf fiel er in einen oberflächlichen Schlaf.
Nach einem siebenstündigen Flug wurde im Morgengrauen auf dem Airport von Newark gelandet, wo Bockhold einen Mietwagen vorgebucht hatte. Auf mehrspurigen Highways ging es dann nach Südwesten. Es kamen ihnen endlose Schlangen von Autos entgegen. Das seien die Bewohner der Bedroom-Communities auf dem Weg zur Arbeit, sagte der Anwalt.
Bockhold besaß ein großes komfortables Holzhaus in Long Branch. Das Haus stand auf der Seeseite der Uferpromenade. Von der Terrasse aus betrat man direkt den weißen Sandstrand und nach fünfzig Schritten wurden die Füße vom kalten Atlantikwasser umspült. Long Branch war vor dem Krieg ein mondänes Strandbad gewesen und wurde jetzt von der Mittelklasse neu entdeckt und zunehmend in Beschlag genommen. Bockhold berichtete stolz von den ständig steigenden Immobilienpreisen. Auch der Wert seiner Eigentumswohnung in Miami hätte deutlich zugelegt.
Am nächsten Morgen begann der Weg zur Arbeit mit dem Auto, aber nur bis zur Anlegestelle der Expressfähre. Das dauerte keine fünf Minuten. In dem Schiff saß man wie in einem bequemen Großraumwagen der Bahn und konnte auf Monitoren über CNN die aktuellen Tagesmeldungen verfolgen. Nach einer reichlichen halben Stunde erreichte man die Einfahrt zur New York Bay. Die letzten zehn Minuten verbrachte K. auf dem Oberdeck. Es war ein besonderes Faszinosum, wie rechts Governors Island und links Ellis Island passiert wurden und dann aus dem Morgendunst die Skyline von Lower Manhattan auftauchte, immer höher und mächtiger wurde und das große Schiff angesichts der sich nähernden Wolkenkratzer zusehends schrumpfte. Nach Verlassen der Fähre wurden die Menschen von den Schluchten zwischen diesen Stahl und Stein gewordenen Allmachtsymbolen verschlungen. So saugte sich der Megaschwamm morgens geschäftig mit Menschen voll, um sie abends dann wieder rauszuquetschen. Die hohen Häuser mit der atemberaubenden Skyline wirkten wie eine Reuse, in der sich Größenwahn und Eitelkeiten beim Rein- und Rausfluten der Menschen verfingen.
Am Hauptsitz der Anwaltskanzlei teilten sich rund 70 Anwälte und noch einmal so viele Mitarbeiter den spärlichen Platz in mehreren Etagen eines 50stöckigen Hochhauses aus den 1930-er Jahren. Damals soll es mal für kurze Zeit das höchste Gebäude in der Stadt gewesen sein, erzählte Bockhold. Die Eingangshalle im Erdgeschoss war marmorn getäfelt, ebenso die Aufzüge, welche innen teilweise zusätzlich großflächig verspiegelt waren. Im 42-sten Stockwerk am Ziel angekommen wurde es dann schon etwas schäbiger. Die Großzügigkeit und Pracht wich einer klein karierten Enge. Die Sekretärinnen saßen in Boxen, verbunden durch schmale Flure, durch die man nicht nebeneinander durchpasste. Die Toiletten waren nur über das innen liegende enge und finstere Treppenhaus zu erreichen. Der Toiletteneingang musste mit einer Codekarte geöffnet werden, die man sich rechtzeitig zu besorgen hatte.
Dafür war der Ausblick aus dem Besprechungszimmer fantastisch. In der Ferne war die Freiheitsstatue zu sehen. Beim Blick nach links sah man den East River hinauf. Unten an den Piers lief ein Schiffsverkehr ab, wie auf dem Canale Grande, nur dass die Fährschiffe zehnmal so groß waren wie die Vaporettos in Venedig. Auf dem benachbarten Heliport starteten und landeten die Hubschrauber im Minutentakt.
Und wenn man nach rechts schaute, dann blickte man direkt in die klaffende Lücke von Ground Zero. Am 11. September 2001 hatten sie von hier oben einen Logenplatz gehabt, bis sie evakuiert wurden. Keiner der Angestellten mochte über das Ereignis reden. Die Dramatik und das Grauen dieses Tages waren für K. im fernen Europa kaum fassbar gewesen.
Jeder auf der Welt konnte sich zurück erinnern, an welchem Ort er sich damals aufhielt, als er von dieser epochalen Katastrophe erfuhr. K. befand sich auf einer Bahnfahrt nach Berlin. Ein Freund rief ihn an und berichtete erschüttert, dass Amerika in Flammen stehe. Er begriff das erst richtig, als er abends im Hotel die qualmenden Twin-Towers im Fernsehen sah.
Was für eine Apokalypse musste das gewesen sein, als sich die durch die Flammen und den Rauch in die Enge getriebenen Menschen in den Abgrund stürzten und beim Herabfallen ihren eigenen gen Himmel aufsteigenden Seelen begegneten. K. erinnerte sich an seinen ersten Besuch in New York vor einigen Jahren, als er auf der Aussichtsplattform des World Trade Centers über eine in der Mittagssonne strahlende Stadt schaute. Ein makelloses Bild, bis auf die Kotzhaufen zwischen Geländer und den bis zum Boden reichenden Fensterscheiben. Nicht jedes Gleichgewichtsorgan war gegen den sich einstellenden Tiefentaumel gefeit. Was für eine Panik und Verzweiflung musste diejenigen getrieben haben, die gegen diesen Urreflex gehandelt hatten und gesprungen waren.
Und dann wurde die Physis der im zusammenkrachenden Gebäude Verbliebenen quasi laminiert, ins Erdreich gepresst, auf die Dimension einer Inschrift reduziert. K. musste an die mit Bronze beschichteten Stolpersteine denken, in welche die persönlichen Daten der NS-Opfer eingraviert worden waren und die er erstmals in der Alten Schönhauser Strasse in Berlin-Mitte gesehen hatte, die mittlerweile aber in vielen anderen Städten aufgetaucht waren.
Aber über eins berichteten die Anwälte in Zusammenhang mit dem Desaster dann doch, weil es zum Arbeitsthema passte. Professor Selikoff von der Mount Sinai School in New York sei in den 1970er Jahren einer der ersten gewesen, der eine valide und aussagekräftige Epidemiologie zu den asbestbedingten Gesundheitsschäden vorlegte. Er habe eindeutige Zusammenhänge zwischen der Einwirkung von Asbestfaserstaub und dem Lungenkrebs sowie dem Brustfellmesotheliom aufgezeigt. Hierzu habe er die Todesursachen der Werftarbeiter von den New Yorker Dock Yards untersucht. Diese hätten zu Kriegs- und Nachkriegszeiten intensiv Spritzasbest verarbeitet, wobei extreme Expositionen gegenüber Amphibolasbestfasern aufgetreten wären. Selikoff sei zum unumstrittenen Asbestpabst avanciert, obwohl er niemals ein Medizinstudium absolviert hatte.
Als Brandschutz für die tragende Stahlskelettkonstruktion der Twin Towers wollte man ebenfalls den robusten Spritzasbest verwenden. Man habe bereits mit den Isolierungsarbeiten begonnen, da sei der berühmte Selikoff bei den Bauaufsichtsbehörden erschienen und hätte auf das hohe Gesundheitsrisiko für die Spritzasbestarbeiter hingewiesen. Daraufhin hätte man die Verwendung des Spritzasbestes eingestellt und es sei ein teurerer und wesentlich weniger effektiver Brandschutzüberzug verwendet worden. Viele seien nun der Meinung, dass die ursprünglich geplante asbesthaltige Isolierung den Brandtemperaturen am elften September Stand gehalten hätte und die Türme nicht eingestürzt wären. Wenn es aber dennoch zum Crash gekommen wäre, dann hätte ganz Manhattan ein Asbestproblem ungeahnten Ausmaßes gehabt. Die Spritzasbestisolierung wäre durch den Zusammensturz pulverisiert worden und die Asbestfasern hätten ganze Stadtteile kontaminiert.
K. bemerkte bei Bockhold einen tief sitzenden Stolz auf diese Stadt. Das ist mein New York, sagte er ein paar Mal ergriffen. Das hielt ihn aber nicht davon ab, eine ebensolche Bewunderung für Deutschland zu hegen, was K. merkwürdig fand. Bockhold war Partner in einer Anwaltssozietät, welche jüdisch dominiert war. Wahrscheinlich hielt er sich als Nichtjude gerade wegen seiner deutschen Affinitäten in dieser Sozietät so gut. Er war hervorragend geeignet, die deutschen Klienten der jüdischen Lawfirm zu pflegen.
Bockhold wollte K. sein New York zeigen. Dazu trieb er K. einen ganzen Tag lang zu Fuß durch die Stadt, wobei sie die üblichen Touristenpfade abliefen. Er kannte sein New York nur von der Seite, die auch den Fremden geläufig ist. K. interessierte aber das andere New York, die Stadt der Kunst, der Mode, der spektakulären Restaurants und der unverschämten Dekadenz und Aufschneiderei. So erwähnte K. den Meatpacking District und das dortige Bistro Pastis. Das hätte er sich gerne mal angesehen.
Sein New-York-Führer schaute ihn verständnislos an, als K. diese Namen erwähnte. Stattdessen aßen sie bei McDonalds. Als Highlight hingegen empfand K. den Besuch bei Katz`s Deli in der South of Houston Street. Das Pastrami-Sandwich mit Riesenpommes und Salzgurken war eine Wucht. Aber die eigentliche Sensation für Bockhold war der Stuhl im Katz, auf dem Meg Ryan im Film Harry and Sally einen Orgasmus bekommen hatte, so war es jedenfalls auf dem Schild zu lesen, welches über dem Stuhl an der Decke baumelte. Im Skript zum Film sei allerdings gestanden, dass der Höhepunkt nur vorgetäuscht gewesen war, erläuterte Bockhold sachkundig.
Bockhold zog es in jeden Souvenirladen, den sie passierten. Sein ausschließliches Interesse galt dort Gegenständen, die mit der deutschen Autofirma in Verbindung standen. Da gab es Salz- und Pfefferstreuer, Lätzchen, Serviersets und noch andere mehr oder weniger überflüssige Utensilien in Herbieform oder mit Beetleaufdruck. Vieles davon hatte er schon in seiner Sammlung, aber der Schuhlöffel für 9,99 Dollar, der fehlte noch.
Sie hatten auf dem Nachhauseweg gerade den Landungssteg in Long Branch hinter sich gelassen und überquerten den Parkplatz. K. sah dort ausnahmslos Fahrzeuge der Kategorie über 50.000 Dollar stehen. Die meisten stammten aus deutscher oder italienischer Produktion.
„Das ist ein cleveres Konzept“, sagte K., „man spart sich die teuren Mieten in Downtown, braucht, obwohl man weiter weg wohnt, weniger Zeit zur Arbeit und kann sich dann das dickere Auto leisten.“
„Ganz so ist es nicht“, widersprach Bockhold, „die Leute hier verdienen alle genug, die könnten sich auch Stadtdomizile leisten. Tun sie aber nicht. Es ist die Lebensqualität, welche sie hierher gezogen hat und nicht das knappe Budget.“
K. vermied es, diese Diskussion weiter zu führen. Für ihn bestand Lebensqualität nicht nur in ruhigem Landleben. Die verschlüsselte Botschaft Bockholds war aber angekommen. Ich, Bob W. Bockhold, habe genug Geld, mir ein Haus zu kaufen, wo immer ich gerne möchte. Und wie zur weiteren Demonstration seines Wohlstands ließ Bockhold, am Haus angekommen, per Fernbedienung das breite Schwingtor zur Garage aufgehen.
„Das hier sind meine Babies“, sagte er mit einer weit ausholenden Armbewegung, welche K. an die Gestik des Trigema-Mannes erinnerte.
K. sah den Grundstock für ein Automuseum. Da stand neben einem Porsche Speedster von 1956 ein alter 356 B. Ein VW-Käfer mit geteilter Heckscheibe war da, ebenfalls ein Bully in der Campingausführung – Woodstock ließ grüßen – und als Krönung ganz vorne ein Porsche-Targa der ersten Generation in Quietschgrün, der Trendfarbe in den 1970er Jahren.
„Kommen sie, wir machen einen kleinen Ausritt mit dem Targa“, sagte der stolze Fuhrparkbesitzer, „das Wetter ist akzeptabel, wir können offen Fahren. Ich zeige ihnen mal die Gegend hier.“
Er öffnete die Kofferraumhaube und klemmte das Kabel des Ladegerätes von der Batterie ab. Dann entfernte er das Dach. Als er den Zündschlüssel drehte, blubberte und fauchte der Motor. Dem Auspuff entwichen dunkle nach verbranntem Öl riechende Wolken. Bockhold bog von der Uferstraße ab. Sie fuhren durch eine leicht hügelige stark zersiedelte Landschaft. Der luftgekühlte Sechszylinder röchelte, schmatzte oder kreischte, je nachdem, wie der Anwalt seinen Gasfuß stellte. Der alte Motor rüttelte sich wach und kam wieder zu Kräften.
Alle zehn Meilen tauchte eine Shopping Mall neben der Hauptstraße auf. Alle sahen sie gleich aus und alle waren sie belegt von den sattsam bekannten Einzelhandelsketten. Die Sportartikelgeschäfte waren hier so groß, wie ganze Warenhäuser in Deutschland.
Bockhold führte K. durch endlos lange, meist menschenleere Gänge an Regalen mit Artikeln vorbei, die ausnahmslos aus Fernost kamen. Allein das Angebot des Ball-Sortiments für American Football in der Sportequipment-Arena nahm eine ganze Hallenseite in Anspruch. Ausrüstungsgegenstände und Funktionsbekleidung für nahezu jede Sportart befanden sich in den Auslagen. Für Bockhold war dieses Angebot neben den teuren Importautos am Landungssteg Sinnbild für die Realisierung des amerikanischen Traums der unbegrenzten Möglichkeiten. Dabei war es viel mehr eine Demonstration für den Einfallsreichtum und die bessere Qualität der Produkte in den Erzeugerländern in Fernost und in Europa.
Und mit jedem Ball, der über den Ladentisch ging und mit jedem Paar Turnschuhe, das verkauft wurde, schnitt sich Fernost wieder ein kleines Stückchen aus dem großen amerikanischen Kuchen heraus. Dasselbe taten auch die japanischen und die deutschen Automobilfirmen in etwas größeren Happen. Die mächtigste Nation der Welt merkte in ihrem Konsumwahn nicht, wie sie sich sukzessive ans Ausland verkaufte. Dort liefen Billionen Dollar an Devisen auf, die auf Dauer nicht im Sparstrumpf verschwinden, sondern als Investitionen in Firmen und in Immobilien nach den USA zurück fließen würden.
Doch Vorsicht, da gab es noch einen anderen Aspekt. Das was Amerika ausgab, nicht nur für Importwaren, sondern auch für Häuser und Motorboote, Offroader und Pick ups, Raumfahrt und Waffen sowie Medicaid, das staatliche Programm für die Krankenversorgung und vieles andere mehr, das wurde durch Geld bezahlt, welches größtenteils gar nicht da war. Es war Spielgeld in Form von Überziehungskrediten auf Plastikkarten und von Hypothekenbriefen, mit denen überwiegend Schrottimmobilien viel zu hoch besichert worden waren, wie sich einige Jahre später in der größten Finanzkrise, welche die Wirtschaft jemals erschüttert hatte, herausstellen sollte.
So beuteten die USA den Rest der Welt aus. Es war Kolonialismus und letztlich auch Imperialismus pur, mit viel größeren Ausmaßen, als bei den Beutezügen der Spanier in Südamerika oder des Britischen Empire in Indien. Nur, dass der Raub hier über elektronische Verbindungen und undurchsichtige Finanzinstrumente im Verborgenen zustande kam und nicht in offen praktizierten feindlichen Handlungen, wie bei den christlichen Eroberern. Zwar würden die Amerikaner ihre Schulden, welche sich bei den Exportnationen in Form riesiger Handelsbilanzdefizite anhäuften, vollständig wieder zurückzahlen. Nur würden das dann Dollars sein, die nicht mehr den ursprünglichen Wert besaßen. Der altbekannte Trick hieß Inflation. Das fehlende Geld würde einfach nachgedruckt werden.
Man haute sich also gegenseitig übers Ohr und spielte Katz und Maus. Der eine gab dem anderen sein Spielgeld, damit dieser sich reich und mächtig fühle. Der andere gab dem einen dafür billiges Spielzeug oder gute Autos, damit der seinen Spaß haben sollte. Wenn nun der fleißige Produzent sein gespartes Spielgeld eintauschen wollte, bekam er nichts mehr dafür, aber der andere hatte seinen Spaß gehabt.
Deshalb tobte hinter den Kulissen ein geheimer Krieg; denn keiner hatte etwas zu verschenken. Wenn du versuchst, mich für dich arbeiten zu lassen, dann ist es nur recht und billig, wenn ich dir deine Ideen klaue. Damit kann ich mir dann wieder zurückholen, was du mir schuldest. In dieser Auseinandersetzung ging es um die wichtigste Ressource der Menschheit, es ging um das Wissen über neue Technologien. Dieser Krieg kannte keine Fronten, aber er benötigte Soldaten. Bald würde K. einer davon sein. Die Tentakel des Myzels hatten ihn geortet und begannen, ihn zu umranken.
„Bei so viel alter Autoprominenz brauchen sie eigentlich einen eigenen Mechaniker“, sagte K. zu Bockhold.
„Habe ich auch. Das managed mein alter Freund Simon für mich. Der hat finanziell ausgesorgt und besitzt noch mehr Autos, als ich. Unter anderem nennt er einen Original-Porsche-Spyder sein Eigen. Er treibt sich nur noch auf Märkten rum, wo Ersatzteile für die alten Schlitten gehandelt werden.“
Einige Tage später sollte K. auch diesen Simon kennen lernen. Es war ein langer dünner etwas linkischer Typ. Bockhold und er unterhielten sich wie zwei plappernde pubertierende Mädchen, als es um Vintage, also moderne Antiquitäten ging. K. bekam mit, dass die beiden nicht nur alte Autos sammelten, sondern jeder mehrere Exemplare unterschiedlicher Ausgaben der alten 08-Parabellum-Pistole im Schließfach hatte. Auch tauschten sie Auktionskataloge aus, in denen ausschließlich alte Nikons angepriesen wurden.
Interessante und teure Sammelleidenschaften haben die, typische technische Männerhobbies mit dem Mythos der Geheimdienste, dachte sich K., wahrscheinlich haben die zu viel Spionageromane gelesen. Darüber geht nur noch das Sammeln von Panzern und Flugzeugen. Tatsächlich interessierte sich Bockhold auch intensiv für die Anfänge des Raketenzeitalters in Peenemünde. Er hatte alles an Literatur zusammengetragen, was er dazu kriegen konnte. Irgendetwas Geheimnisvolles umwehte diesen Mann.
Die Tage und Wochen waren für K. angefüllt mit zahlreichen Meetings und Diskussionen über Verteidigungsstrategien bei den Gerichtsverfahren, in denen asbestbedingte Gesundheitsschäden verhandelt wurden. Es ging um die Schuldfrage, inwieweit das Inverkehrbringen asbesthaltiger Produkte bei den Anwendern zu Lungenerkrankungen geführt hatte und in welchem Umfang die daran beteiligten Firmen dafür nicht nur haftbar, sondern auch zu bestrafen seien. Insbesondere dieses Punic Damage trieb die Schadenersatz- und Strafzahlungen in Schwindel erregende Höhen.
Die Strategie war schlicht aber aufwendig: Wir machen uns bei den Klägern denkbar unbeliebt, indem wir wissenschaftlich-fachlich und argumentativ so fit werden, dass die Klägerseite davon rennt, wenn sie nur unseren Namen hört.
Anfänglich bereitete K. das intellektuelle Amerikanisch seiner Gesprächspartner, die ausnahmslos in Harvard oder Yale studiert hatten, gewisse Probleme. Sie verwendeten eine Idiomatik, die er vorher so noch nie gehört hatte. Erstaunt war er über das Easy Going in der Kanzlei. Hier wirkte keiner überarbeitet, alle waren relaxed. Eine solche Arbeitsatmosphäre bekommt man nur hin, wenn man zahlungskräftige Mandanten hat. Zermürbend für K. waren die stundenlangen Diskussionen zu Punkten, die er schon längst erledigt wähnte. Er war immer davon ausgegangen, dass Amerikaner rasch entscheiden. Das Gegenteil war der Fall.
Im großen Holzhaus Bockholds am Strand roch es moderig. Es war kein sehr aufdringlicher Geruch, zumal man ihn nach längerem Aufenthalt im Haus nicht mehr wahrnahm. Wie eine Dauerinfektion schleppte man aber diese dünne morbide Fahne in den Klamotten nach außen. Der Geruch begleitete einen dann den ganzen Tag und Leute, die einem zu nahe kamen, mussten meinen, dass man sein Zuhause im schimmeligen feuchten Keller habe.
Immer wenn Bockhold das Haus zusammen mit K. betrat, sog Bockhold die Luft tief ein und sagte ohne nähere Erklärungen abzugeben: „Das kommt von den alten Büchern.“ Das wirkte wie eine Autosuggestionsformel: Ich muss nur die Bücher entfernen, damit der Modergeruch weg ist. Aber warum räumte er die Bücher dann nicht einfach weg, fragte sich K. Einerseits diese Irrationalität und andererseits eine tiefgehende Beschäftigung mit wissenschaftlichen Fragestellungen. Das passte nicht zusammen. Diese Ambivalenz trat auch in seiner unverhohlen zur Schau gestellten Begeisterung für Deutschland und der gleichzeitigen Beschäftigung in einer jüdischen Anwaltskanzlei zu Tage.
Da musste es noch etwas Übergeordnetes geben, etwas, das wichtiger für ihn war, als die Autofirma, sein New York, die Kanzlei, seine Oldtimer und sein Haus, etwas, das sein Verhalten und seine Entscheidungen vor allem anderen dominierte. Vielleicht war Bockhold Mitglied in einem rechtsextremistischen Geheimbund. Überschießende nationale Gesinnungen waren ja in Amerika nichts Außergewöhnliches. K. war mit seinen ausschweifenden Fantasien zur Hintergrundanamnese Bockholds näher an der Wahrheit dran, als er es damals für möglich gehalten hätte.
Auf Einladung Bockholds landeten beide in einem Restaurant in Long Branch, welches deswegen jeden Abend so voll war, weil leidlich schmackhaftes Essen kredenzt wurde und weil die Showeinlagen der Köche die Herzen der Amerikaner höher schlagen ließen. Bockhold hatte offensichtlich den Status eines Stammgastes, denn der Schlitzäugige hinter dem Kochtresen streckte ihm zur Begrüßung die Hand entgegen.
Es war für K. nicht eindeutig auszumachen, ob das jetzt ein chinesisches, ein japanisches oder ein vietnamesisches Lokal war. Jedenfalls standen hinter Garplatten, die mehrere Quadratmeter groß waren, asiatische Köche mit hohen weißen Kochmützen. Rings um die Kochstelle gruppiert konnten die Gäste den Aktionen des Meisters beiwohnen. Bevor der die Shrimps, Rinderfiletstreifen oder das klein geschnittene Gemüse auf die heiße Platte gleiten ließ, zog er eine alberne Show mit Messern und anderen Kochutensilien ab. Die Teile flogen erst in der Luft herum und landeten dann auf seiner Mütze oder wurden von ihm mit der Hand im Rücken gefangen. Dazu erzeugte der Koch mit diversen Besteckteilen laute Klappergeräusche. Die Gäste waren begeistert.
Alkoholhaltige Getränke wurden in diesem Lokal nicht ausgeschenkt. Man brachte sich die Spirituosen selber mit. Bockhold hatte eine Weinflasche in einer braunen Packpapiertüte dabei. Er reichte die Tüte an den Schlitzäugigen. Der sollte die Flasche entkorken.
Alle zehn Minuten ertönte eine Fanfare. Schon wieder hatte einer der Gäste Geburtstag und schon wieder gab es eine mit funkensprühenden Wunderkerzen bestückte Torte, die aufs Haus ging. Es schien so, als wenn alle Einwohner von Long Branch ihren Geburtstag hier und heute feiern würden.
Während des Essens erlebte K. Bockhold als relativ einsilbig. Die Späßchen des Kochs kamen bei ihm nicht an. Mit seinen Augen verfolgte er aber trotzdem unentwegt den Asiaten hinter der Kochplatte. Todernst und hoch konzentriert schlichtete er erst die Shrimps und dann das Rinderfilet in sich rein. Von dem mitgebrachten Wein trank er jedoch kaum etwas.
Als Bockhold gezahlt hatte, gab ihm der Schlitzäugige die zusammengefaltete braune Papiertüte zurück, in der sich die Weinflasche befunden hatte. Bockhold steckte sie in die Innentasche seines Sakkos. Der ist wirklich kauzig, dachte sich K., sammelt er jetzt auch noch Einkaufstüten? Jetzt hatte sich Bockholds Stimmung schlagartig gewandelt. Unverständliche Introversion wich unverständlicher Exaltiertheit. „Als wenn ich heute auch Geburtstag hätte“, rief er und lachte laut. Er legte eine Zwanzigdollarnote als Trinkgeld auf den Tresen. Mit einem tiefen Schluck leerte er das vorher kaum angerührte Weinglas. „So ein schöner Tag!“
Auf der Rückfahrt zeigte sich Bockhold zwar weiter schweigsam, seine gute Laune bestand jedoch fort. K. hörte ihn eine nicht identifizierbare Melodie Summen und Pfeifen. Als sie wieder im Holzhaus am Strand angekommen waren, hatte K. eine bleierne Müdigkeit überfallen, die ihn schnell ins Bett trieb. Bockhold schien auch an keiner weiteren Konversation interessiert zu sein.
Nachts wachte K. auf und verspürte starken Durst. Er ging zum Kühlschrank in der Küche und holte sich ein Budweiser raus. Den Kronenkork entsorgte er in den Mülleimer. Dort sah er die zusammen geknüllte braune Papiertüte. Da war irgendetwas notiert. Einer inneren Eingebung folgend, zog er die Tüte aus dem Eimer. Er trank einen tiefen Schluck aus der Bierflasche. Dabei musterte er die Tüte und schaute in sie hinein. An der Oberkante innen waren zwei Zahlen mit schwarzem Filzstift hingeschrieben worden. Die eine Zahl war unschwer als Telefonnummer zu identifizieren, die andere schien eine Codenummer zu sein. Darunter stand noch take Brainforce App. K. riss die Notiz heraus und warf die Tüte wieder in den Mülleimer.
Zurück in seinem Zimmer nahm er sein iPhone zur Hand und installierte die Brainforce App. Dann wählte er die Telefonnummer. Es meldete sich eine synthetische Stimme die sagte: Wellcome to Brainforce, the leading company in neuroenhancement, please insert your Code Number. K. starrte ungläubig auf das Display. Er gab die andere Nummer ein. Da erschien auf dem Display: This is the application for Mr. Bob W. Bockhold. Was ist denn das für ein Zauber, wunderte sich K. Jetzt hatte sich auf dem Display eine Art Desktop aufgetan. Es gab Chanel 1-3, jeweils mit den Funktionen Frequence und Voltage. Symbolisierte Regler konnten mit dem Touchscreen bewegt werden.
K. drückte Kanal 1 und spielte ein wenig mit den Reglern. Zunächst passierte nichts. Doch dann hörte er Rumpeln in der Küche. Durch einen Türspalt konnte er Bockhold sehen, wie der vor dem Küchentisch kniete und hektisch auf der Tastatur seines Mobile Phones herumdrückte. Das Gerät hatte er wohl vor dem Zubettgehen dort liegen lassen. Er schien völlig derangiert zu sein. Er hielt das Handy beschwörend hoch und schüttelte es. Immer wieder bediente er die Tastatur. Das Handy war auf Mithören gestellt, so dass K. das Besetztzeichen hören konnte. Der Anwalt schien einem Nervenzusammenbruch nahe.
Instinktiv unterbrach K. die Verbindung. Die Leitung war frei und Bockhold gelang es beim nächsten Einwahlversuch einen Anschluss zu bekommen. Er hatte sich zitternd auf einen Stuhl gesetzt. Das blaue Display hielt er dicht vor seine Augen, wodurch sein Gesicht gespenstisch ausgeleuchtet wurde. Er war jetzt offensichtlich im selben Bedienprogramm, in dem K. herumgedrückt hatte. Er versuchte, die Parameter auf Normalstellung einzuregulieren, was offensichtlich gelang. Denn langsam beruhigte er sich. Er lehnte sich weit zurück und atmete tief durch. Dann erhob er sich schwer und wankte in sein Schlafzimmer zurück.
K. hatte die gespenstische Szene staunend beobachtet. Ganz hatte er die Bedeutung der Nummern noch nicht begriffen. Doch soviel stand fest, das war der Zugang zu so einer Art Joystick mit dem man Bockhold auf eine recht fiese Art malträtieren konnte. K. schlief nur schwer wieder ein.
Auch im großen Amerika gibt es Spießer, möglicher weise mehr als bei uns zu Hause, diese Meinung verfestigte sich bei K. in den Tagen, in denen er mit Bockhold zu tun hatte. K. sah sich in dieser Auffassung bestätigt, als Bockhold zu dem Besuch eines Musicals am Broadway einlud. Gespielt wurde Mama mia, eine kitschige Abba-Homage mit einer dünnen Story und mittelmäßig singenden und schauspielernden Akteuren. Der Saal war randvoll, das Publikum tobte. Die Leute standen teilweise auf den Klappsitzen. Bockholds Augen glänzten. Er grölte die Melodien mit, ohne den Text zu kennen. Dabei zuckte sein Körper einen Antitakt zum vorgelegten Rhythmus. K. musste kurzzeitig an seinen ehemaligen Vorstandskollegen Bosse in der Health Care Foundation denken, der bei Songs von DJ Ötzi in Ekstase geraten war.
K. hatte die Nase voll von der permanenten mittäglichen Futterei von lieblos zusammengeflickten Sandwichs, welche der Cateringservice lieferte. Wieso kriegen die im Land des Ketchups und der deftigen Fertigsaucen keinen Geschmack in diese Dinger rein, wunderte sich K. Aber auch unten auf den Straßen gab es nichts Akzeptables zu essen. Man lief überall in die Ernährungsfalle, in der man von Hamburgern und Hot Dogs bedroht wurde.
An manchen Tagen kam sich K. beim Gang über die Wallstreet vor, wie in einer Kulisse auf dem Gelände eines Hollywoodstudios. Laufend wurden irgendwelche Filmszenen gedreht. Wenn wieder ein berühmter Schauspieler auf dem Set erschien, ging ein Raunen durch die gaffende Menge. Dabei lief im Verborgenen ein wesentlich interessanterer Streifen mit leibhaftigen Helden, die aber niemals zu Kinoruhm kommen würden. K. war auf dem besten Weg, auch so ein heimlicher Held zu werden.