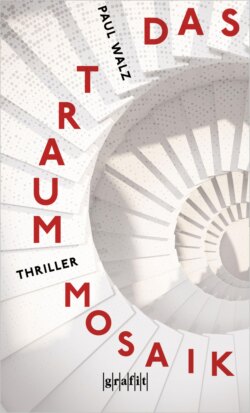Читать книгу Das Traummosaik - Paul Walz - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1
ОглавлениеSechs Monate später: Montag, 14. November
Das elektrische Summen des Öffners war wie eine Befreiung. Finkler drückte die Tür auf und verließ rasch die Schleuse, froh darüber, den Blicken des Beamten zu entkommen, der ihn eingelassen hatte. Er wusste, wie er aussah.
Alleine im Treppenhaus schloss er die Augen und sog den Geruch des Präsidiums in seine Nase. Irgendwoher hörte er das dunkle Brummen eines Elektromotors, eine Bürotür öffnete sich und schlug wieder zu, ließ kurz Gesprächsfetzen und ein helles Lachen auf den Gang dringen. Dann war da nur das undefinierte Gemurmel eines geschäftigen Bürohauses. Er spürte so etwas wie Freude, doch noch deutlicher Fremdheit. So mussten sich Seeleute früher gefühlt haben, die nach einem heftigen Sturm wohlbehalten im heimatlichen Hafen einliefen und erstaunt feststellten, dass sich nichts geändert hatte – außer vielleicht sie selbst.
Als Finkler die Treppe nach oben blickte, zögerte er kurz. Sechzig Stufen. Eine Kleinigkeit, doch nicht unbedingt für ihn, seinen Körper, nicht für das bisschen, das übrig geblieben war. Er ergriff das Geländer und nahm ohne Pause eine Stufe nach der anderen, ignorierte, wie sein Puls zu traben und schließlich zu galoppieren begann.
Als er kaum die Hälfte hinter sich gebracht hatte, ging es nicht mehr. Er blieb stehen und rang nach Atem. Der Schweiß auf seiner Stirn fühlte sich unangenehm kalt an. Er keuchte und starrte auf den Granit zu seinen Füßen. Es war ihm früher nie aufgefallen, dass weiße Einschlüsse das dunkelgraue Material durchzogen wie ein Geflecht aus Arterien und Kapillaren.
Jemand ging an ihm vorbei, ohne ihn zu beachten. Schließlich mühte er sich weiter.
Die vergangenen Tage war er angespannt gewesen. Er hatte kaum geschlafen und noch weniger gegessen. Nur noch wenige Stufen fehlten, als sich plötzlich eine Hand auf seine Schulter legte. Er fuhr zusammen.
»Da bist du ja.«
Daniel Bender lächelte ihn an. Er war so ziemlich der einzige der Kollegen, den Finkler vermisst hatte, jetzt, da Güdner nicht mehr da war.
Bender war sichtlich damit überfordert, was er mit seinen Händen zur Begrüßung machen sollte, schütteln oder umarmen, und klopfte ihm schließlich, sozusagen als Kompromiss, auf die Schulter.
»Warum nimmst du nicht den Aufzug?«
»Training für den Fitnesstest.«
»Sieht gut aus, dynamisch.«
Ein Grinsen teilte Benders Gesicht, das wie immer blass und unausgeschlafen wirkte.
Seine Freundlichkeit tat gut.
»Du solltest mich mal im Wald erleben.«
»Marathonmann?« Wieder grinste Bender. »Komm, wir gehen nach oben.«
Finkler musste sich anstrengen, um mitzuhalten. Obwohl sein Kollege schlich und dabei angeregt auf ihn einredete, forderten die wenigen verbleibenden Stufen alles von ihm. Als sie oben angekommen waren, ließ Bender sich nichts anmerken und schlenderte plaudernd über den mit Linoleum ausgelegten Flur in Richtung Finklers Büro.
Abteilung III beschäftigte nur eine Handvoll Beamte, die alle darauf spezialisiert waren, der organisierten Kriminalität zu Leibe zu rücken. Hier hatte sich scheinbar nichts verändert. Wände, die einen Anstrich vertragen hätten, Türrahmen, die von aneckenden Aktenwagen beschädigt waren, armselige Pflanzen, die schon auf den Fensterbänken gestanden hatten, bevor Finkler ausgefallen war.
Eine der Türen stand offen. Kommissar Matthias Schäfer, der Glatzkopf, saß wie immer vor dem Bildschirm und analysierte die Ergebnisse irgendwelcher Spurenanalysen. Er nickte Finkler mit zurückhaltendem Lächeln zu.
»Wieder da?«
Finkler nickte zurück und Schäfer widmete sich ohne weitere Fragen wieder seiner Arbeit. Mehr nicht, nach sechs Monaten Koma und Reha. Finkler schluckte.
»Ich muss dich vorwarnen«, sagte Bender in einem ernsteren Ton, »in deinem Büro sitzt ein Neuer. Er …«
Finkler blieb konsterniert stehen.
»Wie bitte? Aber das …«
Er brach ab.
»Wir brauchten Ersatz, die Arbeit macht sich nicht von selbst und Güdner kommt nicht wieder.«
Finkler versuchte, die Fassung wiederzuerlangen. Aber natürlich, die Welt drehte sich weiter und leere Schreibtische wurden wieder besetzt.
»Was ist mit Achims Sachen?«
»Wir haben alles Private an seine Frau gegeben.«
Finkler schwieg. Als sie vor seinem Büro angekommen waren, schloss er seine Hand um den Griff, nickte Bender zu und gab ihm zu verstehen, dass er das jetzt alleine machen würde. Bender nickte und legte ihm ermutigend die Hand auf die Schulter.
»Gut, dass du es bis hierhin geschafft hast. Den Rest kriegst du auch noch gebacken.«
Finkler wartete, bis der Kollege um die Ecke verschwunden war. Das letzte Mal, dass er an dieser Tür gestanden hatte, war an einem hellen Maitag gewesen und Güdner hatte von den Plänen fürs kommende Wochenende erzählt: eine Familienwanderung im Taunus. Mittlerweile lagen Lebkuchen in den Regalen und die Läden bereiteten sich auf das Weihnachtsgeschäft vor. Und Güdner war tot.
Irgendwann merkte Finkler, dass er nicht mehr wusste, wie lange er schon reglos hier gestanden hatte. Er holte tief Luft – dann ging er hinein.
Das Büro schien verändert. Güdners Unordnung war verschwunden und an seinem Schreibtisch saß der Neue. Er sprang auf und reichte Finkler die Hand. »Lukas Schulz.«
Der neue Kollege war älter, als Finkler erwartet hatte, kein Anfänger mehr und fast ebenso groß wie er selbst. Nun sah er Finkler mit geradem Blick aus blauen Augen an und drückte ihm fest die Hand.
»Tut mir leid, dass ich Ihr Büro belagere!«
»Nicht doch. Was können Sie dafür?«
»Ich habe mich hierher versetzen lassen.« Schulz lächelte vorsichtig und strich sich durch die hellen Haare. »Einen Monat nach Ihrem Unfall.«
Finkler wusste nicht, was er antworten sollte. Er setzte sich an seinen Schreibtisch, schaltete den Bildschirm ein und kam nicht mehr weiter.
In seinem Kopf herrschte die völlige Leere, die ihn seit dem Erwachen aus dem Koma begleitete. Es war, als ob er zum ersten Mal mit diesem System arbeiten würde. Ziellos tippte er auf der Tastatur herum, um so zu tun, als ob er weiterkäme, ohne das Geringste zu erreichen.
»Oben rechts in der Ecke auf das kleine Quadrat, danach Ihre E-Mail-Adresse und das neue Passwort, das Sie in dem Umschlag dort finden.«
Ihre Blicke trafen sich einen Augenblick und Finkler hoffte, dass Schulz nicht erfasste, wo das Problem wirklich lag. Er nickte und griff nach dem Umschlag, während er seinen Kollegen musterte. Ein scharfsinniger Mann, er würde ihn im Auge behalten.
***
Als Finkler ins Vorzimmer des Chefs kam, strahlte Carla Hesse.
»Da ist er ja. Unser Held!«
Finkler hob abwehrend die Hände und schüttelte den Kopf. Gleichzeitig musste er ein Grinsen über ihr knallbuntes Outfit unterdrücken, dessen Farbkombination er nicht einmal an Karneval riskiert hätte. Aber eigentlich passte es gut zu ihr, genauso wie ihre rot gefärbten Haare. Carla hatte nie geheiratet, vielleicht, weil sie jahrelang ihre Mutter gepflegt hatte. Seit deren Tod konzentrierte sie ihre überschüssige Energie auf ihre getigerte Katze. Und auf den Zusammenhalt der Abteilung. Ohne ihr Zutun würden die Geburtstage vergessen, gäbe es keine Weihnachtsfeier und wohl auch keinen Betriebsausflug. Wenn man ein Problem hatte oder eine Information brauchte, war man bei ihr genau richtig. Er fühlte sich zum ersten Mal an diesem Morgen wirklich zurückgekehrt.
»Das mit Güdner hat uns alle schwer getroffen.« Es entstand eine Pause, in der sich kurz ein Schatten über ihr Gesicht legte, doch dann lächelte sie wieder. »Und deshalb ist es umso schöner, Sie wieder im Dienst zu sehen.«
Es klang wie ein Abschlusssatz, jedoch machte Carla Hesse keine Anstalten, ihn über die Gegensprechanlage beim Chef zu melden. Vielmehr begutachtete sie ohne jede Scheu die Stelle, an der die Ärzte Finkler ein Stück der Schädelplatte herausgeschnitten hatten, um den Druck der Blutung zu senken, und an der jetzt wulstiges Gewebe breit die kurz geschnittenen Haare durchfurchte.
»Darf ich ehrlich sein? Ihr Kopf sieht furchtbar aus.«
Finkler war von vorneherein klar gewesen, dass er bei Carla Hesse nicht so einfach davonkommen würde wie bei Bender und Schulz, die ihn nicht mit Nachfragen gelöchert hatten. Carlas Währung waren Informationen und die wollte sie jetzt von ihm bekommen. Er tat ihr den Gefallen, nahm dankend einen Kaffee und erzählte, was er sich während der Reha als Geschichte für solche Momente zurechtgelegt hatte. Er hoffte, dass das Wenige, das er preisgab, genug sein würde, um glaubwürdig zu bleiben und keine Nachfragen zu provozieren, die er nicht beantworten wollte.
Nachdem er ihr von seinem schweren Weg zurück ins Leben, seiner zweiten Geburt, wie er es nannte, berichtet und ihr gezeigt hatte, wie mühsam sich wochenlang wenig bewegte Sehnen wieder dehnten, wie schwer sich Worte nach einem Koma wiederfanden, machte er eine kurze Pause und nahm einen Schluck von seinem Kaffee. Eine Kunstpause vor seinen Abschlusssätzen, die sich bisher bei allen als sehr wirkungsvoll erwiesen hatte.
»Im Prinzip hatte ich Glück. Nach der Glasgow-Koma-Skala gehöre ich zu einer ganz kleinen Gruppe von Patienten, die sich davon wirklich gut erholen.« Er hätte die Worte inzwischen im Schlaf herunterbeten können, so oft hatte er sie von den Ärzten gehört. »Zwischen dreißig und vierzig Prozent schaffen es nicht, weitere zehn bleiben geistig so beschädigt, dass sie im Wachkoma dahinvegetieren. Ich bin einer von Wenigen, die wirklich wieder fit werden, eine Ausnahme.«
Es entstand eine weitere Pause, in der Carla ihn mitfühlend anblickte.
»Was ist mit dem Lkw-Fahrer?«, fragte sie schließlich.
Finkler schüttelte den Kopf. »Nein, die Kollegen haben nichts in der Hand.« Und obwohl ihm klar war, dass sie sicherlich auf Stand war, ergänzte er: »Nach wie vor weiß keiner, wer mich und Achim überfahren hat.«
»Ich hoffe, dass man den Dreckskerl irgendwann findet«, sagte Carla Hesse schließlich und drückte den Knopf der Gegensprechanlage, um ihn bei seinem Chef anzumelden.
***
Procks Büro war groß und wie immer unaufgeräumt. Der kleine Besprechungstisch, an den der Chef Finkler bat, war vollgestapelt mit Akten, die Prock nun umständlich auf den Boden legte, während er sich laufend die langen Haarsträhnen über seine fortschreitende Halbglatze strich. Er hatte ein rundes Gesicht, an dessen Seiten mit der Zeit Fettpolster so wahllos entstanden waren, als hätten sich kleine Kinder mäßig erfolgreich darum bemüht, sie zu modellieren. Nicht umsonst nannte ihn die Belegschaft hinter vorgehaltener Hand »Französische Bulldogge«.
Finkler mochte Prock. In seinen Augen war er ein guter Ermittler und außerdem kein schlechter Vorgesetzter. Mit Prock hatte er immer gerne zusammengearbeitet und er bemerkte, wie ruhig er in der Atmosphäre dieses Büros wurde. Hier hatten sie gemeinsam heikle, aber erfolgreiche Entscheidungen getroffen und ihre Erfolge gefeiert.
Als Prock den Tisch endlich freibekommen hatte, nahmen sie Platz. Prock blickte Finkler in die Augen und nestelte an seiner Krawatte.
»Wie geht es dir?« Er hatte eine leicht hechelnde Stimme und stemmte den kurzen Körper in seinem Stuhl hin und her.
»Alles auf dem Weg. Nur der Körper braucht noch ein wenig.«
Prock grunzte zustimmend. Dann schwieg er und begann, einen unsichtbaren Fleck von der Platte zu wischen. Finkler beschlich ein ungutes Gefühl. Was war los? Als die Pause so lang wurde, dass es ihn peinlich berührte, versuchte er das Gespräch voranzutreiben.
»Wo willst du mich einsetzen?«
Prock blickte zum Fenster und räusperte sich.
»Ich werde ehrlich mit dir sein. Mir wäre es lieber gewesen, man hätte dich versetzt.« Prock hob die Hände, als er Finklers Überraschung sah. »Das hat nichts mit dir zu tun. Aber wo soll ich mit dir hin?«
Finkler senkte den Blick und sah auf die verkratzte Oberfläche des Tischs. Er versuchte, sich seine Enttäuschung nicht anmerken zu lassen.
»Kurt, ich kann wieder der werden, der ich vor dem Unfall war!«
Prock zog die Augenbrauen in die Höhe. »Machen wir uns nichts vor: Das wird sehr lange dauern. Eine Ewigkeit. Wenn es dir überhaupt gelingt.«
»Wenn es dir so gegen den Strich geht, dass ich wieder hier bin – warum hast du mich überhaupt zurückgeholt?«
»Vizepräsident Bierbrenner, der alte Freund deines Vaters, ist dagegen, dich zu versetzen. Es soll nicht so aussehen, als ob du dafür bestraft würdest, ein Menschenleben gerettet zu haben. Wahrscheinlich fürchtet er sich vor der Presse. Oder vor dem Russen, dessen Tochter du vor dem Lkw bewahrt hast.« Prock hob die Hände. Plötzlich war seine Stimme kalt. »Mich kotzt das Ganze an. Das ist nicht persönlich gemeint.«
»Spar dir das Geschwätz.« Finklers Blick bohrte sich in Procks Augen. »Was also?«
»Also gut: Wir sind personell am Limit. Ich kann mir einfach niemanden leisten, der nicht voll einsatzfähig ist. Mir fehlt jemand für die Ermittlungsarbeit. Was mir nicht fehlt, ist ein Sanierungsfall.« Prock schenkte sich Kaffee ein und schlug einen geschäftsmäßigen Ton an. »Was soll’s, ich kann es ohnehin nicht ändern. Also: Durch deinen Ausfall und Achims Tod sind wir in den letzten Monaten im Rosetti-Fall kaum vorangekommen. Ich habe Bender und Schulz drangesetzt, die beiden sind aus euren Aufzeichnungen aber nicht schlau geworden. Deine Rückkehr könnte also wenigstens hier etwas Gutes haben. Es gibt Lücken, die nur du füllen kannst.«
Prock sah ihn an wie ein lästiges Problem. »Also setz dich an die Akten und leg los. Wenn du so weit bist, machen wir eine Besprechung in der großen Runde, da sehen wir dann weiter.«
***
Der Abend brach früh herein. Schon gegen sechs Uhr fiel die Dämmerung über die Stadt und kaum eine halbe Stunde später herrschte draußen vor den Gebäuden dunkle Nacht.
Finkler war allein im Büro. Lukas Schulz war nicht mehr an seinem Schreibtisch gewesen, als Finkler von Prock zurückgekommen war, und seitdem nicht wieder aufgetaucht. Auch Daniel hatte sich nicht mehr blicken lassen. Finkler hatte genug Zeit gehabt, die Akten des letzten großen Falls zu studieren, den er und Güdner gemeinsam bearbeitet hatten. Jetzt stand er am Fenster und sah geistesabwesend auf die Lichtkegel, die von den Scheinwerfern in den Dunst projiziert wurden. Die Menschen waren auf dem Heimweg. Die Eschersheimer Landstraße war schon in beiden Richtungen verstopft und er wusste, dass es auf Miquel- und Adickesallee nicht besser sein würde.
Es war Zeit, den Fakten ins Auge zu sehen: Sein Gedächtnisverlust war auch hier so schlimm und so vollkommen, wie er es befürchtet hatte.
Sein Handy klingelte. Es war Melanie. Er lächelte müde. Sie war bei ihm geblieben, hatte sein Koma auch überstehen müssen, ihn bei der Reha unterstützt, doch nun zeigten sich Risse in ihrer Beziehung.
»Wie war der erste Tag?«
»Durchwachsen. Alles ist weg.«
»Wie?«
»Na, meine Erinnerungen an den Fall. Nichts ist mehr da.«
Sie seufzte. »Das war doch klar. Du hast es doch schon vorher nicht mehr zusammenbekommen. Hast du Prock die Wahrheit gesagt?«
Sie hatte ihm von Anfang an davon abgeraten, jetzt schon ins Präsidium zurückzukehren. Sie hielt ihn noch nicht für stabil genug. Und als sie gemerkt hatte, dass er nicht umzustimmen war, hatte sie versucht, ihm das Versprechen abzuringen, dass er Prock wegen seiner Erinnerungslücken reinen Wein einschenkte.
»Du weißt, dass das nicht geht.«
»Wieso?«
»Weil ich den Fall beenden will, weil ich hierbleiben und nicht in einem Büro versauern will. Darum!«
»Was ist daran so schlimm? Bei deinem Zustand wäre ein ruhigerer Job garantiert besser.«
»Auf gar keinen Fall!«, brauste er auf. »Ich möchte nicht schon wieder darüber diskutieren.«
Er bereute es sofort.
»Du könntest es doch bloß nicht ertragen, weniger erfolgreich zu sein als dein Vater. Oder? Ist es das?« Sie war genervt.
Finkler beobachtete den Verkehr. »Sehen wir uns heute Abend?« Er fragte, obwohl er die Antwort schon kannte.
»Das schaffe ich nicht. Ich bin noch im Büro.«
Sie schwiegen einen langen Augenblick. Unten hatte es einen leichten Auffahrunfall gegeben. Ein SUV hatte den Wagen des Vorausfahrenden berührt und nur Sekunden später standen sich die beiden Kontrahenten in der feuchten Kälte gegenüber und brüllten sich warm. Finkler begann in seinem Mantel zu schwitzen.
»Ich muss jetzt los«, sagte er schließlich. »Und danke.«
»Wofür?«
»Dass du für mich da bist.«
Keine Reaktion.
Sie legten auf.
Alles war weg. Nicht nur seine Zeit im Koma, auch die Wochen davor waren komplett ausgelöscht. Es war, als hätte er während dieser Zeit nicht gelebt. Manches hatte ihm Melanie zwar erzählt, als es ihm langsam besser ging, aber da sie beide vor dem Unfall sehr eingespannt gewesen waren, konnte sie nur wenige seiner Lücken füllen. Und auch alles, was er über den Unfall selbst wusste, hatte er den Erzählungen anderer entnommen.
Die Psychologin, die ihn seit der Reha betreute, hatte ihn immer wieder ermutigt, nicht aufzugeben, und so hatte er gehofft, dass ihm die Zeit irgendwann Stück für Stück sein Gedächtnis zurückgeben würde. Auch die Ordner hatte er heute in der Hoffnung gewälzt, irgendwo eine Information zu finden, die wie ein Funke seine Erinnerungen an den Fall zum Leben erwecken würde. Doch das Aha-Erlebnis war ausgeblieben. Selbst seine eigenen Vermerke lasen sich, als wären sie von einem Fremden verfasst worden. Über seinen letzten Fall wusste er am Ende des Tages im Wesentlichen nicht viel mehr als das, was er heute aus den Akten erfahren hatte.
Der Fokus der Ermittlungen hatte auf Maurizio Rosetti gelegen, dem Capobastone eines italienischen Clans. Dieser stand im Verdacht, ein weitverzweigtes kriminelles Netzwerk zu betreiben, das im Drogengeschäft, der Prostitution und dem illegalen Müllgeschäft immense Umsätze erwirtschaftete. Da in Deutschland die Rechtslage günstig war, günstiger zumindest als in Italien, wurden die eigenen und vermutlich auch die Gelder anderer Organisationen in gigantischem Stil hier gewaschen.
Die Annahme, die es zu beweisen galt, war das Übliche: Der Clan hatte in Mittelstädten, die ausreichend groß waren, um Anonymität zu gewährleisten, Spielhallen, Restaurants und weitere Einrichtungen übernommen, die typischerweise viel Barumsatz machten, um diese als »Waschmaschine« zu nutzen. Das saubere Geld wurde anschließend in Immobilien, Beteiligungen und sonstige legale Geschäfte investiert, sodass sich der kriminelle Teil der Organisation hinter einer legalen Fassade verstecken konnte. Alles nach außen völlig unverdächtig. Die wahre Funktion war kaum zu beweisen, solange die Organisationsmitglieder dichthielten. Geriet einer der Läden in Verdacht, wurde er augenblicklich geschlossen. Die Spuren waren schnell verwischt. Die Konten wurden aufgelöst, die Eigentümer lebten typischerweise im Ausland, ein Nachweis des wahren Geldflusses blieb praktisch unmöglich.
Die Akten zeigten, dass es ihnen damals noch nicht einmal gelungen war, das Firmengeflecht aus Bau-, Planungs-, Projekt- und Verwaltungsunternehmen, das mit dem gewaschenen Geld finanziert wurde, so weit aufzuschnüren, dass Rosetti selbst ohne Zweifel damit in Verbindung zu bringen war. Güdner schien an der Aufgabe schier verzweifelt zu sein. Probleme machten vor allem die Struktur und Verschachtelung der Firmen, die in wenigstens fünfzehn Ländern saßen, von denen die meisten keine Auskünfte erteilten. Und die Angst der Beteiligten, die sich im Dunstkreis des Syndikats befanden. Den Akten nach hatten sie lange auf der Stelle getreten, bis schließlich wie so oft der Zufall die Ermittlungen angestoßen hatte.
Einige italienische Wirte, die legal arbeiteten, sahen sich durch die Machenschaften der Rosettis zunehmend in Verruf gebracht und begannen zu opponieren. Zeugen tauchten auf und erstatteten Anzeige, was ihnen neue Ansatzpunkte geliefert hatte. Die Organisation jedoch unterdrückte die streitbaren Wirte brutal. Auch hier gab es eine Arbeitsteilung. Die Italiener machten sich nicht selbst die Finger schmutzig, sondern beauftragten Armenier, Albaner oder Kosovaren damit, für Ordnung zu sorgen. Diese bedrohten die Wirte, schlugen sie zusammen oder zündeten ihre Autos an. Schließlich wurden die Anzeigen allesamt zurückgezogen.
Und obwohl es der Polizei gelang, einen der Täter zu schnappen, ließ sich keine Verknüpfung zur Organisation herstellen. Der Schläger wurde bestraft, mehr geschah nicht. Die kurze Hoffnung auf einen Durchbruch war dahin – bis es Finkler gelungen sein musste, im Nachgang der ganzen Geschichte eine Kontaktperson aus der unmittelbaren Nähe der Familie umzudrehen.
Sein Unfall hatte die Ermittlungen praktisch auf Eis gelegt und alle schienen zu hoffen, dass es nun mit seiner Hilfe und seinem Wissen weiterging.
Was das Aufarbeiten erschwerte, waren Lücken in den Unterlagen. Zu seinem Kontakt fanden sich beispielsweise keine konkreten Angaben. Weder ein Name noch ein Foto waren zu finden. Im Normalfall wurden sie dazu angehalten, regelmäßig einen Bericht abzuliefern. Eigentlich müsste er Prock oder Daniel fragen, ob es eventuell eine ausgelagerte Fallakte gab, in der man Teile der Hauptakte zusammengefasst hatte. Doch wie sollte das gehen, ohne zuzugeben, dass er alle Erinnerungen verloren hatte? Wenn das Prock zu Ohren käme, würde er endgültig bei ihm durchfallen.
Seine Pflegemutter hatte in solchen Situationen immer einen Spruch auf Lager gehabt, der ihm nun einfiel: Schlimmer geht immer.